Informationen Über Technik Und Ausrüstung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Victor Or Villain? Wernher Von Braun and the Space Race
The Social Studies (2011) 102, 59–64 Copyright C Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0037-7996 print / 2152-405X online DOI: 10.1080/00377996.2010.484444 Victor or Villain? Wernher von Braun and the Space Race JASON L. O’BRIEN1 and CHRISTINE E. SEARS2 1Education Department, University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, USA 2History Department, University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, USA Set during the Cold War and space race, this historical role-play focuses on Wernher von Braun’s involvement in and culpability for the use of slave laborers to produce V-2 rockets for Nazi Germany. Students will grapple with two central questions. Should von Braun have been allowed to emigrate to the United States given his affiliation with the Nazis and use of slave laborers? Should the U.S. government and military have put Braun in powerful positions in NASA and military programs? This activity encourages students to hone their critical thinking skills as they consider and debate a complex, multi-layered historical scenario. Students also have opportunity to articulate persuasive arguments either for or against von Braun. Each character sketch includes basic information, but additional references are included for teachers and students who want a more in depth background. Keywords: role-play, Wernher von Braun, Space Race, active learning Victor or Villain? Wernher von Braun and the Space Role-Playing as an Instructional Strategy Race By engaging in historical role-plays, students can explore In 2009, the United States celebrated the fortieth anniver- different viewpoints regarding controversial topics (Clegg sary of the Apollo 11 crew’s landing on the moon. -
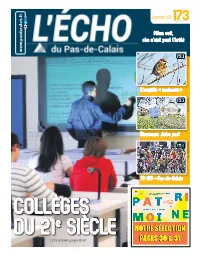
Bienvenue Autre Part 71E
o 1 L’Écho du Pas-de-Calais n 173 – Septembre 2017 Septembre 2017 o n 173 ISSN 1254-5171 Mitan cuit, cha n’sint pont l’brûlé www.pasdecalais.fr p. 10 Photo LPO 62 L’enquête « moineaux » p. 12 Photo Yannick Cadart Bienvenue Autre part p. 22 Photo Christian Defrance 71e GPI – Pas-de-Calais COLLÈGES DU 21e SIÈCLE Notre dossier pages 16-17 Photo Sébastien Jarry 2 360° L’Écho du Pas-de-Calais no 173 – Septembre 2017 Sommaire 4 Vie des territoires La Cote 70 à jamais Photo Jérôme Pouille 15 Grande Guerre dans les mémoires 16 Dossier 18 Vie pratique 20 Expression des élus 21 Identité 22 Sports Annoncer un événement, proposer un reportage… une seule adresse : 24 Arts & Spectacles f5 rue du 19-Mars 1962 62000 Dainville 26 À l’air livre Entre les 15 et 25 août 1917 sont tombés sur le sol de Loos-en-Gohelle plus de 9 000 soldats canadiens venus libérer le peuple français. C’est la bataille de la Cote 70. Malgré son importance décisive pour la victoire des alliés ; malgré son caractère exceptionnel pour le Canada, elle a longtemps été oubliée. Désormais, un Mé- morial s’élève fièrement au cœur de la commune. Inauguré en avril dernier par le Gouverneur général du Canada, il a accueilli récemment une commémoration 27 Agenda émouvante. Les habitants s’y sont associés avec « une profonde reconnaissance », ce sont les mots du maire Jean-François Caron. Entre sonnerie aux morts et sanglots de cornemuses, dépôts de gerbe et interventions de dignitaires canadiens et français, l’événement s’est fait, selon Mark Hutchings, président de la fondation qui a financé le mémorial, Hill 70, « le symbole de la solidarité de deux blocs démocratiques partageant le même esprit ». -

Wernher Von Braun a Scientist in War Time
Wernher Von Braun A scientist in war time Visa : Bruno Decriem Educational department 1 2 Objectifs pédagogiques Ce parcours, destiné à des élèves de collège présente le parcours d’un scientifique Wernher von Braun. Parcours pluridisciplinaire, à dominante sciences, il associe Sciences et Histoire, il aborde l’éthique des sciences et techniques et se termine sur une réflexion citoyenne et humanitaire. L’élève doit prélever dans les expositions les informations qui lui permettront de reconstituer le parcours humain et scientifique de Von Braun. Ce dossier est présenté sous forme de fiches pour que le professeur puisse les adapter à sa propre démarche pédagogique. Contenu des fiches Fiche 1 –Von Braun : sa jeunesse Ce jeune scientifique est recruté par l’armée allemande pour construire des armes nouvelles. La fusée A4/V2 et son principe de fonctionnement sont développés pour comprendre l’utilisation de cette nouvelle arme de destruction massive. Des projets inquiétants sont étudiés dans les laboratoires de Peenemünde. Fiche 2 – Von Braun : sa période nazie Par opportunisme et pour continuer à pouvoir développer son rêve, Von Braun intègre volontairement et, au plus haut niveau, le parti nazi. Charismatique, charmeur, obstiné et convaincant, il séduit Hitler et obtient des moyens financiers et technologiques considérables pour mettre au point à Peenemünde le premier missile de l’Histoire. Ces armes terroristes sont utilisées contre des civils et provoquent d’énormes destructions à Londres et Anvers. Fiche 3 – Von Braun : sa période américaine. A partir de 1945, Von Braun va vivre une nouvelle existence en participant à la mise au point des premiers missiles américains. -

Aire-Sur-La-Lys 72 Culture 26
Summary 04 PAYS DE SAINT-OMER 34 LUMBRES 36 FAUQUEMBERGUES 28 ARQUES 72 CULTURE 26 AIRE-SUR-LA-LYS 30 THÉROUANNE 32 THE HEM VALLEY 38 THE AUDOMAROIS MARSHES LEISURE 63 & RECREATION 54 NATURE AND SPORT ACCOMMODATIONS, LOCAL PRODUCES RESTAURANTS & EVENTS 50 REMEMBRANCE 88 & SCIENCE 70 KNOW-HOW 130 SAINT-OMER TOURIST OFFICE - 7 Place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer • +33.321.98.08.51 • m [email protected] V www.tourisme-saintomer.com Editorial director: Julien Duquenne • Copyrigt: Laure Decoster, Pays d’art et d’histoire, Comimatex - OTPSO, Photo Carl - OTRSO, P.Hudelle Balades en Audomarois, Interstice, Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, Tercréa, A.U.D.R.S.O, P.Queste, F.Legris, Ville d’Aire-sur-la-Lys, Enerlya, La Coupole, Isnor, Eden 62, Maison du Marais, Audobarquoise, Najeti Hôtel du Golf & Aa Saint- Omer Golf Club, Aéroclub, Rando-rail, CFTVA, Les Belles Echappées, Dennlys Parc, Bal Parc, Planet Karting, Port de plaisance d’Arques, SCENEO, Espace 36, Ecole d’Art, La Barcarolle, Ville de Saint-Omer, Communauté de Communes du Pays de Lumbres, Ville d’Arques, OCA, OTPSO, Jean-Claude Renaux, L. Rangognio, mus ées de Saint-Omer, OTAVH, Atelier terre de Flandre, Jérôme Pouille, René Dehondt, loeildeiannick, Aéro Fun Formation, Bruno Delannoy VDN • Photo production: Studio 2 bis - Gael Heux • Photo shooting acknowlegements: Olivia Leviez / Hervé Brami / Marion Beaussart / Clément Blary / Axel Landrecies / Quentin Boulinguiez / Musée Henri Dupuis / Les faiseurs de Bateaux / MDE / Le Rando-rail / Train Touristique de la Vallée de l’Aa / La mairie de Saint-Omer. -

Le V-2 Arme Stratégique
Le V-2 arme stratégique par Gérard Hartmann d’un obus propulsé capable de bombarder La société Verein für l’ennemi à plus de 200 kilomètres (tir balistique hors atmosphère). Mais les travaux Raumschiffahrt de recherche aux résultats douteux et lointains n’intéressaient pas les militaires qui voulaient Dès qu’on sort de notre atmosphère, des solutions immédiates pour se sortir de la l’espace est totalement noir (sans lumière), guerre. Cinq années plus tard, en 1922, Oberth propose de nouveau au ministère de la guerre irrespirable (sans air), désorienté (pesanteur allemand l’étude d’un missile de plus faible), irradié (traversé de particules bombardement à longue portée. Certains cosmiques), glacé (-70°C) et dangereux militaires, en particulier dans l’artillerie, (bombardé de météorites). Mais pourtant, comprennent le principe de la fusée qui l’homme rêve d’y voyager. Adeptes des voyages spatiaux, probablement à la suite de semble établi depuis 1920 par plusieurs la lecture du livre de Jules Verne « De le terre à théoriciens, René Lorin et Robert Esnault- Pelterie (voir plus loin) en France, Robert la Lune », plusieurs jeunes Allemands se Hutchings Goddard (1882-1945) aux Etats-Unis, réunissent dans un club à la tête duquel se Constantin Tsiolkovski (1857-1935) en Russie. trouve un professeur de gymnastique de 33 Mais il n’existe encore aucune réalisation ans, Hermann Oberth (1894-1989). Fondé le 5 pratique d’un obus autopropulsé, d’un moteur juillet 1927 à Standort von Breslau près de Berlin, ce club est une « société pour les fusée à réaction et encore moins d’un missile. -

Le Blockhaus D'eperlecques
Le Blockhaus d'Eperlecques C e bunker n'est pas un site de lancement de bombes volantes V1 mais une usine de fabrication d'oxygène liquide pour les fusées A4 plus connues sous l'appellation V2 (Vergeltungswaffe 2). Il devait également servir pour leur stockage et leur lancement. On peut également y voir une rampe de lancement V1 avec sa bombe en phase de décollage. Ainsi, le visiteur pourra prendre la juste mesure de la folie meurtrière du IIIème REICH. Dans mes projets, il n'était pas dans mon intention de parler des fusées A4 mais uniquement de tout ce qui touche de près à Jean MARIDOR, c'est à dire les V1. Aussi, et vu la présence d'une rampe de lancement de V1 sur ce site et notamment la structure colossale mise en place par les nazis pour anéantir l'Angleterre, j'ai pensé qu'il serait utile pour le devoir de mémoire de consacrer une page à cette construction hors norme qui, au bout du compte, n'a heureusement jamais servie de base de lancement. S itué dans le département du Pas-de Calais, le blockhaus a été construit à la lisière de la forêt d'Eperlecques. Il a été choisi par l'Oberstleutnant THOM. La décision a été prise suite à un ordre de HITLER à la réunion du 22 décembre 1942 à 11h45, au Ministère de l'Armement à Berlin, entre le Ministre Albert SPEER et le général Walter DORNBERGER. Ce dernier préférait cependant des installations de tirs légères et mobiles aux bunkers à partir desquels peu de tirs pouvaient être effectués en cas de supériorité aérienne de l'ennemi. -
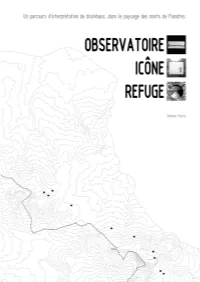
5F7f3c09dd66b-D21752.Pdf
Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’architecte. OBSERVATOIRE, ICÔNE, REFUGE Un parcours d’interprétation de blockhaus, dans le paysage des monts de Flandres. Étudiant : Romain Hoste Promoteur : Mr Henry Pouillon Lecteur : Mr Vincent Bassez Année académique 2012-2013 UCL LOCI site de Tournai-chaussée de Tournai, 7, B-7520 Ramegnies-Chin Tél : 0032(0)69.25.03.32 1 2 Fig. 01 _ Le mont du Ravensberg depuis la route du mont Noir. (P.A.) 3 Fig. 02 _ L’antenne du mont des Cats vu du mont de Boeschepe. (P.A.) 4 Fig. 03 _ L’antenne du mont des Cats vu du mont des Cats. (P.A.) 5 Fig. 04 _ l’Abbaye du mont des Cats vu du pied Est du mont des Cats. (P.A.) 6 PREFACE Dans la région Nord de la France se trouve un petit village, Boeschepe, lieu dont je suis originaire. Jusqu’au début de mes études, j’ai toujours habité une petite maison flamande située au sommet du mont de ce village. De cette position privilégiée dans la région, nous pouvons admirer les magnifiques panoramas de la Flandre Maritime, la vallée de la Lys et le bassin minier. Le mont de Boeschepe représente l’un des maillons de la chaîne des monts de Flandre, véritable muraille naturelle dans le territoire. Tout petit, je jouais dans ce qui me semblait être d’imposantes cabanes, non pas en bois mais en béton, les blockhaus. Je connaissais l’existence de plusieurs bunkers implantés sur ces différents monts, mais j’ignorais qu’ils avaient en réalité tous un lien, celui de faire partie de la ligne Maginot. -

Dictionnaire Biographique Des Déportés De France Passés Par Le Camp De Mittelbau-Dora Et Kommandos
Dictionnaire biographique des déportés de France passés par le camp de Mittelbau-Dora et Kommandos Un projet relancé à La Coupole L’engagement mémoriel pris, en 1998, auprès des associations de survivants de Dora 1, d’aboutir à la réalisation d’un Dictionnaire biographique des déportés de France à Dora et dans ses Kommandos, est en voie d’aboutir. Le programme de recherche de grande ampleur, lancé en 2004 et confié à Laurent Thiery, chercheur issu du groupe de la FMD de Caen est relancé depuis mars 2013 à la suite de deux événements : le recrutement de Laurent Thiery par La Coupole, comme historien chargé de diriger le projet de Dictionnaire et la signature, en octobre 2013, d’une convention de partenariat avec le Mémorial de Mittelbau-Dora à Nordhausen. La Coupole, immense bunker construit par l’Organisation Todt entre 1943 et 1944 pour devenir un site de tir des fusées V2 sur l’Angleterre, devenu le Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais, conserve aujourd’hui la mémoire des déportés de Dora. Le Centre de ressources et de documentation « Jacques Brun » ouvert rassemble les archives de l’ancienne Amicale des Déportés de Dora-Ellrich ainsi que celles d’André Sellier, de Jean Mialet, Lucien Fayman et Jacques Brun. En outre, les recherches menées dans les différents centres d’archives d’Europe depuis 2004 ont permis de terminer le recensement de près de 9 000 déportés de France passés par le camp et ses Kommandos. Depuis 2014, un groupe de rédaction des notices a été mis en place. -

CR ACIT La Coupole 2018
Affluence réduite ( 14 ) pour cette journée du samedi 7 Avril 2018 dans les environs de Saint - OMER. Au programme le matin, le centre d’ H istoire et de M émoire d’Helfaut - Wizernes , dit « La Coupole ». L’ensemble a été aménagé en 1997 après avoir été laissé à l’abandon depuis 1945. Le concept a élargi son thème originel aux actes de résistance dans la région et à la conquête spatiale ( dont la mise au point du V2 est réellement le point de départ ) . Tout le monde était à l’heure et c’est Angeline qui nous a gu id és pour 2 bonnes heures de visite. Le site est surtout caractérisé de l’extérieur par un dôme de béton très armé ( 5m d’épaisseur et 50 % de ferraillage!) affleurant au sommet du plateau. En pénétrant dans la falaise, on va découvrir les nombreux tunnels et la salle principale sous le dôme. Au cours des explications, les sites d’ Eperlecques , de Peenemünde , de Dora - Mittelbau et de Nordhausen seront aussi évoqués pour comprendre le rôle de ce tte impressionnante coupole dans l’ensemble du processus . « Corbeaux » devenus apparents après le seul bombardement réussi Dôme Entrée du tunnel IDA dans l’axe de la voie ferrée d’arrivée des V2 , Voie jamais construite Voyons d’abord le contexte : Nous sommes en septembre 1943. Luttant depuis 1941 sur plusieurs fronts, l e conflit de la 2 ème guerre mondiale est déjà très mal engagé côté allemand. L’Afri k a K orps a capitulé en Afrique du Nord, Les A lliés ont débarqué en Italie et le rég ime de Mussolini s’est effondré. -

Bunker Killer
Bunker Killer Tallboy (Bombe) (aus Wikipedia) 07_126/Tallboy-Bombe Die Tallboy-Bombe (engl. "grosser Junge") war eine Fliegerbombe der Royal Air Force (RAF) und wurde von dem britischen Ingenieur Barnes Wallis entwickelt. Sie war eine bunkerbrechende Waffe. Die offizielle Bezeichnung lautete D.P.12000 lb (Deep Penetration, 12.000 Pfund). Mit einem Gewicht von 5,4 Tonnen, davon 2,4 t hochbrisanter Sprengstoff, sowie einem Verzögerungs- bzw. Langzeitzünder war sie speziell für den Einsatz gegen stark befestigte Betonbauten und Bunker konzipiert worden, gegen die sich kleinere Bomben als unzureichend erwiesen hatten. Ab Frühjahr 1944 wurden insgesamt 854 Bomben an die Verbände der RAF ausgeliefert. Im November 1944 brachten mehrere Tallboys das deutsche Schlachtschiff Tirpitz zum Kentern. Geschichte Im Bewusstsein, dass der Feind durch Zerstörung seiner Infrastruktur und Fertigungsstätten empfindlich geschwächt werden würde, entwickelte Barnes Wallis bereits zu Beginn des Zweiten Weltkriegs fortschrittliche Bombentypen auf Basis einzelner überschwerer Bomben. Schon vor dem Krieg hatte er die Idee einer Zehn-Tonnen-Bombe, die nach dem "Erdbebenprinzip" arbeitete, in seiner Studie A Note on a Method of Attacking the Axis Powers (etwa "Notiz über eine Möglichkeit, die Achsenmächte anzugreifen") vorgestellt. Seine Berechnungen zeigten, dass eine sehr grosse Bombe, die in der Nähe eines Ziels detoniert, eher ein "camouflet", eine unterirdische, durch eine Explosion verursachte Höhlung statt eines Kraters verursachen würde. Dadurch würde fast die gesamte Energie der Explosion vom Erdboden aufgenommen, und über die Fundamente würde ein deutlich höherer Anteil der Explosionsenergie als Schockwelle auf das Ziel einwirken als bei Explosionen an der Oberfläche, bei denen ein Grossteil des Explosionsdruckes in die Atmosphäre entweicht und (mehr oder weniger wirkungslos) verpufft. -

Flying Officer David Elwyn Walters Royal Air Force Volunteer Reserve
Flying Officer David Elwyn Walters Royal Air Force Volunteer Reserve 1940-46 Preface This is an attempt to tell as much as possible of the story of my father’s service in the Royal Air Force between 1940 when he enlisted and the date of his discharge after the Second World War in 1946; his journey through the ranks from enlisted man to commissioned officer and from “Blighty” to Africa, the Middle and Far East and back again. While it tries to tell of a more memorable time in his life, rather than the story of his whole life, it’s fair to say that the period of his service during the war and after was probably the most important part. Many of the details of everyday life are now forgotten, gone to the grave with those who lived through those momentous events but some of the tales are retold here, albeit with some minor unintentional changes, omissions or even additions; that all depends upon my own memory and how much of the stories my father chose to remember and some of the letters that were somehow saved. He was just an ordinary bloke from an ordinary background who found himself taking part in some of the most extraordinary times in history. He didn’t do anything to mark him out from the rest, just an ordinary bloke doing what had to be done as his part to end the madness of war and he survived. If I have to dedicate this small work to anyone then obviously it has to be first to my father and mother and then to the 125,000 other ordinary blokes, brave men every last one who answered the call and nightly flew against the Nazi evil as “The Bomber Boys”; the men of RAF Bomber Command and the 55,573 who failed to return. -

AN ICONIC JOURNEY of REMEMBRANCE Save $2,000 Per
The 75th Anniversary of D-Day AN ICONIC JOURNEY OF REMEMBRANCE Amsterdam to Dover | Aboard the All-New Seabourn Ovation MAY 29 – JUNE 7, 2019 Save $2,000 per couple when booked by March 30, 2019 See page 7 for details. Ovation Seabourn Dear Guests, I hope you are as excited as I am about our upcoming cruise commemorating the 75th Anniversary of D-Day. You will be traveling with us on an unforgettable journey STAND WHERE HISTORY WAS MADE visiting both iconic and relatively unknown WWII sites alongside WWII veterans and some of the world’s most accomplished historians. Over the past several months, our team has been meeting with port city officials, working diligently to finalize all logistics. We are focused on ensuring that you receive privileged access to incredible tour sites and special invitations to once-in-a-lifetime events. Stephen J. Watson President & CEO, Three types of excursions have been designed for each port, ensuring that this The National WWII Museum signature cruise program is meaningful for both first-timer travelers to Europe and those who have previously visited this part of world. • Flagship Military Excursions incorporate elements of our classic Normandy tours with visits to the most iconic historical sites. • Curator’s Collection Excursions go “off the beaten path,” offering guests a deeper dive into the war and the lesser-known sites near our ports. • Cultural Excursions offer memorable experiences focused on the local heritage of the area. Multiple options at each port allow you to custom-design your itinerary. You may wish to choose a Flagship Excursion in one port, a Cultural Excursion in another, and HEAR THEIR STORIES LEARN THEIR NAMES explore a specific aspect of the war on a Curator's Collection Excursion at the next port.