Wortprotokoll (PDF, 180KB, Nicht Barrierefrei)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ohne Knautschzone
Deutschland Ohne Knautschzone Innere Sicherheit Nach dem Rauswurf von BND-Präsident Gerhard Schindler wachsen die Zweifel, ob die Regierung wirklich eine grundlegende Reform des affärengeplagten Geheimdienstes will. urz vor seinem Rauswurf spottete Gerhard Schindler über den Seifen - Kspender auf einer BND-Toilette. Es war vor drei Wochen, Schindler stand im Kaminzimmer seiner Präsidentenvilla in Pullach und plauderte gewohnt jovial mit einer Gruppe Journalisten. Drei Jahre lang sei ihm oben im ersten Stock regelmäßig der Seifenspender aus der Wand in die Hand gefallen – erst seit einem Monat sei das Ding endlich repariert. Man sehe es ja selbst, scherzte der Chef, hier, vor den To - ren Münchens, entfalte der Bundesnach - richtendienst (BND) einen gewissen „mor - biden Charme“. Alles ein bisschen vorgest - rig. Man müsste mal durchlüften. Schindler hätte sich noch mehr zuge - traut als sanitäre Reparaturen. Doch die großen Aufgaben in seiner Behörde soll nun ein anderer bewältigen. In zwei Mo - naten wird Schindler Expräsident sein. Am Mittwoch gab Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) überraschend Schindlers Abberufung zum 1. Juli be - kannt. Noch überraschender war aller - dings, dass ihm mit Bruno Kahl ein Mann nachfolgen soll, der im Finanzministerium die Privatisierungsabteilung leitet und mit Geheimdiensten bislang nur am Rande zu tun hatte. Für die Nachfolge des 63-jähri - gen Schindler hatten zuletzt mehrere Na - men kursiert. Kahl wurde nie genannt. Altmaier mühte sich, den Wechsel als „wohlgeordnetes Verfahren“ darzustellen. Tatsächlich aber wurde hinter den Kulissen seit Monaten um die Personalie gerungen – und damit auch um die Zukunft des BND. L Drei Jahre nach Beginn der NSA-Affäre E I H T geht es nun um die Frage, ob die Regierung N A I T ernsthafte Konsequenzen aus dem Abhör - S I R H skandal ziehen und ihre Geheimdienste C an die kürzere Leine nehmen will. -

Das Gedankenexperiment
G. O. Mueller Über die absolute Größe der Speziellen Relativitätstheorie Textversion 1.2 - 2004 Ergänzung 2009: Kapitel 9 Das Gedankenexperiment Mai 2009 Kap. 9: Gedankenexperiment Copyright 2009 The Author Schlußredaktion für Kapitel 9: 16. Mai 2009 G. O. Mueller: SRT-Kap.9 2 Textversion 1.2 - 2009 Kap. 9: Gedankenexperiment Inhalt des Kapitels 9 Der Traditionsbruch von 1922 Was will uns der Dichter damit sagen?/ 32 erstmals im Jahr 2001 aufgedeckt / 5 Die bisherigen Ergebnisse unseres Nur neue Wege werden das Zensurkartell Gedankenexperiments / 33 aufbrechen / 6 Die Reaktionen in der Offline-Welt / 33 Der erste neue Weg: die Dokumentation / 6 Die Beurteilung der Reaktionen Der Falle einer Verlagsveröffentlichung in der Offline-Welt / 35 ausweichen /7 Die Gruppe der Bibliotheken / 37 Die Katastrophe der Bildungsunfähigkeit / 7 Die Reaktionen in der Online-Welt / 38 Das Gedankenexperiment / 8 Im Internet werden auch Das Grundrecht der die Anhänger der Theorie Wissenschaftsfreiheit / 9 über die Kritik informiert / 39 Der Grundgesetzkommentar zur Offline-Welt und Online-Welt / 41 Wissenschaftsfreiheit / 11 Ein Mengengerüst über die Betroffenen Das Schweigen der Adressaten / 43 der Relativitäts-Katastrophe / 12 Kein Adressat wagt Protest, Entgegnung Eine Ehrenrettung und optimistische oder Widerlegung / 45 Perspektive / 14 Bilanz und Ergebnis des Vergleichs mit Offene Briefe gegen die anderen landesüblichen Große Deutsche Ausrede/ 15 Skandalen / 46 Die internationale Ebene / 16 Einzelbriefe, gleichlautende Anschreiben, Die Versorgung der Bibliotheken “Offene Briefe” und und die Zensur/ 17 Nachfragen / 47 Die Partner unseres Projekts und die Die Autorisierung unserer Partner / 47 Freiheit des Internets / 18 Ordnung, Inhalte und Erschließung Die 12 neuen Wege unseres Forschungs- der Vertriebsliste / 48 projekts und ihre Ergebnisse / 20 Vertriebsliste / 49-192 Vergleich der Relativitäts-Katastrophe mit anderen landesüblichen Skandalen / 21 Das Gedankenexperiment 1. -

Literaturverzeichnis a Primärquellen 1
Literaturverzeichnis A Primärquellen 1. 16 teilstrukturierte Leitfadeninterviews 2. Drucksachen des Deutschen Bundestags und seiner Ausschüsse BT-ADrs. 16(4)624 (2009): Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP im 4. Ausschuss (Innenausschuss) des Deutschen Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nach- richtendienste des Bundes (BT-Drucksache 16/12411). Deutscher Bundestag - Parlamentsarchiv. Berlin (PA-DBT 4000 XVI/337 Band 1 lfd. Nr. 041.02). BT-Drs. 05/4208 (1969): Schriftlicher Bericht des 2. Untersuchungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersu- chungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes (Drucksache 5/3442). Bericht des Abgeordneten Hirsch. Deutscher Bundestag. Bonn. BT-Drs. 05/4445 (1969): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes. (An- trag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP). Deutscher Bundestag. Bonn. BT-Drs. 06/3829 (1972): Zwischenbericht der Enquete-Kommission für Fragen der Ver- fassungsreform gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages. Deutscher Bundes- tag. Bonn. BT-Drs. 07/3083 (1974): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht, den die Kommission ‚Vorbeugender Geheimschutz‘ über die Prüfung von Sicherheitsfra- gen im Zusammenhang mit dem Fall Guillaume im November 1974 der Bundes- regierung erstattet hat. Auszug aus dem 2. Teil des Berichts der so genannten Mercker-Kommission vom 24. Juli 1969, der sich mit der Lage des Bundesnach- richtendienstes vor dem Jahre 1969 befaßt. Deutscher Bundestag. Bonn. BT-Drs. 07/5924 (1976): Schlußbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform. ge- mäß Beschluß des Deutschen Bundestages - Drucksache 07/214 (neu). Deutscher Bundestag. Bonn. BT-Drs. 08/1140 (1977): Entwurf eines Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste. Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP. -

Commerce Germany July 2015 Connected Cars Broaden Your Horizon
commerce germany OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN GERMANY July 2015 • VOL 13 • ISSUE 3 €7.70 Digitization – New Opportunities 112th Annual Membership Meeting Cover Story: Automotive – Talking Cars Investment Region: Saarland Access Your Global Network: Argentina Special Feature: US-German Internship Program Innovation and design. Leading the way to the future of mobility. Awards for fascinating design, exemplary safety concepts, and outstanding comfort keep confirming our role as a pioneering automotive company. With strong brands, innovative vehicles and intelligent mobility concepts, we are shaping the future of mobility. www.daimler.com amcham germany viewpoint Mobility 4.0 – A New Era of Automobiles We are experiencing a unique phase of innovation: Digitization is changing the faces of economy and society in a disruptive process. Following the media, trade, services and industry sectors, mobility is now the new big field for innovation. And we are not just talking about an evolution or revolution of the automobile, but rather the recreation of the car as a system. The car of the future will be a fully digitized and highly complex © Bundesregierung/Kugler platform for mobility, information and communication. It will turn into the “third place” – in Alexander Dobrindt addition to the home and the office – and become another center of life and work. Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure A precondition for this is automated and connected driving. This innovation is the starting point of a true efficiency revolution and offers enormous potential for growth and prosperity. I want us to tap into this potential to enable Mobility 4.0 on behalf of the government. -

Rede Von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble in Der Aussprache Zur Regierungserklärung Der Bundeskanzlerin
Berlin - Do 01. Dez 05 Rede von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble in der Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Plenarprotokoll 16/4 der 4. Sitzung des Deutschen Bundestages am 30. November 2005 Der Präsident erteilt das Wort dem Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Wolfgang Schäuble. Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Entführung von Susanne Osthoff, die heute Morgen von der Frau Bundeskanzlerin und allen Fraktionsvorsitzenden bereits in angemessener Weise angesprochen worden ist, hat uns in Erinnerung gerufen, dass die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus uns alle betrifft. Ich glaube nicht, dass dies eine neue Bedrohungslage ist. Ich glaube, es ist vielleicht nur eine neue Wahrnehmung, die klar macht, dass wir alles tun müssen, um den Gefahren zu wehren. Wir haben immer gesagt – das gilt auch heute –: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das möchte ich gerne am Anfang meiner Amtszeit sagen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht das menschenmögliche Maß an Sicherheit gewährleisten wollen. Wir haben miteinander verabredet, dass wir uns damit alle Mühe geben, und dem sind wir – vermutlich über alle Fraktionsgrenzen hinweg – verpflichtet. (Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie der Abg. Silke Stokar von Neuforn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) Im Einzelfall wird es immer schwierige Abwägungssituationen geben; darüber haben wir gesprochen. Es muss auch klar sein, dass wir nicht nur die Sicherheit unseres Landes und unserer Bürger und Bürgerinnen verteidigen, sondern auch die Sicherheit der Gewährleistung unserer freiheitlichen, rechtsstaatlichen und demokratischen Verfassung. Das ist kein Gegensatz. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD) Vielmehr bedingt das eine das andere: Es gibt keine Sicherheit ohne Freiheitsrechte und keine Freiheitsrechte ohne Sicherheit. -

Islamist Terrorism in Germany: Threats, Responses, and the Need for a Strategy
66 AICGSPOLICYREPORT ISLAMIST TERRORISM IN GERMANY: THREATS, RESPONSES, AND THE NEED FOR A STRATEGY Guido Steinberg AMERICAN INSTITUTE FOR CONTEMPORARY GERMAN STUDIES THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY TABLE OF CONTENTS Foreword 3 About the Author 5 The American Institute for Contemporary German Studies strengthens the German-American rela- tionship in an evolving Europe and changing world. Executive Summary 7 The Institute produces objective and original analyses of developments and trends in Germany, Europe, and the United States; creates new Introduction 9 transatlantic networks; and facilitates dialogue among the business, political, and academic communities to manage differences and define and Nature and Scope of Threat 11 promote common interests. ©2017 by the American Institute for Contemporary German Studies Government Responses 18 ISBN 978-1-933942-61-2 Domestic Security and the United States 22 ADDITIONAL COPIES: Additional Copies of this Policy Report are available for $10.00 to cover postage and handling from Elements of a Strategy 25 the American Institute for Contemporary German Studies, 1755 Massachusetts Avenue, NW, Suite 700, Washington, DC 20036. Tel: 202/332-9312, Notes 28 Fax 202/265-9531, E-mail: [email protected] Please consult our website for a list of online publications: http://www.aicgs.org The views expressed in this publication are those of the author(s) alone. They do not necessarily reflect the views of the American Institute for Contemporary German Studies. Support for this publication was generously provided by ISLAMIST TERRORISM IN GERMANY FOREWORD One year after Germany’s largest jihadist terrorist attack, and only two years after Angela Merkel’s deci- sion to open the country’s borders to nearly a million refugees and asylum-seekers, German policymakers are still struggling with how to maintain security and privacy within a federal system. -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 152. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 28.Januar 2016 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2 Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte - Drucksachen 18/7207 und 18/7367 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 572 Nicht abgegebene Stimmen: 58 Ja-Stimmen: 442 Nein-Stimmen: 82 Enthaltungen: 48 Ungültige: 0 Berlin, den 28.01.2016 Beginn: 14:01 Ende: 14:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Iris Eberl X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. -
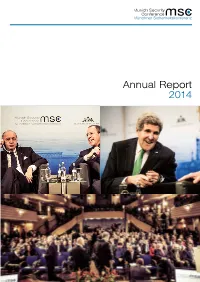
Annual Report 2014
Annual Report 2014 1 THE MUNICH SECURITY CONFERENCE 2 Table of contents The Advisory Council of the Munich Security Confeence 5 1. MSC Events & Activities in 2014 Munich Security Conference 2014 ............................ 6 Energy Security Summit ...................................... 8 Cyber Security Summit. 10 Core Group Meeting ........................................12 2. MSC Foundation: Developments in 2014 Our Organization ...........................................14 Changes & Improvements ...................................15 Financial Review ...........................................16 Global Ranking of Think-Tank Conferences ....................17 4. The Year Ahead .........................................18 3 THE MUNICH SECURITY CONFERENCE The Advisory Council of the Munich Security Conference Chairman of the Munich Security Conference Wolfgang Ischinger Chairman of the Advisory Council Dr Wolfgang Büchele Members of the Advisory Council Dr Paul Achleitner Prince Turki Al Faisal bin Carl Bildt Dr Nikolaus von Bomhard Abdulaziz Al Saud Michael Diekmann Dr Thomas Enders Herman O. Gref Jane Harman Frank Haun Anne Lauvergeon Dr Javier Solana James G. Stavridis Dr Dr h.c. Edmund Stoiber 5 THE MUNICH SECURITY CONFERENCE MSC Events & Activities in 2014 Munich Security Conference 2014 Key facts: Twenty heads of state and almost fifty foreign and defense ministers participated in the 50th anniversary of the Munich Security Conference Landmark speeches by German President Joachim Gauck, Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, and Defense Minister Ursula von der Leyen were widely perceived to usher in a new German foreign policy doctrine emphasizing increased engagement abroad Media coverage included 2000 news articles, 2000 news broadcasts, 14 million Google searches, and 22000 tweets for an estimated combined reach of 1.8 billion individuals Description: Key stakeholders of the security and foreign affairs papers and academic publications during and after community gathered in Munich to debate the most the conference. -

Parlamentsmaterialien Beim DIP (PDF, 40KB
DIP21 Extrakt Deutscher Bundestag Diese Seite ist ein Auszug aus DIP, dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge , das vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam betrieben wird. Mit DIP können Sie umfassende Recherchen zu den parlamentarischen Beratungen in beiden Häusern durchführen (ggf. oben klicken). Basisinformationen über den Vorgang [ID: 17-41716] 17. Wahlperiode Vorgangstyp: Gesetzgebung Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Rechtsextremismus Initiative: Bundesregierung Aktueller Stand: Verkündet Archivsignatur: XVII/304 GESTA-Ordnungsnummer: B064 Zustimmungsbedürftigkeit: Nein , laut Gesetzentwurf (Drs 31/12 (bes.eilbed.)) Nein , laut Verkündung (BGBl I) Wichtige Drucksachen: BR-Drs 31/12 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/8672 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/10155 (Beschlussempfehlung und Bericht) Plenum: 1. Durchgang: BR-PlPr 893 , S. 86A - 89C 1. Beratung: BT-PlPr 17/162 , S. 19204A - 19223A 2. Beratung: BT-PlPr 17/187 , S. 22394C - 22403C 3. Beratung: BT-PlPr 17/187 , S. 22403C 2. Durchgang: BR-PlPr 899 , S. 352C - 352D Verkündung: Gesetz vom 20.08.2012 - Bundesgesetzblatt Teil I 2012 Nr. 39 30.08.2012 S. 1798 Inkrafttreten: 31.08.2012 (weiteres siehe im BGBl I) Sachgebiete: Innere Sicherheit Inhalt Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Polizei und Nachrichtendiensten durch Errichtung einer gemeinsamen Datei betr. gewaltbezogenen Rechtsextremismus unter Verzicht auf Erweiterung der bestehenden Antiterrordatei: beteiligte Behörden, Speicherung, Nutzung und Schutz der Daten, bis zum 31. Januar 2016 befristete erweiterte Datennutzung für eng umgrenzte Projekte; Erweiterung der Möglichkeit zur Führung einer Volldatei im Verfassungsschutzverbund; Einschränkung von Grundrechten betr. Brief-, Post und Fernmeldegeheimnis sowie Unverletzlichkeit der Wohnung; Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Datei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern zur Bekämpfung des gewaltbezogenen Rechtsextremismus (Rechtsextremismus-Datei-Gesetz – RED-G) als Art. -

Aloys Berg, Universitätsklinikum Freiburg / Peb. Ev Berlin
® Multizentrisch Organisierte Bewegungsorientierte Initiative zur Lebensstiländerung in Selbstverantwortung Aloys Berg, Universitätsklinikum Freiburg / peb. e.V. Berlin © M.O.B.I.L.I.S. M.O.B.I.L.I.S.-Steckbrief nicht kommerziell zentral koordiniert und organisiert Kursgebühr zu großen Teilen erstattbar bewegungsorientiert kontinuierlich evaluiert qualitätsgesichert © M.O.B.I.L.I.S. M.O.B.I.L.I.S.-Organisationsstruktur Organisationsform: gemeinnütziger Verein (M.O.B.I.L.I.S. e.V.) Gesamtorganisation/Verwaltung: M.O.B.I.L.I.S.-Zentrale (Sitz: Freiburg) Aufgaben der M.O.B.I.L.I.S.-Zentrale: Teilnehmerakquisition und -verwaltung für alle Gruppen Ansprechpartner für Trainer/Ärzte Honorierung der Teams Überwachung der geforderten Standards zentrales Beschwerdemanagement M.O.B.I.L.I.S. e.V. (gegründet am 05.03.2007) Vorstand: Prof. Dr. med. Aloys Berg (1. Vorstand) und Prof. Dr. troph. Michael Hamm (2. Vorstand) / Geschäftsführung: Andreas Berg M.A Vereinssitz: Freiburg im Breisgau / Vereinsnummer: VR 700124, Registergericht Freiburg vom 02.05.2007 / Institutionskennzechen (IK): 590832803 © M.O.B.I.L.I.S. Steuernummer: 06470/08819 / Freistellungsbescheid zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für das Jahr 2007 mit Datum vom 03.12.2008 (gültig bis 31.12.2012) Standorte Bredstedt Damp Sankt Peter-Ording Schleswig Eutin/ Neustadt Elmshorn Rostock seit Start 2004: HH-Fuhlsbüttel Lübeck Schortens Schwerin HH-St. Georg HH-Bergedorf 839 geschulte Trainer/Ärzte Westerstede Lüneburg Oldenburg 4.387 Teilnehmer Bremen Lingen Lohne Osnabrück Melle/ -

Die CDU/CSU-Fraktion Stellt Sich Auf Für Die 18
7 | 17. Januar 2014 Zur Lage Verlässlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg der Koalition Fraktionswahlen waren Zeichen der Geschlossenheit Öffentlichkeit. Letztlich wird die Fraktion die Bürger von unserer Arbeit aber nur überzeugen, wenn sie in ihrer gan- zen Vielfalt gute Arbeit macht. Da kommt es auf jeden Ab- geordneten an. Und ich bin überzeugt, dass alle Abgeordne- ten an einem Strang ziehen werden, um gute Politik für un- ser Land zu machen. Die große Koalition ist mit dem Jahreswechsel ans Werk gegangen. Es gibt viele neue Minister, aber auch neue Zu- ständigkeiten. Ministerien organisieren sich zum größten Teil neu. Wichtig für die Union ist, dass die Kanzlerin an der Stelle geblieben ist, an der sie auch in den vergangenen Jahren war. Sie ist der Garant dafür, dass es auch in den nächsten Jahren gut laufen wird. Kleinere Handicaps fallen Foto: Martin Lengemann Foto: da nicht ins Gewicht. Volker Kauder Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion „Nur im Miteinander werden wir Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kann nun mit der eigent- erfolgreich sein.“ lichen Arbeit in der neuen Wahlperiode beginnen. In dieser Woche haben wir den Hauptteil der Fraktionsämter neu be- setzt und die Vorsitzenden der Ausschüsse gewählt. In einigen Punkten haben die neuen Koalitionspartner in den ersten Tagen des neuen Jahres noch nicht genügend Dabei ist es auch in dieser Wahlperiode gelungen, eine mit einer Stimme gesprochen. Dabei ist eines klar: Nur im gute Mischung zusammenzustellen – aus neuen und schon Miteinander werden Union und SPD am Ende erfolgreich bekannten Gesichtern, aus Frauen und Männern, aus Jün- sein. Die Wähler wollen keine Profilierungssucht, die Wäh- geren und Erfahreneren. -

Antrag Der Abgeordneten Wolfgang Bosbach, Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 15/31 15. Wahlperiode 05. 11. 2002 Antrag der Abgeordneten Wolfgang Bosbach, Dr. Norbert Röttgen, Günter Baumann, Clemens Binninger, Hartmut Büttner (Schönebeck), Dr. Jürgen Gehb, Norbert Geis, Roland Gewalt, Ralf Göbel, Dr. Wolfgang Götzer, Ute Granold, Reinhard Grindel, Michael Grosse-Brömer, Siegfried Helias, Martin Hohmann, Siegfried Kauder (Bad Dürrheim), Volker Kauder, Hartmut Koschyk, Dr. Günter Krings, Dorothee Mantel, Erwin Marschewski (Recklinghausen), Stephan Mayer (Altötting), Beatrix Philipp, Daniela Raab, Andreas Schmidt (Mülheim), Dr. Ole Schröder, Thomas Strobl (Heilbronn), Andrea Voßhoff, Marco Wanderwitz, Ingo Wellenreuther, Wolfgang Zeitlmann und der Fraktion der CDU/CSU Sozialtherapeutische Maßnahmen für Sexualstraftäter auf den Prüfstand stellen Der Bundestag wolle beschließen: 1. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Durch das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefähr- lichen Straftaten vom 26. Januar 1998 (BGBl I. S. 160) ist § 9 Strafvollzugs- gesetz (StVollzG) neu gefasst worden. Nach der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung soll ein Gefangener in eine sozialtherapeutische Anstalt ver- legt werden, wenn er wegen einer Straftat nach den §§ 171 bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches zu zeitiger Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verur- teilt worden ist und die Behandlung in einer sozialtherapeutischen Anstalt nach § 6 Abs. 2 Satz 2 oder § 7 Abs. 4 angezeigt ist (§ 199 Abs. 2 StVollzG). Gemäß der ab 1. Januar 2003 geltenden Fassung „ist“ der Gefangene dann zu verlegen. Die für den Vollzug des StVollzG zuständigen Länder haben seit Inkrafttreten des Gesetzes erhebliche finanzielle und personelle Anstrengungen unternom- men, entsprechende Haftplätze zur Verfügung zu stellen. Nach einer in den Jah- ren 1997 bis 2002 jährlich (Stichtag jeweils 31.