Bosco Gurin – Das Walserdorf Im Tessin Und Seine Sprache(N)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Scenario Aggregativo
1 Scheda Alta Vallemaggia Piano cantonale delle aggregazioni scheda 15 Scenario aggregativo Alta Vallemaggia Situazione attuale 6 comuni Alta Vallemaggia 5 Scheda 2 Scheda 3 4 1 6 3 2 Comuni Spazio funzionale 1 Bosco Gurin montagna montagna 2 Campo Vallemaggia 3 Cerentino montagna 4 Cevio montagna 5 Lavizzara montagna 6 Linescio montagna Indicatori d’insieme Demografia Territorio Occupazione Finanze Popolazione Variazione Superficie Addetti totali Risorse fiscali Ris. fiscali pc MP medio residente dal 2000 in ettari 2015 pro-capite 2014 post CL ponderato 2016 TI = +14% 2014 ante CL TI = 4’011 TI = 80 1’953 -9% 43’091 999 2’494 2’929 90 2 Scheda Alta Vallemaggia Piano cantonale delle aggregazioni scheda 15 Dati statistici Alta Vallemaggia Dati socio-economici e territoriali Demografia Territorio Occupazione Popolazione 2016 Variazione dal 2000 Superficie Posti di lavoro 2015 (TI +14%) (in ettari) Bosco Gurin 55 -36% 2’204 57 Campo Vallemaggia 56 -3% 4’327 35 Cerentino 51 -16% 2’007 27 Cevio 1’177 -11% 15’142 635 Lavizzara 569 -4% 18’750 232 Linescio 45 +5% 661 13 Alta Vallemaggia 1’953 -9% 43’091 999 Dati finanziari ) 2014 4’011 = capite capite 2014 - - 100) 2018 - contributo di = Contributo di 2017 livellamento versato Contributo di 2017 livellamento ricevuto ndice di forza finanziaria I 2017 (TI Moltiplicatore politico 2017 (TI = 80) Risorse pro Ante contributo di livellamento Risorse pro Post livellamento (TI IFF MP RF-ante RF-post CL pagante CL beneficiario Bosco Gurin 57 100 3’292 3’377 4’945 Campo Vallemaggia 70 90 4’795 4’944 -

Springer Series in Statistics
Springer Series in Statistics Advisors: P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg, U. Gather, I. Olkin, S. Zeger Springer Series in Statistics Alho/Spencer: Statistical Demography and Forecasting. Andersen/Borgan/Gill/Keiding: Statistical Models Based on Counting Processes. Atkinson/Riani: Robust Diagnostic Regression Analysis. Atkinson/Riani/Cerioli: Exploring Multivariate Data with the Forward Search. Berger: Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd edition. Borg/Groenen: Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, 2nd edition. Brockwell/Davis: Time Series: Theory and Methods, 2nd edition. Bucklew: Introduction to Rare Event Simulation. Cappé/Moulines/Rydén: Inference in Hidden Markov Models. Chan/Tong: Chaos: A Statistical Perspective. Chen/Shao/Ibrahim: Monte Carlo Methods in Bayesian Computation. Coles: An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. David/Edwards: Annotated Readings in the History of Statistics. Devroye/Lugosi: Combinatorial Methods in Density Estimation. Efromovich: Nonparametric Curve Estimation: Methods, Theory, and Applications. Eggermont/LaRiccia: Maximum Penalized Likelihood Estimation, Volume I: Density Estimation. Fahrmeir/Tutz: Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models, 2nd edition. Fan/Yao: Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Farebrother: Fitting Linear Relationships: A History of the Calculus of Observations 1750-1900. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume I: Two Crops. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume II: Three or More Crops. Ferraty/Vieu: Nonparametric Functional Data Analysis: Models, Theory, Applications, and Implementation Ghosh/Ramamoorthi: Bayesian Nonparametrics. Glaz/Naus/Wallenstein: Scan Statistics. Good: Permutation Tests: Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, 3rd edition. Gouriéroux: ARCH Models and Financial Applications. Gu: Smoothing Spline ANOVA Models. Györfi/Kohler/Krzyz• ak/Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. -

The Development of the Norway Spruce’S Forests in the Swiss Southern Alps
Research Collection Master Thesis On the processes and factors shaping the Norway spruce’s (Picea abies) forests in the Southern Swiss Alps An analytical and modelling approach to understand the effect of climate change and Rhododendrons on the Norway spruce stands Author(s): Guidotti, Andrea Publication Date: 2020 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000438047 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Master’s Thesis in Environmental Sciences On the processes and factors shaping the Norway spruce’s (Picea abies) forests in the Southern Swiss Alps. An analytical and modelling approach to understand the effect of climate change and Rhododendrons on the Norway spruce stands. Author: Andrea Guidotti student ID no. 14-929-095 MSc Environmental sciences ETH Zürich [email protected] Supervisor: Dr. Monika Frehner ETH Zürich [email protected] Co-supervisors: Prof. Dr. Andreas Zischg University of Bern [email protected] Anne Herold Bonardi WSL Cadenazzo [email protected] Submission date: 18.05.2020 0 | 158 Front page picture: the sunrise sheds a light on a group of young Norway spruce trees. I took this picture from Cés, in Val Leventina (Ticino), in the Summer 2019. 1 | 158 “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” Aphorism by Ralph Waldo Emerson 2 | 158 Summary The Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) is one of the most important tree species in the Southern Swiss Alps, especially in the mountain forests which support an essential protective function on the infrastructures and settlements of the inner alpine valleys. -

Annual Report 2017 Annual Report 2017 Azienda Elettrica Ticinese
2017 Annual Report Annual Report 2017 Azienda Elettrica Ticinese Azienda Elettrica Ticinese Annual Report 2017 Report of the Board of Directors of the Azienda Elettrica Ticinese to the Grand Council and the Council of State of the Republic and Canton of Ticino Ladies and Gentlemen, Chairmen, State Councillors, Parliamentary Representatives, in accordance with the provisions contained in article 6 of the Act of the Azienda elettrica ticinese (LAET), we hereby submit for your approval (article 6, paragraph 4 LAET): – the report of the Board of Directors for the year 2017; – the auditors’ report; – the financial statements for the year 2017; – the proposal for allocation of result. The english version of the AET 2017 Annual Report is merely a translation: the official version is the italian text. The Campus Formativo Bodio The images of the 2017 Annual Report illustrate the activi- ties of the Campus Formativo Bodio (CFB): a multi-company training centre for polymechanics and automation techni- cians apprentices, founded by AET and the major industries of the north of Ticino. Opened in spring 2017, the CFB is located in Bodio, next to the Vecchia Biaschina former power plant, the mechanical workshop of AET and the training centre of ESI (Elettricità della Svizzera Italiana). The CFB has a capacity of up to 32 apprentices divided in four apprenticeship years. The apprentices spend the first two education years in the centre and the second two years in one of the CFB’s partner companies. Among them beside AET are: Imerys Graphite&Carbon Switzerland SA, Tenconi SA, Tensol Rail SA and, from September 2018, the Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR). -

First Detection of TBE Virus in Ticks and Sero-Reactivity in Goats in a Non-Endemic Region in the Southern Part of Switzerland (
Ticks and Tick-borne Diseases 10 (2019) 868–874 Contents lists available at ScienceDirect Ticks and Tick-borne Diseases journal homepage: www.elsevier.com/locate/ttbdis Original article First detection of TBE virus in ticks and sero-reactivity in goats in a non- endemic region in the southern part of Switzerland (Canton of Ticino) T ⁎ Simona Casati Pagania, , Simona Frigerio Malossab, Christine Klausc, Donata Hoffmannd, Ottavio Berettaa, Nicola Bomio-Pacciorinie, Mario Lazzaroa, Giorgio Merlania, Rahel Ackermannf, Christian Beuretg a Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del medico cantonale, Via Dogana 16, 6500, Bellinzona, Switzerland b EOC – Dipartimento di medicina di laboratorio, Servizio di microbiologia (SMIC), Via Mirasole 22a, 6500, Bellinzona, Switzerland c Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Bacterial Infections and Zoonoses, Naumburger Str. 96a, 07743, Jena, Germany d Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Diagnostic Virology, Südufer 10, 17493, Greifswald-Insel Riems, Germany e Dipartimento del territorio, Ufficio forestale 4° circondario, Via Antonio Ciseri 13, 6600, Locarno, Switzerland f National Reference Centre for Tick-Transmitted Diseases (NRZK), Labor Spiez, Ausstrasse, 3700, Spiez, Switzerland g Spiez Laboratory, Ausstrasse, 3700, Spiez, Switzerland ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: In Switzerland, tick-borne encephalitis (TBE) is a notifiable human disease with an average of 210 cases per year TBEV in the last 10 years (2008–2017). A national surveillance conducted in 2009 reported a prevalence of 0.46% for Goats tick-borne encephalitis virus (TBEV) detected in ticks, which is in accordance with the prevalences found in Ticks Europe from 0.1%–5%. The Canton of Ticino in the southern part of Switzerland, geographically separated from Ixodes ricinus the rest of the national territory by the Alps, is considered a non-endemic region, as no autochthonous clinical Switzerland cases and no TBEV presence in ticks have ever been reported. -
Legenda Percorso Valle Maggia
w Numeri utili • Nützliche Nummern • Numéros utiles • Useful numbers Cycling routes Ambulanza, emergenze – Sanitätsnotruf, Krankenwagen Ospedale La Carità ascona-locarno.com/bike 144 Ambulance, appel dʼurgence – Ambulance emergency call Pronto Soccorso +41 (0)91 811 41 11 REGA Guardia aerea di soccorso Clinica S. Chiara 1414 Rettungsflugwacht – Garde aérienne de sauvetage – Air-Rescue Pronto Soccorso +41 (0)91 756 41 11 /Including Incluso/Inklusive/Inclus Polizia – Polizei – Police – Police Soccorso stradale – Pannenhilf 117 Poliza cantonale +41 (0)91 816 10 11 140 Dépannage routier – Road assistance orso Polizia comunale Locarno +41 (0)91 756 33 11 Perc Vallemaggia Pompieri – Feuerwehr – Pompiers – Fire Brigade Previsioni meteo – Wetterbericht 118 Centrale Locarno +41 (0)91 756 33 41 162 Météo – Weather forecast Bike Hotels– Relax, sport & divertimento 145 Intossicazione – Vergiftungen – Intoxication – Intoxication Informazioni – Auskünfte 1811 Renseignements – Information your ideal base Erholung, Sport und Spass ascona-locarno.com/bikehotels Détente, sport et loisirs Relaxation, sport & fun Ascona-Locarno Tourism [email protected] Lido Locarno Tel +41 (0) 91 759 90 00 Tel. +41 (0)848 091 091 www.ascona-locarno.com facebook.com/lidolocarno Via Respini 11 [email protected] instagram.com/lidolocarno CH–6601 Locarno www.lidolocarno.ch 20 Proposte di itinerari ciclabili 20 Propositions d'itinéraires cyclables Percorso 1 Percorso 6 Percorso 11 Percorso 16 Locarno – Bignasco Locarno – Forcola di Dunzio Valle Cannobina Locarno – Bellinzona Paesaggi mozzafiato, un clima mite e temperato, itinerari pianeggianti o salite con oltre Des paysages à couper le souffle, un climat doux et tempéré, des itinéraires au plat ou Lunghezza: 31,2 km Dislivello: 351 m Lunghezza: 19,8 km Dislivello: 477 m Lunghezza: 68 km Dislivello: 905 m Lunghezza: 22 km Dislivello: 105 m il 20% di dislivello, 2'300 ore di sole all’anno. -

Swiss Travel System Map 2020
Bernina at Lago Bianco, Grisons Express 56.00 English Prices Swiss Travel System Enjoy Swiss Travel System Good to know. more comfort in 1st class! app! the get product range 2020. tickets and passes. Across Switzerland by train, bus and boat? Easy! With these tips, nothing stands in the way of a comfortable journey. – digital Go Swiss Travel Pass 2nd class 1st class Swiss Travel System tickets and passes are the key to Switzerland’s exten- 3 days CHF 232 CHF 369 sive public transport network. They guarantee practically unlimited travel Regular-interval timetable and connections 4 days CHF 281 CHF 447 Trains always leave at the same minute after each full hour. Main inter-city connections operate 14:27 20.08.19 1 Button-PRINT.pdf Guide Travel Swiss 8 days CHF 418 CHF 663 by train, bus and boat. at half-hour intervals. PostBus and boat connections are also coordinated with these regular- 15 days CHF 513 CHF 810 Swiss Travel Pass Coverage: unlimited travel by train, bus and boat, including premium interval timetables. Thus, changing transportation modes is easy and trouble-free throughout 1 Swiss Travel Pass Youth 2nd class 1st class panoramic trains, plus public transportation in more than 90 towns and cities. Young travellers Switzerland. The complete timetable is available at sbb.ch or via the SBB smartphone app. 3 days CHF 198 CHF 315 up to their 26th birthday receive a 15 % discount off the standard price of a Swiss Travel Pass. Additional information is available on-site at railway station counters. 4 days CHF 240 CHF 381 Validity: 3, 4, 8 or 15 consecutive days. -

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine Written Language: Guidelines and Criteria
Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: guidelines and criteria. Part III. Morphology, II: adjectives, pronouns, invariables Claudi Meneghin Institud de studis Rhaeto-Cisalpins <[email protected]> Abstract This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary Rhaeto-Cisalpine written language, including ISO 639-3 Piedmontese, Lig- urian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot and Friulian. Following the assumptions and the conclusions of Part I we deal with the morphology of the adjective, adverb and invariables in the Padanese varieties. Keywords: Rhaeto-Cisalpine, Padanese, written language, parts of the speech, morphology, Piedmontese, Ligurian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot, Friulian, classical and ancient Lombard. Received: 25.ii.2009 – Accepted: 25.x.2009 Table of Contents 1 Introduction 2 The adjective: making up the feminine inflexion 3 The demonstrative pronoun/adjective 4 The possessive pronoun/adjective 5 Relative and interrogative pronouns/adjectives 6 Indefinite pronouns/adjectives 7 The numerals 8 The adverb 9 Prepositions 10 Conjunctions Appendix Acknowledgements References 37 Ianua. Revista Philologica Romanica ISSN 1616-413X Vol. 9 (2009): 37–94 http://www.romaniaminor.net/ianua/ c Romania Minor 38 Claudi Meneghin 1 Introduction This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary written- language system for the Rhaeto-Cisalpine (or Padanese) domain. The general framework we are working in is described in part I (Meneghin 2007) and II (Meneghin 2008) of this work; as far as specifically morphological issues are concerned, the reader is specifically referred to the introduction of Part II. This paper deals with matters related to the morphology of adjectives, pronouns and invariables in the Padanese varieties. -

Progetto Di Aggregazione Dei Comuni Della Bassa Vallemaggia
PROGETTO DI AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLEMAGGIA Proposta della Commissione di studio all’attenzione del lodevole Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per l’aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo. I. INTRODUZIONE Lo studio del Dipartimento delle Istituzioni Il Cantone ed i suoi Comuni: l’esigenza di cambiare, ovvero l’ormai famoso “macigno nello stagno” lanciato nella primavera del 1998 dall’allora Consigliere di Stato Alex Pedrazzini, diede il via ad un fermento senza precedenti in Ticino sul tema delle aggregazioni comunali. La Vallemaggia fu una delle prime regioni a recepire questa necessità di cambiamento e, grazie all’Associazione dei comuni di Vallemaggia (ASCOVAM) si avviò un ampia discussione attorno al tema. Inizialmente vennero presi in considerazione più varianti di possibili aggregazioni, tra le quali, ricordiamo, la più eclatante prevedeva la creazione di un comune unico per tutta la valle. Infine gli obiettivi rientrarono in dimensioni meno ambiziosi, ma che comunque, se portati a buon fine, costituiranno un importante opera di rivitalizzazione istituzionale. Si cominciò quindi a parlare di un comune della Bassa Vallemaggia, e col tempo si cristallizzò una comunione di intenti tra i Municipi dei sette comuni citati in ingresso. Sembrò questa, ai politici locali, la soluzione migliore, in quanto coinvolgeva enti locali con una certa identità comune, rafforzata in particolare dalla presenza di una sede regionale di scuola elementare. Purtroppo non fu possibile coinvolgere nel progetto anche i comuni di Avegno e Gordevio, che avrebbero idealmente completato l’unità della bassa valle. In data 28 maggio 1999 il Consiglio di Stato istituiva un’apposita Commissione di studio incaricata di presentare una proposta d’aggregazione dei sette comuni. -
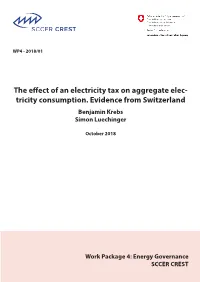
The Effect of an Electricity Tax on Aggregate Elec- Tricity Consumption
WP4 - 2018/01 The effect of an electricity tax on aggregate elec- tricity consumption. Evidence from Switzerland Benjamin Krebs Simon Luechinger October 2018 Work Package 4: Energy Governance SCCER CREST This research is part of the activities of SCCER CREST (Swiss Competence Center for Energy Research), which is financially supported by Innosuisse under Grant No. KTI. 1155000154. The effect of an electricity tax on aggregate electricity consumption. Evidence from Switzerland Benjamin Krebs and Simon Luechinger∗ October 17, 2018 Abstract We estimate the effect of an electricity tax on aggregate electricity consumption with the synthetic control method. The tax was introduced in the Swiss city of Basel in 1999 and, together with other tariff changes, increased marginal electricity prices by 5.4-8.0 percent. We compare the actual and a hypothetical electricity consumption in the years 1999-2006. The latter is a weighted average of electricity consumption in 34 other Swiss cities and captures the hypothetical situation without the tax. We find a small and statistically insignificant effect of −2:7 to −1:9 percent, which implies small price elasticities of −0:5 to −0:2. Keywords: Electricity tax, electricity demand, synthetic control method JEL codes: H230, Q410, Q480 ∗Benjamin Krebs: University of Lucerne; Simon Luechinger: University of Lucerne and ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Switzerland. We would like to thank Marcus Diacon and Patrick Meier for many clarifying discussions and comments as well as for the provision of data. For research assistance, we thank Eliane Debrunner, Simona Richard, and Jonas R¨ollin.Further, we are grateful for all comments made by participants at the research seminars in Neuch^ateland Lucerne and at the conferences on Energy-efficient households (Social Sciences and Practice in Dialogue) in Winterthur, Energy Law and Economics in Lucerne, and on Human Dimensions of Environmental Risks in Ascona. -

CELESTINO POZZI (1821-1887) Ispettore SE Del X Circondario Per 27 Anni
CELESTINO POZZI (1821-1887) ispettore SE del X circondario per 27 anni 1. Collocazione geografica a. Origine del nome Bosco b. Cartina geografica Vallemaggia c. Geografia fisica Vallemaggia 2. Strumenti di lavoro fondamentali 3. Biografia di Celestino Pozzi 4. Lettere di Celestino Pozzi a. Onorari docenti b. Assunzioni docenti c. Disciplina d. Rispetto delle Leggi e. Formazione docenti f. Dispersione scolastica 5. X circondario 6. Compiti dell’Ispettore ieri e oggi Laboratorio RDCD SUPSI DFA – Ornella Monti – gennaio 2020 1 BOSCO - origini del nome Il paese in epoca medioevale (1244) è menzionato come Buscho de Quarino, ossia "bosco di Corino" (frazione di Cerentino situata all'imbocco della Val di Bosco). Fino al 1934 portò il nome ufficiale di Bosco-Vallemaggia, poi modificato in Bosco Gurin, denominazione bilingue (Gurin è il nome locale in Walser) che di fatto è oggi usata comunemente in italiano. Bosco Gurin (fino al 1934 Bosco-Vallemaggia). Geografia fisica Il distretto di Vallemaggia è il primo distretto per superficie e il secondo distretto meno popolato (dopo il distretto di Blenio) del Canton Ticino. La massima elevazione del distretto è il monte Basodino (3.274 m), con l'omonimo ghiacciaio. Altre cime comprendono il Pizzo Campo Tencia (3.072 m), il Pizzo Cristallina (2.912 m) e il Poncione di Braga (2.864 m). I fiumi principali sono la Maggia, che dà nome alla valle, e i suoi affluenti Rovana e Bavona. Il distretto consiste nella valle omonima principale e parecchie valli laterali. Tra queste, le principali sono quella di Val Rovana, Val di Bosco, la Val Bavona, la Val Lavizzara e la Val Sambuco.