1. Problemlage
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Linz: Barock, Moderne Kunst Gartentage 2019 & Musicals! in Linz Beginnt‘S - So Heißt 5 Musiktheater Tanztheater, Es
endlich Waldviertel Mostviertel - April FREIZEIT 2019 Der 25. Landeswandertag der NÖs Senioren führt am 2. Mai nach Krumbach in der Buckligen Welt. Es werden mehr als 2.000 Wanderer erwartet. EćŚĞƌĞ/ŶĨŽƐŝŵ^ƉŽƌƩĞŝů͘ ŝĞdĞŶŶŝƐŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶĚĞƌEPƐ ^ĞŶŝŽƌĞŶĮŶĚĞŶĂŵϮϵ͘ƵŶĚϯϬ͘Ɖƌŝů ŝŶĚĞƌ>ĂŶĚĞƐƐƉŽƌƚƐĐŚƵůĞŝŶ ^ƚ͘WƂůƚĞŶƐƚĂƩ͘/ŶĨŽƐŝŵ^ƉŽƌƩĞŝů͘ Österreichische Post AG, MZ 02Z032366M, NÖs Senioren, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten, Nicht Retournieren. 2 AKTUELLES Das perfekte Geschenk für alle Junggebliebenen . Entgeltliche Einschaltung SCHÖNE STUNDEN IM BURGENLAND Bei Thermenaufenthalten oder kulinarischen Highlights, Shopping- Erlebnissen oder kulturellen Veranstaltungen lässt sich die faszinierende Vielfalt von Burgenland- Gutscheinen erleben und genießen. Burgenland Gutscheine bestellen und erhalten Sie A online auf gutscheine.burgenland.info A als print@home zum Selberdrucken A in allen Filialen der Bank Burgenland Infos bei Burgenland Tourismus Tel. +43 (0) 2682 63384-0. gutscheine.burgenland.info EDITORIAL 3 Meine Meinung Verzicht ist stärker WŇĞŐĞŶĚĞ ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ dürfen keine ĂůƐũĞĚĞĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ Pensionsnach- teile erfahren. Derzeit werden Betreuungs- Liebe Seniorinnen und Senioren! zeiten ab Stufe 3 nur bedingt als Beitragszeiten für die Weder „Greta aus Bülabü“, das zum Schulstreik aufrufende Schulmädchen aus Pension anerkannt. Aus den Schweden, noch die lautesten Rufe nach dem Klimawandel werden eine Verän- erforderlichen 15 Beitrags- derung bringen. jahren müssen immer noch Unser ehemaliger Bundesobmann Präs. a. D. Andreas Khol hat einmal gemeint, -

2008 Exkursionsführer Waidhofen Thaya
Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen Dobersberg, Raabs/Thaya, Waidhofen/Thaya Bezirksbauernkammer Waidhofen/Thaya Exkursionsziele Bezirk Waidhofen/Thaya - NÖ Landesausstellungsregion 2009 1 Inhaltsverzeichnis Vorwort der Bezirksbäuerin 3 Vorwort des Obmannes 4 Der Kammerbezirk Waidhofen/Thaya 5 Dobersberg 6 Sehenswürdigkeiten u. Kulturelles 7 Exkursionsbetriebe 7 Gasthäuser 10 Heurige 11 Raabs 12 Sehenswürdigkeiten u. Kulturelles 12 Exkursionsbetriebe 15 Gasthäuser 17 Heurige 19 Waidhofen an der Thaya 20 Sehenswürdigkeiten u. Kulturelles 21 Exkursionsbetriebe 22 Gasthäuser 25 Fotos Titelseite: Rathaus Waidhofen/Thaya Rapsfeld Ruine Kollmitz Impressum Für den Inhalt verantwortlich: Bezirksbäuerin Renate Kainz, Kammersekretär Ing. Herbert Gutkas Gestaltung: Andrea Ratzinger, Anneliese Luger (Landwirtschaftskammer Niederösterreich) Fotos: zur Verfügung gestellt von den Gemeinden des Bezirkes bzw. den angeführten Exkursionsbetrieben. Druck: Janetschek, Heidenreichstein Herausgeber: AGB Bezirk Waidhofen/Thaya, Bezirksbauernkammer Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen/ Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/2, Tel.: 02842/52101., E-Mail: [email protected]; Internet: www.lk-noe.at/waidhofenthaya Nachdruck auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der Bezirksbauernkammer Waidhofen/Thaya Waidhofen/Thaya, August 2008 2 Vorwort Liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Reiseleiterinnen und Reiseleiter! Ein herzliches Grüß Gott in unserem Bezirk Waidhofen/Thaya! Es freut mich, dass ihr Interesse für unseren Bezirk habt und es würde mich noch mehr freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Ausflugsfahrten sind für Bäuerinnen immer etwas ganz Besonderes, dienen sie doch neben der Weiterbildung auch zur Erholung und zum Gedankenaus- tausch. Darum haben wir uns bemüht, ein vielfältiges Angebot für euch zusammenzu- stellen, damit für jede oder jeden das Richtige dabei ist. Der Bezirk Waidhofen setzt sich aus drei Gebieten – nämlich Dobersberg, Ra- abs/Thaya und Waidhofen/Thaya zusammen. -

Windigsteig Ortsreportage Ab Seite8 Tiergestützte Intervention Damit Können Siekinderundjugendlicheinihrerentwicklungunterstützen
Waidhofen/Thaya Ortsreportage Windigsteig ab Seite 8 18.10.2018 / KW 42 / www.tips.at Tiergestützte Intervention Ulrike Glaser und die Pony-Stute Shivana bieten tiergestützte Intervention an. Damit können sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen. Seiten 4 und 5 / Foto: Schacherl 13.686 Stk. | NÖ 347.064 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. | RedaktionBeeinträchtigte +43 (0)28 42 / 513 88 Menschen stärken Die Integration bzw. Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen funktioniert sehr gut über sportliche Aktivitäten. Der Verein SPIELERPASS hat sich den Fußball als Disziplin Österreichische Post AG | RM 11A038820K | 4010 Linz age |Waidhofen/Thaya Aufl ausgesucht und veranstaltet re- gelmäßig Trainings-Camps und Turniere. Eines davon fand in Radessen im Waidhofner Bezirk statt. Seiten 32 und 33 2 Regionales Land & Leute Waidhofen/Thaya 42. Woche 2018 MedIa-anaLYSe Tips ist weiter auf Erfolgskurs – 342.000* Niederösterreicher lesen Tips nÖ. Tips freut sich laut aktueller nem engagierten Team“, freut sich auf der Webseite www.tips.at sowie ten auch punktgenaue, regionale Media-Analyse über ein weiteres Tips-Geschäftsführer Josef Gruber über Social Media veröffentlicht. Treffsicherheit“, so Tips-Verkaufs- Wachstum in Niederösterreich. über das ausgezeichnete Ergebnis. leiter Moritz Walcherberger. * 342.000 Leser und eine Reichwei- Die Media-Analyse ist die größte Partner in der Region *Quelle: ARGE Media Analysen MA 17/18: Feldar- te von 24,1 %* in Niederösterreich Studie zur Erhebung von Printme- Tips ist der beste Partner für die beit Durchführung GFK Austria, IFES, 01.07.2017- 30.06.2018. Ungewichtete Fälle: 2.421 in OÖ, 2.347 (obwohl Tips erst in 42,7 % des dienreichweiten in Österreich und Werbewirtschaft und hat mit der in NÖ, max. -
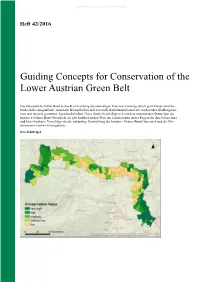
Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt
©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Heft 42/2016 Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Das Europäische Grüne Band erstreckt sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch ganz Europa und ver- bindet dabei ausgedehnte, naturnahe Biotopflächen und wertvolle Kulturlandschaften mit wachsenden Siedlungsräu- men und intensiv genutzten Agrarlandschaften. Diese Studie beschäftigt sich mit dem momentanen Status Quo der Initiative Grünes Band Österreich, sie gibt Einblick in den Wert der Landschaften dieser Region für den Naturschutz und bietet konkrete Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Initiative Grünes Band Österreich und der Nie- derösterreichischen Grenzgebiete. Eva Schweiger ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Eva Schweiger, 2015 ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Abstract Stretching across Europe along the former Iron Curtain, the European Green Belt connects large undisturbed natural biotopes and valuable cultural landscapes with developing urban areas and intensively used agricultural landscapes. The European Green Belt initiative’s main goal is to preserve and restore a pan-European ecological network with a connecting function for species and habitats as well as for conservation work. This study investigates the current status quo of the Austrian Green Belt initiative in regard of organisational structures and conservation activities. Furthermore, a spatial analysis of one specific part of the Austrian borderlands, the Lower Austrian Green Belt, sheds light on the value of this region’s landscapes for nature conservation and clearly shows that the Iron Curtain’s preserving effect is still present in proximity to the border. -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens. -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08
Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand -

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Master’s Thesis Breaking Down Barriers: Euroregional Cooperation of the Czech Republic Author: Bc. Karen Benko Subject: IEPS Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D Academic Year: 2013/2014 Date of Submission: May 14, 2014 Declaration of Authorship I hereby declare that this thesis is my own work, based on the sources and literature listed in the appended bibliography. The thesis as submitted is 130,962 keystrokes long including spaces, i.e. 51 manuscript pages excluding the initial pages, the list of references and appendices. Prague, 14.05.2014 Bc. Karen Benko 2 Acknowledgement I would like to express my gratitude to my supervisor, PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D, for her guidance during the writing process. 3 Abstract: Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four – Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech- Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) – have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. -

Sustainable Mobility in Rural Areas Based on Autonomous Vehicles and Mobility On-Demand
Die approbierte Originalversion dieser Diplom-/ Masterarbeit ist in der Hauptbibliothek der Tech- nischen Universität Wien aufgestellt und zugänglich. MSc Program http://www.ub.tuwien.ac.at Environmental Technology & International Affairs The approved original version of this diploma or master thesis is available at the main library of the Vienna University of Technology. http://www.ub.tuwien.ac.at/eng Sustainable Mobility in Rural Areas based on Autonomous Vehicles and Mobility On-Demand A Pre-feasibility Study for Lower Austria A Master’s Thesis submitted for the degree of “Master of Science” supervised by em. Univ.-Prof. Dr. Günther Brauner Mag. (FH) Laura Beitz 1428134 Vienna, 05 June 2016 Affidavit I, LAURA BEITZ , hereby declare 1. that I am the sole author of the present Master’s Thesis, "SUSTAINABLE MOBILITY IN RURAL AREAS BASED ON AUTONOMOUS VEHICLES AND MOBILITY ON-DEMAND. A PRE- FEASIBILITY STUDY FOR LOWER AUSTRIA", 90 pages, bound, and that I have not used any source or tool other than those referenced or any other illicit aid or tool, and 2. that I have not prior to this date submitted this Master’s Thesis as an examination paper in any form in Austria or abroad. Vienna, 05.06.2016 Signature Abstract In the past century, private automobiles have shaped personal mobility by enabling fast and convenient point-to-point travel. However, this development is having a serious effect on the sustainable nature of our transport system. To transform personal transportation to a sustainable mobility system, two fields of research are currently receiving considerable attention: autonomous vehicles and mobility on-demand. -

ITU Operational Bulletin No.882 Du 15.IV.2007
ITU Operational Bulletin No. 882 15.IV.2007 (Information received by 10 April 2007) Table of Contents Page General information Lists annexed to the ITU Operational Bulletin: Note from TSB.............................................................. 3 Approval of ITU-T Recommendations................................................................................................... 4 Assignment of Signalling Area/Network Codes (SANC) (ITU-T Recommendation Q.708 (03/99)): Antigua and Barbuda, Jamaica.......................................................................................................... 4 Telephone Service: Austria (Communication Authority Austria (Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH), Vienna)....................................................................................................................................... 5 Cameroon (Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Yaoundé) ............................. 30 China (Ministry of Information Industry, Beijing) .......................................................................... 31 Denmark (National IT and Telecom Agency (NITA), Copenhagen): Corrigendum......................... 31 British Virgin Islands (Telecommunications Regulatory Commission, Road Town, Tortola) ........... 32 Oman (Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA), Ruwi) ........................................ 33 Switzerland (Federal Office of Communications (OFCOM), Bienne) ............................................. 34 Changes in the administrations/ROAs and other -

VO Pol. Bez. Waidhofen A.D. Thaya
Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den politischen Bezirk Waidhofen an der Thaya des Bundeslandes Niederösterreich Auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1. Folgende unbewegliche Denkmale des politischen Bezirkes in Waidhofen an der Thaya des Bundeslandes Niederösterreich, die gemäß § 2 oder 6 Abs. 1 leg.cit. kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Bezeichnung Adresse Gemeinde EZ GstNr KG Ortskapelle Hauptstraße 90 Dietmanns 138 208/1 21005 Dietmanns Bründlkirche zur Dietmanns 606 1348/2 21005 Dietmanns unbefleckten Empfängnis Wegkapelle Dietmanns 606 1348/1 21005 Dietmanns Bildstock Dobersberg 12 608 21108 Dobersberg Kath. Pfarrkirche hl. Lambert Dobersberg 14 150 21108 Dobersberg Friedhofskapelle Dobersberg 274 837/3 21108 Dobersberg Pranger Dobersberg 374 926/5 21108 Dobersberg Kriegerdenkmal (Kautzener Dobersberg 374 745/2 21108 Dobersberg Straße) Bildstock (Kautzener Dobersberg 374 938/3 21108 Dobersberg Straße) Bildstock Dobersberg 374 933/6 21108 Dobersberg Ortskapelle hl. Michael Dobersberg 13 542/7 21121 Goschenreith Bildstock Dobersberg 115 549/2 21121 Goschenreith Ortskapelle Hl. Familie Dobersberg 92 115/2 21132 Hohenau Ortskapelle Hl. Dreifaltigkeit Dobersberg 26 1 21159 Merkengersch Kath. Pfarrkirche hl. Georg Dobersberg 1 1 21172 Reibers Ortskapelle hl. Michael Dobersberg 124 29 21174 Reinolz Ortskapelle Dobersberg 53 1 21175 Riegers Mariae Himmelfahrt Ortskapelle hl. Laurentius Dobersberg 51 58 21182 Schuppertholz Kath. Pfarrkirche hl. Martin Gastern 35 1 21118 Gastern Kath. Filialkirche Gastern 1 1 21151 Kleinzwettl hl. Jakobus d. Ä. Kath. Filialkirche hl. Andreas Gastern 1 1/1 21198 Weissenbach Ortskapelle Groß- 34 68 21009 Ellends hll. Florian und Sebastian Siegharts Ortskapelle Groß- 190 1026/4 21010 Fistritz Siegharts Pfarrhof Schulgasse 2 Groß- 1 46 21013 Siegharts Großsiegharts Dreifaltigkeitssäule Groß- 371 37 21013 Siegharts Großsiegharts Kath. -

(EEC) No 2052/88
4 . 3 . 95 I EN Official Journal of the European Communities No L 49/65 COMMISSION DECISION of 17 February 1995 establishing, for the period 1995 to 1999 in Austria and Finland , the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation ( EEC) No 2052/88 (Text with EEA relevance) (95/37/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (EEC) No 2052/88 ; whereas they have been identified as the areas suffering from the most severe rural develop Having regard to the Treaty establishing the European Community, ment problems ; Having regard to Council Regulation (EEC) No 2052/88 Whereas the measures provided for in this Decision are in of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and accordance with the opinion of the Committee on Agri their effectiveness and the coordination of their activities cultural Structures and Rural Development, between themselves and with the operations of the Euro pean Investment Bank and the other existing financial HAS ADOPTED THIS DECISION : instruments ('), as last amended by Regulation (EC) No 3193/94 (2), and in particular Article 11a (3) thereof, Article 1 Whereas in accordance with Article 11a (3) of Regulation (EEC) No 2052/88 , the new Member States concerned For the period 1995 to 1999 in Austria and Finland, the have proposed to the Commission the list of areas which rural areas eligible under Objective 5b as defined by they consider should be eligible under Objective 5b and Regulation (EEC) No 2052/88 shall be those listed in the have provided the Commission with all the information Annex hereto. -

NPDA 42 2016: Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt. Schweiger
Heft 42/2016 Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Das Europäische Grüne Band erstreckt sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch ganz Europa und ver- bindet dabei ausgedehnte, naturnahe Biotopflächen und wertvolle Kulturlandschaften mit wachsenden Siedlungsräu- men und intensiv genutzten Agrarlandschaften. Diese Studie beschäftigt sich mit dem momentanen Status Quo der Initiative Grünes Band Österreich, sie gibt Einblick in den Wert der Landschaften dieser Region für den Naturschutz und bietet konkrete Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Initiative Grünes Band Österreich und der Nie- derösterreichischen Grenzgebiete. Eva Schweiger Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Eva Schweiger, 2015 Abstract Stretching across Europe along the former Iron Curtain, the European Green Belt connects large undisturbed natural biotopes and valuable cultural landscapes with developing urban areas and intensively used agricultural landscapes. The European Green Belt initiative’s main goal is to preserve and restore a pan-European ecological network with a connecting function for species and habitats as well as for conservation work. This study investigates the current status quo of the Austrian Green Belt initiative in regard of organisational structures and conservation activities. Furthermore, a spatial analysis of one specific part of the Austrian borderlands, the Lower Austrian Green Belt, sheds light on the value of this region’s landscapes for nature conservation and clearly shows that the Iron Curtain’s preserving effect is still present in proximity to the border. The conserved valuable cultural landscapes and (semi-) natural biotope areas can and should contribute to the Lower Austrian Green Belt’s integrity and the functioning of the ecological network.