Avner Less (1916-1987): Das Verhör Von Adolf Eichmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MS 315 A1076 Papers of Clemens Nathan Scrapbooks Containing
1 MS 315 A1076 Papers of Clemens Nathan Scrapbooks containing newspaper cuttings, correspondence and photographs from Clemens Nathan’s work with the Anglo-Jewish Association (AJA) 1/1 Includes an obituary for Anatole Goldberg and information on 1961-2, 1971-82 the Jewish youth and Soviet Jews 1/2 Includes advertisements for public meetings, information on 1972-85 the Middle East, Soviet Jews, Nathan’s election as president of the Anglo-Jewish Association and a visit from Yehuda Avner, ambassador of the state of Israel 1/3 Including papers regarding public lectures on human rights 1983-5 issues and the Nazi war criminal Adolf Eichmann, the Middle East, human rights and an obituary for Leslie Prince 1/4 Including papers regarding the Anglo-Jewish Association 1985-7 (AJA) president’s visit to Israel, AJA dinner with speaker Timothy Renton MP, Minister of State for the Foreign and Commonwealth Office; Kurt Waldheim, president of Austria; accounts for 1983-4 and an obituary for Viscount Bearsted Papers regarding Nathan’s work with the Consultative Council of Jewish Organisations (CCJO) particularly human rights issues and printed email correspondence with George R.Wilkes of Gonville and Cauis Colleges, Cambridge during a period when Nathan was too ill to attend events and regarding the United Nations sub- commission on human right at Geneva. [The CCJO is a NGO (Non-Governmental Organisation) with consultative status II at UNESCO (the United National Education, Scientific and Cultural Organisation)] 2/1 Papers, including: Jan -Aug 1998 arrangements -

QF Cuban Exiles Report Invaders In
•«-’> . -f . * » S,- -iV '- \. \ TUESDAY, APRIL 18, l9«l Average Daily Ne^ Press Run The Weather p a g e tW E N T Y For the Week Ended Forecast ot V, 8. Weather BurMQ UlanrljfHtpr lEufttittg H^ralb March n , 1D61 ^ Partly cloudy, Uttlo ehaaga tai 13,317 temporature tonight. Low In Me. St. Mary's Episcopal Guild willi Deme Starts ■y;ij meet in the Guild Room at the| Member ot the Audit niiiraday generaUy fair and About Town rhurch Thursday at 11 a.m. Mem-j Borean ot drealation warmer. High 5S to 60. hers are to bring .sandwiches, and To Construct 4 Manchester— A City of Village Charm MaachMter Lodge of Masons dessert will be funiished by Mrs. [RTERinC wlU b* host to memt^ra of John ; Gertrude Cannon, Mrs. Edith Mather Chapter, Order of DeMo-1 W’ickham and Mrs. Allan Hotch-; FM Station VOL. LXXX, NO. 169 (TWENTY-FOUR PAGES—IN TWO SECTIONS) MANCHESTER, CONN., WEDNESDAY, APRIL 19, 1961 (ClaMltled Adrertletaf on Page 22) PRICE FIVE CENTS lay^ tonight. The DeMolay degree j kiss. Have You An Evehi Scheduled wt>rk m-lU start at 7:30. with Mas Construction on FM broadcast ter Councilor John Krause presid- i Three exchange students at the tag. There will be a social hour and ■Cniversity of Hartford and Dr. ing facllittes In Bolton by radio That Calls For Food? " Pascal Poe. dean of the graduate refreahments. station W'INF will proceed im It may be a weddingi, a banquet or just an informal school, will present a program. -

A N G L 0 - J E 'JI S H ASSOCIATION Woburn House, Upper Woburn Place, London, W»C.1 « Tel: 01-387 5937
A N G L 0 - J E 'JI S H ASSOCIATION Woburn House, Upper Woburn Place, London, W»C.1 « Tel: 01-387 5937 ANNUAL REPORT - 1983/1 984 1. INTRODUCTION The Association's activities each year highlight the importance of its work and the need for as many people as possible to participate in its different spheres of influence and so contribute in one way or another to uphold the very real respect with which it is held, not only within the Jewish community, but also by many politicians and leaders from many walks of life in this country and worldwide. This regard for the Association was emphasised by Viscount Whitelaw in his address on Human Rights at an AJA Public Meeting this year. It was an acknowledgement by the Leader of the House of Lords and Deputy Prime Minister that the contribution made by this Association is important. (Details of this meeting are reported later). The respect and affection of the State of Israel towards the Association at the many meetings in London and Jerusalem have played a very real part in strengthening understanding between both countries. (A large- scale Public Meeting to discuss some of these problems was held this year with Lord Chalfont). The important work of helping our Jewish brethren in need in other parts of the world is also of concern to the AJA, particularly in the field of education. The absorption and aiding of refugees from countless countries by Israel is something we all must respect. The Association has also been concerned with problems of fanaticism within Great Britain, and has therefore held this year a series of large-scale Public Meetings to draw attention to the dangers of cold- blooded bureaucracy (Meeting on Eichmann, October 1983), and the problems of race relations (Meeting on Human Rights, May 1984 ). -
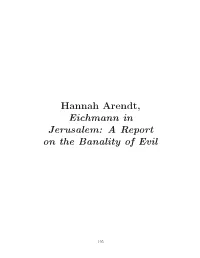
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil 195 Eichmann in Jerusalem Perhaps the greatest political philosopher of the twentieth century, Hannah Arendt was not a system builder. Rather, she was a thinker, who thought things through carefully, making illuminating distinctions. Ideologies deaden thought. If we do not think, we cannot judge good and evil, and become easier prey to participating in the brutalities made possible by the massive concentration of bureaucratic and technocratic power in the nation-state. And thinking should be set on common ends. Arendt holds before us the civic republican ideal of political action as the highest flourishing of human existence: not labor, which merely meets biological needs, nor the fabrication of objects, but the deeds and speeches performed in the public realm to secure the common good. Both liberal capitalism and communism instead reduce politics to economics. Modernity promised democratic participation in self-government, and what we have instead is a reduction of human intellect to instrumental rationality serving material ends. How did reform and enlightenment lead to ideology and not emancipation? Because the social question overwhelmed the political question: the oikos (the household) swallowed the polis. An only child, Hannah Arendt was born in Wilhelmine Germany (in present-day Hanover) in 1906, though she grew up in Kant’s city of K¨onigsberg, at the time an important center of the Jewish Enlightenment. The family was progressive and secular; they were thoroughly assimilated Jews, though Jews still lacked full citizenship rights there. Her father died when she was seven. Her mother was a committed social democrat and became a follower of Rosa Luxemburg. -

Jahresbericht 2007 Archiv Für Zeitgeschichte
Jahresbericht 2007 Archiv für Zeitgeschichte Institut für Geschichte 1 _____________________________ Herausgeber: Archiv für Zeitgeschichte, Zürich 2008. Redaktion: Gregor Spuhler Satz und Gestaltung: Jonas Arnold Sämtliche Illustrationen aus dem Archiv für Zeitgeschichte, Zürich. Gedruckt mit Unterstützung des Freundes- und Fördererkreises des Archivs für Zeitgeschichte und der Stiftung Jüdische Zeitgeschichte an der ETH Zürich. 2 Inhaltsverzeichnis 1 Das Jahr im Überblick .........................................................................................5 2 Berichte der Dokumentationsstellen ............................................................. 11 2.1 Allgemeine Schweizerische Zeitgeschichte ......................................................... 11 2.2 Jüdische Zeitgeschichte .............................................................................................. 14 2.3 Wirtschaft und Zeitgeschichte ................................................................................ 19 2.4 Schweiz – Kalter Krieg ..................................................................................................21 3 Infrastruktur ......................................................................................................24 3.1 Informationstechnologie (IT) ....................................................................................24 4 Sammlungen und Dokumentationen ...........................................................26 4.1 Presseausschnittdokumentation ............................................................................26 -

Ruth Kelson Hannah Arendt E O Âmbito Do Conceito De Banalidade
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP Ruth Kelson Hannah Arendt e o âmbito do conceito de Banalidade do Mal MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO SÃO PAULO 2011 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP Ruth Kelson Hannah Arendt e o âmbito do conceito de Banalidade do Mal MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião, sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé. SÃO PAULO 2011 Banca Examinadora _________________________________ _________________________________ _________________________________ À minha mãe Simita, aos meus irmãos Doris e Bruno e aos meus filhos Matheus, Pedro e Ana. À memória do meu pai, Siegfried (Sica). AGRADECIMENTOS Todos os agradecimentos que tenho a fazer serão sinceros e emocionados. Em primeiro lugar, agradeço aos queridos colegas de mestrado em Ciências da Religião da PUC-SP e aos colegas do NEMES (Núcleo de Estudos da Mística e da Santidade) igualmente da PUC-SP. Estas pessoas me restituíram o sentimento de alegria e esperança em um mundo de pessoas generosas, onde a inteligência e o pensamento têm terreno fértil; - ao meu orientador, Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé, por sua abertura em aceitar a minha “anarquia”. Julgo que o estímulo de seu pensamento instigante e a confiança na criatividade de seus alunos têm sido fundamentais para que eles dêem com tanta prodigalidade, como tenho constatado, o melhor de si; - à Prof a Dr a Dulce -

Susan Neiman Philosophy Not History
Philosophy not History I was honored to be invited to open this conference – until I sat down to work on my lecture, and then I was daunted. In the past sixteen years I’d written about Eichmann in Jerusalem three times, and in looking over the last piece I was reasonably satisfied. I had a reading of the book that makes sense of the whole, and answers most of the objections that have been made to it. Nothing I had read before gave me reason to revise it. But I had little taste for repeating myself, particularly when I saw the list of other speakers and knew that some of them, at least, had read or heard what I had to say before. After spending ten years of my life thinking about evil, it seemed an act of sanity to turn my attention to other subjects, and I cursed myself for having accepted the invitation in the first place. When Bettina Stangneth’s Eichmann vor Jerusalem arrived, I groaned. I had ordered the book to make sure I did my homework, but 700 pages of what I expected to be the usual ponderous German academic prose seemed onerous homework indeed. Moreover, earlier works that had been touted as undermining Eichmann in Jerusalem’s central theses have been flawed at best, and driven by a combination of resentment and incomprehension at worst. On my view, Eichmann in Jerusalem is neither journalism nor history but philosophy – quite probably the most important work of moral philosophy produced in 1 the 20th century. New revelations about Eichmann, therefore, might force us to revise Arendt’s conclusions about Eichmann himself, but not the central and radical claims of her book. -

Diapositiva 1
CUMBRE DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ “Nazismo y legalidad: La justicia desde Nüremberg hasta la actualidad” Franco M. Fiumara Juez en lo Criminal Doctor en Ciencias Jurídicas Doctor en Ciencias Políticas Becario Yad Vashem (Israel) Posgrado Universidad de Bari (Italia) Cursos en Francia, Polonia, Alemania. Docente, Investigador y Consejero UNLaM Disertante con publicaciones de libros y artículos MOISES Padre y guía de los hebreos Relevancia Momento en el cual es histórica entregado a Moisés las tablas de la ley de Dios, “Los 10 mandamientos” Una de las FUENTES DEL DERECHO FUENTES DEL DERECHO NO MATAR… NO ROBAR… NO COMETER PERJURO NI FALSO TESTIMONIO… Ascenso al Poder 30-1-1933: asume Hitler como la Canciller. Logró la mayoría parlamentaria mediante alianzas con otras minorías políticas. 7-4-1933: “Ley para el restablecimiento del servicio civil profesional” 11-4-1933: “Primer reglamento sobre la ley” - 1) Serán consideradas como no arias, las personas que desciendan de no arios y muy particularmente quienes desciendan de padres o abuelos judíos. Será suficiente que uno de los padres o abuelos sea no ario. Esto debe ser tomado en cuenta de un modo muy particular, caso de ser uno de los padres o abuelos de religión judía. “Volksgericht” 24-04-1934: “Ley que promulga la creación de los Tribunales del Pueblo. Competentes en delitos de traición y políticos” Presidente Roland Freisler Volksgericht Algunos casos juzgados: asesinatos judiciales Leo Katzenberger: pena de muerte por contaminación racial por su origen judío; Ejecutado: 3/6/1942. Irene Seiler: Condenada por perjurio. Movimiento Rosa Blanca: 22/2/1943 Ejecutados por traición Sophie, Hans Scholl y otros. -

Arendt Hannah – Eichmann En Jerusalen
A partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer (teniente coronel de las SS) y uno de los mayores criminales de la historia, Hannah Arendt estudia en este ensayo las causas que propiciaron el holocausto, el papel equívoco que desempeñaron en tal genocidio los consejos judíos -cuestión que, en su época, fue motivo de una airada controversia-, así como la naturaleza y la función de la justicia, aspecto que la lleva a plantear la necesidad de instituir un tribunal internacional capaz de juzgar crímenes contra la humanidad. Poco a poco, la mirada lúcida y penetrante de Arendt va desentrañando la personalidad del acusado, analiza su contexto social y político y su rigor intachable a la hora de organizar la deportación y el exterminio de las comunidades judías. Al mismo tiempo, la filósofa alemana estudia la colaboración o la resistencia en la aplicación de la Solución Final por parte de algunas naciones ocupadas, expone problemas que aún hoy día no se han dilucidado -la relación entre la legalidad y la justicia- y cuya trascendencia sigue determinando la escena política de nuestros días.Treinta años después de su publicación, “Eichmann en Jerusalén” sigue siendo uno de los mejores estudios sobre el holocausto, un ensayo de lectura inaplazable para entender lo que sin duda fue la gran tragedia del siglo XX. Hannah Arendt Eichmann, en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa alemana de origen judío, se doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Emigrada a Estados Unidos, dio clases en las universidades de California, Chicago, Columbia y Princeton. -

Malice in Action
Malice in Action Yaacov Lozowick The enemy stood at the gate. The citizens rushed about in confusion as destruction threatened the city. Those who could fled. But there were air raids around the clock, and the routes of escape became less and less accessible. The more resourceful armed themselves with false papers. Columns of smoke billowing up from the bombed-out buildings mingled with the fumes from burning documents. In the midst of the barbarism of war and devastation, however, there were still a few who managed to remain civilized human beings. In one of the few offices left standing, when the mad rush subsided for a time, there was a pause in the destruction of documents and preparations for escape, and the staff gathered for one final chamber concert. There was a pianist, first violin, and the director struck up the second violin.1 Refined, cultured individuals. Right? Wrong. The place is Berlin; the time is April 1945. And the building is none other than the headquarters of Adolf Eichmann, the bane of the Jews, whose musical abilities relegated him to second fiddle. Eichmann is one of the few Nazi personalities still known to a relatively broad public. One of the reasons for that abiding notoriety was a book written at the time of his trial by Hannah Arendt, one of the eminent thinkers of our century--Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil.2 Arendt was born in Germany and fled Nazism to become the first woman appointed full professor at Princeton University. Engaged by The New Yorker magazine to cover the Eichmann trial in Jerusalem, she published a provocative book that won a 1 respected place among an educated and enlightened readership in the West. -

The Trial of Adolf Eichmann and the Quest for Global Justice
Buffalo Human Rights Law Review Volume 8 Article 3 9-1-2002 Genocide: The Trial of Adolf Eichmann and the Quest for Global Justice Matthew Lippman University of Illinois at Chicago Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.buffalo.edu/bhrlr Part of the International Law Commons, and the Military, War, and Peace Commons Recommended Citation Matthew Lippman, Genocide: The Trial of Adolf Eichmann and the Quest for Global Justice, 8 Buff. Hum. Rts. L. Rev. 45 (2002). Available at: https://digitalcommons.law.buffalo.edu/bhrlr/vol8/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by the Law Journals at Digital Commons @ University at Buffalo School of Law. It has been accepted for inclusion in Buffalo Human Rights Law Review by an authorized editor of Digital Commons @ University at Buffalo School of Law. For more information, please contact [email protected]. GENOCIDE: THE TRIAL OF ADOLF EICHMANN AND THE QUEST FOR GLOBAL JUSTICE Matthew Lippman* INTRODUCTION This essay revisits the Israeli prosecution of Adolf Eichmann, a central architect of Nazi Germany's Final Solution of the Jewish question. The Eichmann trial stands as a seminal step in the development of interna- tional human rights and humanitarian law and presents the profound juris- prudential issue as to whether legal standards and procedures may be compromised in an effort to achieve a desired and deserved criminal conviction.' Professor Lon L. Fuller composed the hypothetical, The Problem Of The Grudge Informer, to highlight the central issues raised in Eichmann and in other post-World War H war crimes prosecutions. -

Presenting Eichmann: One Man, Many Murders
Chapman University Chapman University Digital Commons War and Society (MA) Theses Dissertations and Theses Summer 8-2021 (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders Nina Handjeva-Weller Chapman University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.chapman.edu/war_and_society_theses Part of the Holocaust and Genocide Studies Commons, Other Film and Media Studies Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Handjeva-Weller, Nina. "(Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders." Master's thesis, Chapman University, 2021. https://doi.org/10.36837/chapman.000303 This Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in War and Society (MA) Theses by an authorized administrator of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders A Thesis by Nina Handjeva-Weller Chapman University Orange, CA Wilkinson College of Arts, Humanities, and Social Sciences Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in War and Society August 2021 Committee in charge: Stephanie Takaragawa, Ph.D., Jeffrey Koerber, Ph.D. Nam Lee, Ph.D. The thesis of Nina Handjeva-Weller is approved. Stephanie Takaragawa, Ph.D., Chair Jeffrey Koerber, Ph. D Nam Lee, Ph.D. July 2021 (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders Copyright © 2021 by Nina Handjeva-Weller III ABSTRACT (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders by Nina Handjeva-Weller This thesis argues that the act of recording the trial of Adolf Eichmann was an interpretation by director Leo Hurwitz, and that at the time it was recorded, and since then, the material has been used by different actors for different purposes.