Michaela Sohn-Kronthaler Hildegard Burjan (1883-1933)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hildegard Burjan – a Conflicted Life Chapter 1 Page 06 Entirely for God and for the People – a Life Between Many Conflicting Polarities
english3 hildegard burjan a conflicted life biography Find us on the web www.hildegardburjan.at www.caritas-socialis.or.at 4 hildegard burjan a conflicted life biography Sponsors Impressum: Owner, distributor and publisher: Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, 1090 Vienna, Pramergasse 9, AUSTRIA, Tel.: +43 1 310 38 430 E-Mail: [email protected] Web: www.hildegardburjan.at • www.caritas-socialis.or.at Responsible for content: Sr. Maria Judith Tappeiner CS Editorial office: Prof. Ingeborg Schödl, Sr. Karin Weiler CS English Translation (2007): Mag. Mireille Haslinger, Mag. Birgit Simoner, Marcella Petutschnig, Michael Kuhn, Richard Dunsmore Photos: Archiv der Caritas Socialis Litho: Blaupapier Bildretusche Produktion Ges.m.b.H. Graphic & Layout: KOMO Vienna, Bureau for visual affairs, www.komo.at Printing: digitaldruck.at english Vienna, 25. 10. 2012 contents 4 Chapters 5 Preface Hildegard Burjan – A Conflicted Life Chapter 1 page 06 Entirely for God and for the people – a life between many conflicting polarities Chapter 2 page 16 Social Pioneering Work «Mother of Outworkers in Vienna» Chapter 3 This booklet is dedicated to Hildegard Burjan, her social work page 22 The «Conscience of Parliament» – and her benevolence. In her role as the first Christian Social delegate of First Christian Social Delegate the First Republic of Austria and as the founder of a religious sisterhood, she broke new ground in social politics, which has paved the way to the Chapter 4 social policies of today. Caritas Socialis (CS) is committed to her cause, page 28 CARITAS SOCIALIS – namely to demonstrate God’s love through service of to others. Through Declaration of God’s Love this commitment her work continues. -

St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church March 29, 2020 Rev. Darryl J. Pepin, Pastor
St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church “Lazarus,“Lazarus, come come out!” out!” P.O. Box 183 JOHN 11:43 John 11:43 Bark River, MI 49807 March 29, 2020 Rev. Darryl J. Pepin, Pastor [email protected] Cynthia DeFiore ~ Parish Secretary Bonnie Cowell ~ Bookkeeper Kelley VanLanen ~ Religious Ed. Ray Viau ~ Maintenance Call the Parish Office at 906-466-9938 Colleen Knauf ~ Organist ~ 466-2872 Ruth VanEnkevort ~ Musician ~ 280-1422 Diocesan Pastoral Council Connee Sagataw ~241-0454 or [email protected] St. Elizabeth Ann Seton St. Vincent de Paul Conference: 906-466-9050 PARISH MEMBERSHIP Parishioners should be registered, as this is the usual means to certify that one is a member of the Parish when seeking sponsor certificates for Baptism, Confirmation, and Marriage. Call the Parish Office to register. 906-466-9938 During this time of Coronavirus concerns and suspension of Masses across our diocese, I urge all of us who are able financially to remember to tithe to our parish since we are dependent upon your support! While we cannot meet for Mass, our bills, As a member of this parish, if you have like yours, will continue. Without a email, you have access to FORMED! weekly offering, our parish may Discover thousands of books, audio struggle. God will provide, but He still talks, movies, documentaries and needs you to do your part! studies… there is something for every Know that I am praying for you and member of the family to help them am there to help with whatever grow closer to Christ and His Church. your needs may be. -

TESE Silvana Sobreira De Matos.Pdf
UNIVERDIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA RECIFE 2014 SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA Tese apresentada ao Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Antropologia. Orientadora: Profª. Drª. Roberta Bivar Carneiro Campos RECIFE 2014 Catalogação na fonte Bibliotecária Maria Janeide Pereira da Silva, CRB4-1262 M433b Matos, Silvana Sobreira de. A beata Chiara Luce e as transformações e/ou atualizações na santidade católica / Silvana Sobreira de Matos. – 2014. 243 f. : il. ; 30 cm. Orientador: Profª. Drª. Roberta Bivar Carneiro Campos. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-graduação em Antropologia, 2014. Inclui referências e anexos. 1. Antropologia. 2. Catolicismo. 3. Santidade. 4. Juventude. I. Campos, Roberta Bivar Carneiro (Orientadora). II Título. 301 CDD (22. ed.) UFPE (BCFCH2017-201) SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA Tese apresentada ao Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Antropologia. Aprovada em 25 / 02 / 2015 Banca Examinadora _____________________________________________ Dra. Roberta Bivar Carneiro Campos Orientadora Universidade Federal de Pernambuco ______________________________________________ Dra. Misia Lins Reesink Universidade Federal de Pernambuco Examinador Interno ______________________________________________ Dr. Bartolomeu Tito Figuerôa de Medeiros Universidade Federal de Pernambuco Examinador Interno _____________________________________________ Dra. -

Deutsch + Englisch
Hildegard Burjan Mit Spannungen leben – eine Ermutigung An encouraging life – between many conflicting polarities www.cs.or.at Hildegard Burjan Gründerin der Caritas Socialis Founder of Caritas Socialis 1883-1933 www.cs.or.at Hildegard Burjan * 30.1.1883 Hildegard Lea Freund Görlitz/Neisse/Deutschland Görlitz/Neisse/Germany Zweite Tochter einer jüdischen Familie Second daughter of a jewish family www.cs.or.at Hildegard Burjan Studium in Zürich Studies in Zürich Philosophie, Anglistik, Sozialökonomie Philosophy, Anglistics, Social Economics 1907: Sie heiratet Alexander Burjan in Berlin She married Alexander Burjan in „Gott, wenn du bist, zeige dich mir!“ Berlin www.cs.or.at „Lord, if You exist, show yourself to me.“ Hildegard Burjan 1909 lebensbedrohliche Erkrankung und Genesung life-threatening illness and recovery Taufe baptism Übersiedlung nach Wien She moved to Vienna 1910 Geburt ihrer Tochter Elisabeth birth of daughter Elisabeth „Dieses neu geschenkte Leben muss ganz Gott und den Menschen gehören“ „This newly given life must belong totally to www.cs.or.at God and all mankind.“ „Volles Interesse für die Politik gehört zum praktischen Christentum.“ „Interest in politics is a part of practising christianity.“ www.cs.or.at Gründung der Schwesterngemeinschaft Foundation of the sisterhood Caritas Socialis ...etwas Neues, der Zeitnot angepasst, beweglich und immer einsatzbereit für jede Not, die auftaucht. We are aiming for something new … 4. Oktober 1919 www.cs.or.at Christ´s love urges us. www.cs.or.at • Hildegard Burjan stirbt am 11. Juni 1933 • Hildegard Burjan died on 11 June 1933 • 29. 1. 2012 Seligsprechung im Wiener Stephansdom • Beatification on 29 January 2012 in St. -

Magisterial and Episcopal Texts on Palliative Care and End of Life of Life Issues
Appendix: Magisterial and Episcopal Texts on Palliative Care and End of Life of Life Issues Letter of His Holiness Pope Francis to Participants in the European Regional Meeting of the World Medical Association on End-Of-Life Issues1 November 7, 2017 To My Venerable Brother Archbishop Vincenzo Paglia President of the Pontifical Academy for Life I extend my cordial greetings to you and to all the participants in the European Regional Meeting of the World Medical Association on end-of-life issues, held in the Vatican in conjunction with the Pontifical Academy for Life. Your meeting will address questions dealing with the end of earthly life. They are questions that have always challenged humanity, but that today take on new forms by reason of increased knowledge and the development of new technical tools. The growing therapeutic capabilities of medical science have made it possible to elimi- nate many diseases, to improve health and to prolong people’s life span. While these developments have proved quite positive, it has also become possible nowadays to extend life by means that were inconceivable in the past. Surgery and other medical interventions have become ever more effective, but they are not always beneficial: they can sustain, or even replace, failing vital functions, but that is not the same as promoting health. Greater wisdom is called for today, because of the temptation to insist on treatments that have powerful effects on the body, yet at times do not serve the integral good of the person. Some 60 years ago, Pope Pius XII, in a memorable address to anaesthesiologists and intensive care specialists, stated that there is no obligation to have recourse in all circumstances to every possible remedy and that, in some specific cases, it is 1 http://www.news.va/en/news/pope-addresses-end-of-life-issues © Springer Nature Switzerland AG 2019 241 P. -

Press Release 2019
Page 1 of 19 Press Release 2019 Contact Mag. Sabina Dirnberger MBA 1030 Wien, Oberzellergasse 1 Tel 01/717 53-3133 [email protected] www.cs.at CS Hospice Rennweg Page 2 of 19 Table of Contents 1 Hospice and palliative care ..............................................................................................3 2 What does CS Hospice Rennweg enable?....................................................................3 3 Establishment – Begin of CS Hospice........................................................................... 4 4 Integrated offerings: CS Hospice Rennweg.................................................................5 5 Financing – Donations ......................................................................................................8 6 What do our services cost? ..............................................................................................9 7 Interdisciplinary Team – Organization ........................................................................ 10 8 History of the Hospice Movement............................................................................... 11 9 CS Caritas Socialis – The Parent Organization .......................................................... 11 9.2.1 Specialization Multiple Sclerosis…………………………………………………………………………………….12 9.2.2 Special establishments for people with dementia……………………………………………………….. 13 9.2.3 Specialization Hospice Culture and Maieutics………………………………………………………………14 10 Overview: Facilities of CS Caritas Socialis ................................................................. -
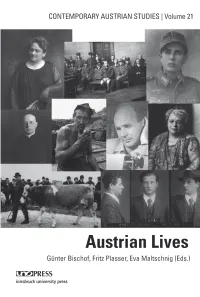
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Lessons for UKIP from Germany and Austria
VOLUME 13 NO.3 MARCH 2013 journal The Association of Jewish Refugees Lessons for UKIP from Germany and Austria robably the most striking shift dissatisfied with the governing party of the to gain parliamentary representation and in the fortunes of British politi- day but cannot bring themselves to vote political power than one from the right of P cal parties recently has been the for the main opposition party. The Liberal the political spectrum. (Or indeed from rise in support for the United Kingdom Democrats learnt to play that role skilfully, the left: who remembers the success of Independence Party (UKIP), which now presenting themselves as a centre party the British Green Party at the European matches the Liberal Democrats in the attractive to disillusioned voters from parliamentary elections of 1989, when it opinion polls. UKIP also did well at the both Tory and Labour camps. The Social secured 15 per cent of the vote, far ahead last set of parliamentary by-elections and Democrat/Liberal Alliance took off in the of the Social and Liberal Democrats?) It is should perform strongly at next year’s 1980s, when the gulf between the right- important to differentiate between right- elections for the European Parliament. wing policies of the Thatcher government leaning ‘third parties’ like UKIP and par- That said, UKIP has come nowhere and the left-wing course of the Labour ties of the far right, like the Front National near winning a by-election, as the Social in France, Golden Dawn in Greece or the Democrats and the Social Democrat/Lib- BNP in Britain. -

Press Release CS Caritas Socialis
Press Release CS Caritas Socialis January 2020 Contact Mag. Sabina Dirnberger-Meixner, MBA Oberzellergasse 1, 1030 Vienna 01/717 53-3131 [email protected] Table of Contents 1 Origins and Goals ............................................................................................................................... 2 2 Statistics, Data and Facts .................................................................................................................. 4 3 Our Mission: Being Cared for in Dignity – Living on One’s Own ........................................... 4 4 Hospice and Palliative Care ............................................................................................................. 5 4.1 CS Hospice Rennweg ................................................................................................................ 6 4.1.1 Six Facilities Under One Roof ............................................................................................... 6 4.2 Hospice vs. Palliative Unit ........................................................................................................ 9 4.3 Financing of CS Hospice Rennweg ........................................................................................... 9 4.4 Hospice Culture and Maieutics .............................................................................................. 10 5 Care and Suppport ........................................................................................................................... 10 5.1 Focus on -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Prymat Piotrowy
PRYMAT PIOTROWY TOM 10 – 2015 PRYMAT PIOTROWY Wydawca: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Etudes de Sciences Thé ologiques KomitetN: aukowy prof. dr hab.Clemens Breuer ( Philosophisch-Theologische Hochschule St. P ölten, Austria) ; ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM Poznań); ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa); ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław); ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin); bp dr hab. prof. ChATMarcin Hintz (ChAT Warszawa); prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babe ş -Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia); p rof. drGerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy) ; ks. prof. drDariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy ); k s. prof. dr hab. Józef, Kulisz (Bobolanum Warszawa); ks. prof.Piotr Morciniec (UO Opole); o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII Kraków); ks. prof. dr hab.Jan Perszon (UMK Toruń) ; ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania); ks. prof. dr hab.Jan Słomka (UŚ Katowice) ; ks. prof. drJózef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba, Boliwia) Komitet Redakcyjny: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO Opole); ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn) – przewodniczący; ks. dr hab. Artur Malina , prof. UŚ (UŚ Katowice); ks. dr hab. Sławomir Nowosad , prof. KUL (KUL Lublin); prof. dr hab.Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa); ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa); drMałgorzata Laskowska (UKSW Warszawa) – sekretarz Redaktorzy tematyczni: ks. prof. dr hab.Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna; ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne; o. prof. dr hab.Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna; ks. prof. dr hab.Łukasz Kamykowski (UPJPII Kraków) – teologia fundamentalna; prof. -
Eleitwort Selige Hildegard Burjan – Was Nun?
Sr. Maria Judith Tappeiner CS Generalleiterin der Schwesterngemeinschaft Stiftungsvorstand der Caritas Socialis eleitwort Selige Hildegard Burjan – was nun? Am 29. Jänner 2012 wurde Hildegard Burjan, die Gründerin der Caritas G Socialis (CS), selig gesprochen. Großes mediales Echo galt der ersten demokra- tisch gewählten Politikerin, die von der Kirche zur Ehre der Altäre erhoben wurde. Viele Menschen aus Kirche und Gesellschaft folgten der Einladung zur ersten Seligsprechung, die im Wiener Stephansdom stattfand. Viele hat die Feier sehr angesprochen, ja begeistert. Der Stephansdom war ganz voll. Eine Frau wurde geehrt und zur Ehre der Altäre erhoben, ihr Bild im Stephansdom feierlich entrollt. In den Rückmeldungen wurde vor allem heraus- gestrichen, wie wohltuend die Form der aktiven Teilhabe an der Feier für die vielen Versammelten war. Viele identifizierten sich mit der Person der neuen Seligen – einer Frau, von der viele sagen können: Sie ist eine von uns, die unsere Probleme kennt, sich für das Leben der Menschen interessiert und sich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzt – und noch dazu als Politikerin. Heilige und Selige empfinden viele als unerreichbar. Interessant sind für die Medien besonders Geschichten rund um das erforderliche Wunder und die Reliquien, die von vielen auch heute als greifbare Brücke zum Heiligen verehrt werden. Die Chance Hildegard Burjans geht darüber hinaus. Sie ist dem Men- schen von heute nahe und zugänglich – eine Frau mit Ecken und Kanten, mit Sorgen und Scheitern, auf der Suche nach Gott und ihrem Platz in der Welt. Eine Seligsprechung ist nicht nur die Würdigung einer historischen Persönlich- keit. Die Kirche fragt auch, was diese Gestalt der Nachfolge uns heute sagen könnte.