Filsum , Samtgemeinde Jümme, Landkreis Leer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The German North Sea Ports' Absorption Into Imperial Germany, 1866–1914
From Unification to Integration: The German North Sea Ports' absorption into Imperial Germany, 1866–1914 Henning Kuhlmann Submitted for the award of Master of Philosophy in History Cardiff University 2016 Summary This thesis concentrates on the economic integration of three principal German North Sea ports – Emden, Bremen and Hamburg – into the Bismarckian nation- state. Prior to the outbreak of the First World War, Emden, Hamburg and Bremen handled a major share of the German Empire’s total overseas trade. However, at the time of the foundation of the Kaiserreich, the cities’ roles within the Empire and the new German nation-state were not yet fully defined. Initially, Hamburg and Bremen insisted upon their traditional role as independent city-states and remained outside the Empire’s customs union. Emden, meanwhile, had welcomed outright annexation by Prussia in 1866. After centuries of economic stagnation, the city had great difficulties competing with Hamburg and Bremen and was hoping for Prussian support. This thesis examines how it was possible to integrate these port cities on an economic and on an underlying level of civic mentalities and local identities. Existing studies have often overlooked the importance that Bismarck attributed to the cultural or indeed the ideological re-alignment of Hamburg and Bremen. Therefore, this study will look at the way the people of Hamburg and Bremen traditionally defined their (liberal) identity and the way this changed during the 1870s and 1880s. It will also investigate the role of the acquisition of colonies during the process of Hamburg and Bremen’s accession. In Hamburg in particular, the agreement to join the customs union had a significant impact on the merchants’ stance on colonialism. -
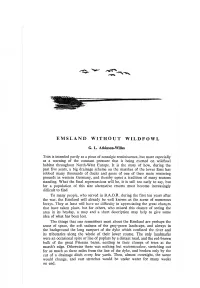
Emsland Without Wildfowl
EMSLAND WITHOUT WILDFOWL G. L. Atkinson-Willes T h is is intended partly as a piece of nostalgic reminiscence, but more especially as a warning of the constant pressure that is being exerted on wildfowl habitat throughout North-West Europe. It is the story of how, during the past five years, a big drainage scheme on the marshes of the lower Ems has robbed many thousands of ducks and geese of one of their main wintering grounds in western Germany, and thereby upset a tradition of many seasons standing. What the final repercussions will be, it is still too early to say, but for a population of this size alternative resorts must become increasingly difficult to find. To many people, who served in B.A.O.R. during the first ten years after the war, the Emsland will already be well known as the scene of numerous forays. They at least will have no difficulty in appreciating the great changes that have taken place, but for others, who missed this chance of seeing the area in its heyday, a map and a short description may help to give some idea of what has been lost. The things that one remembers most about the Emsland are perhaps the sense of space, the soft sadness of the grey-green landscape, and always in the background the long rampart of the dyke which confined the river and its tributaries along the whole of their lower course. The only landmarks were an occasional spire or line of poplars by a distant road, and the red-brown bulk of the great Friesian barns, nestling in their clumps of trees at the marsh’s edge. -

Paul Weßels Hesel, Samtgemeinde Hesel, Landkreis Leer 1. Lage Und Siedlungsform Hesel Befindet Sich Etwa 12 Km Nordöstlich
Paul Weßels Hesel , Samtgemeinde Hesel, Landkreis Leer 1. Lage und Siedlungsform Hesel befindet sich etwa 12 km nordöstlich von Leer auf dem Kreuzungspunkt des oldenburgisch-ostfriesischen Geestrückens mit einem sich bis nach Leer erstreckenden Ausläufer dieses Rückens. Für ostfriesische Verhältnisse liegt das Dorf mit 8 - bis über 10 m über NN relativ hoch auf eiszeitlichen, sandigen Pseudogley-Podsol-Böden auf plateauartiger Lage am westliches Rand eines Hanges, der im Osten des Dorfes im Bereich des heutigen Heseler Waldes bis auf fast 16 m über NN ansteigt und damit zu den höchsten natürlichen Erhebungen in Ostfriesland gehört. Das Dorf ist umgeben von niedriger liegenden, unterschiedlichen Gley- und Moorböden, die sich bis auf 3,5 m über NN absenken. Der Ort entwässert nach Süden in die Holtander Ehe und nach Norden in die Bagbander Ehe. An den beiden von Niederungsmoor umgebenen Bächen, die auch jeweils einen Teil der Gemeindegrenzen bilden, senkt sich das Geländeniveau im Süden auf bis zu 2,5 m und im Nordwesten bis zu +-0 m NN. Das zentrale Hochmoor des Moormerlandes grenzte früher westlich von Kiefeld unmittelbar an den Ort an, weitere Hochmoorflächen gab es im Osten bei Hasselt, Barthe und Schwerinsdorf. Alle Moore sind heute abgetorft. 2. Vor- und Frühgeschichte Die Ur- und Frühgeschichte Hesels gehört seit den 1990er Jahren zu den am besten erforschten in Ostfriesland. Als hoch gelegener und auf dem Landweg nicht zu umgehender Platz, der wohl bereits in der Bronzezeit in ein Wegesystem eingebunden war, haben sich in Hesel eine Vielzahl von archäologischen Spuren erhalten. Die ältesten bislang gewonnenen verlässlichen Daten über menschliche Anwesenheit in Ostfriesland wurden südlich des Dorfes auf dem „Brink“ gefunden und stammen aus der mittleren Steinzeit aus den Jahren von ca. -

Samtgemeinde Jümme Samtgemeinde Hesel 26849 Filsum 26835 Hesel
Samtgemeinde Jümme Samtgemeinde Hesel 26849 Filsum 26835 Hesel Gemeinde Uplengen Gemeinde Moormerland 26670 Uplengen 26802 Moormerland Amtliche Bekanntmachung Raumordnungsverfahren für die Planung von Trassenkorridoren zwischen dem Anlandungspunkt Hilgenriedersiel sowie dem Raum Emden und dem Netzverknüpfungspunkt Cloppenburg hier: Öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen gem. § 10 Abs. 5 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) TenneT Offshore GmbH (Vorhabenträgerin) plant für die Anbindung von zukünftigen Offshore-Windparks einen Trassenkorridor für die Verlegung von einem Netzanschlusssystem aus dem Raum Emden bis zum Netzverknüpfungspunkt Cloppenburg sowie einen Trassenkorridor für 2 Netzanschlusssysteme von Hilgenriedersiel zum Netzverknüpfungspunkt Cloppenburg. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems hat am 17.05.2017 das Raumordnungsverfahren mit integrierter Prüfung der Umweltverträglichkeit gemäß § 15 Raumordnungsgesetz des Bundes und § 9 ff. Niedersächsisches Raumordnungsgesetz für dieses Vorhaben eingeleitet. Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 13. Juni 2017 bis 24. Juli 2017 zur Einsicht für die Öffentlichkeit aus; die Auslegung erfolgt im Rathaus der Samtgemeinde Jümme, Rathausring 8-12, 26849 Filsum, Zimmer 30, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Uplengen, Alter Postweg 113, 26670 Uplengen-Remels, Bauamt , Zimmer 10, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus der Samtgemeinde Hesel, Rathausstraße 14, 26835 Hesel, Raum O-09, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Moormerland, Theodor-Heuss-Str. -

Internet Ausgabe 21 01 12
Landkreis Leer Nr. 22 Amtsblatt Donnerstag, 01.12.2011 A. Bekanntmachungen des Landkreises Leer Seite ■ Amt I/13 Hauptsatzung des Landkreises Leer 141 - 142 Entschädigungssatzung des Landkreises Leer 142 - 143 Geschäftsordnung des Landkreises Leer 144 - 149 B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände Seite ■ Gemeinde Bunde Hauptsatzung der Gemeinde Bunde 149 - 151 ■ Gemeinde Firrel Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 151 ■ Gemeinde Jemgum Widmung von Gemeindestraßen 151 - 153 ■ Gemeinde Nortmoor Hauptsatzung der Gemeinde Nortmoor 153 - 154 ■ Gemeinde Ostrhauderfehn 1. Nachtragssaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 154 - 155 C. Sonstiges Seite ■ Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen – Regionaldirektion Aurich Öffentliche Bekanntmachung in der Flurbereinigung Großes Meer; Feststellungsbeschluss 155 - 156 Flurbereinigung Strackholt; 1. Änderung der vorläufigen Besitzeinweisung auf der Grundlage der Festsetzungen im vorgelegten Flurbereinigungsplan 156 - 157 ■ Ev.-ref. Kirchengemeinde Ditzum Bekanntmachung der 5. Änderung vom 19.04.2010 der Friedhofsgebührenordnung vom 27.09.1989 der Ev.-ref. Kirchengemeinde Ditzum 157 - 158 - 141 - Hauptsatzung des Landkreises Leer § 6 Beamtinnen und Beamte auf Zeit Aufgrund des Niedersächsischen Kommunalverfas- sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Außer der Landrätin/dem Landrat werden die allge- S. 576) hat der Kreistag des Landkreises Leer in seiner meine Vertreterin/der allgemeine Vertreter als Erste Sitzung am 16.11.2011 folgende Hauptsatzung be- Kreisrätin/Erster Kreisrat sowie eine weitere leitende schlossen: Beamtin/ein weiterer leitender Beamter als Kreisrätin/ Kreisrat in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. § 1 Name und Sitz § 7 Geschäftsordnung Der Landkreis Leer führt den Namen „Landkreis Leer“. Er hat seinen Sitz in Leer/Ostfriesland. Das Verfahren des Kreistages und des Kreisausschus- ses wird durch die vom Kreistag zu erlassene Ge- § 2 schäftsordnung geregelt. -

FESTSTELLUNGSENTWURF Für Den
Unterlage 17.1.4.1 Neubau Bundesautobahn A 20 der Ausbau Bundesstraße Von ca. km 100+000 bis ca. km 113+000 Straßenbauverwaltung Nächster Ort: Dringenburg des Landes Niedersachsen Baulänge: 13,00 km Länge der Anschlüsse: FESTSTELLUNGSENTWURF für den Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Straßennetz Aufgestellt: Oldenburg, den 28.04.2015 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Oldenburg im Auftrage : gez. Mannl A 20 von Westerstede bis Drochtersen Unterlage 17.1.4.1: Nachgeordnetes Straßennetz Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Seite 2 von 82 Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis ................................................................................................................. 4 Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. 5 Anhänge .................................................................................................................................... 6 1 Aufgabenstellung .............................................................................................................. 8 2 Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung ........................................................ 9 2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND BEURTEILUNG ................................................................................... 9 2.2 ABGRENZUNG MÖGLICHER -

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -

Gemeindebrief Der Evangelisch-Lutherischen St. Stephani- Und Bartholomäi-Kirche Detern
Gemeindebrief der Evangelisch-lutherischen St. Stephani- und Bartholomäi-Kirche Detern Ausgabe 123: März - Mai 2020 Von der Aufer- stehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegen- wärtige Welt wehen. (Dietrich Bonhoeffer) Foto: Ruben Grüssing Inhaltsverzeichnis Seite 2 Inhaltsverzeichnis und Impressum Seite 3+4 Impuls für den Alltag + Einladung Frauentreff Seite 5 Einladung Weltgebetstag 06.03. + Frauenkreis II Seite 6 Neue Gruppe: „Fit für 100“ Seite 7 Einladung Frauenfrühstück 25.04. Seite 8+9 Interview mit Ruben Grüssing + Buchvorstellung Seite 10+11 Einladung neue Vorkonfirmanden + Werbepartner Seite 12+13 Rückblick musikalischer Adventsgottesdienst Seite 14+15 Rückblick Mitarbeiterempfang Seite 16+17 Senioren am Mittagstisch + Unsere Werbepartner Seite 18+19 Unsere neue Vikarin Seite 20 Neugestaltung des Kirchenwäldchens Seite 21 Gottesdienst erleben und entwickeln Seite 22+23 Neues aus Indien + Mittendrin-Rezept Seite 24 Unsere Werbepartner Seite 25 Die Altpapier-Sammlung geht weiter Seite 26+27+28 Unsere Konfirmanden Seite 29 JesusHouse in Detern 24. - 28.03. Seite 30+31 Aktuelles aus dem Treff Seite 32+33 Unsere Kinderseite Seite 34+35 Gebetsanliegen der evangelischen Allianz Seite 36+37 Unsere Geburtstagskinder Seite 38+39 Trauer und Freude + Mittendrin Kurzmitteilungen Seite 40 Einladung für Kinder: Indien-Tag 18.04. Seite 41 Gottesdienste in Amdorf-Neuburg Seite 42+43 Unsere Gottesdienste Seite 44+45 Veranstaltungen der Evangelischen Gemeinschaft Seite 46+47 Gruppen & Kreise Seite 48 So können Sie uns erreichen Impressum Herausgeber: Der Kirchenvorstand der evangelisch - lutherischen St. Stephani- und Bartholomäi- Kirchengemeinde Redaktion: Henning Behrends, Gudrun Konjer-Hassing, Helga Broers, Silvia Meyer-Klein, Petra Reil, Petra Pelgröm, Jan Kaymer Druck: Gemeindebrief – Druckerei, Auflage 1300 St. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Fourth Report of the Federal Republic of Germany in Accordance with Article 15 (1) of the European Charter for Regional Or Minority Languages
Fourth Report of the Federal Republic of Germany in accordance with Article 15 (1) of the European Charter for Regional or Minority Languages 2010 1 Contents No. Introduction Part A General situation and general framework 00101-00122 Part B Recommendations of the Committee of 00200-00401 Ministers Part C Protection of regional or minority 00701-00793 languages under Part II (Article 7) of the Charter Part D Implementation of the obligations 00800–61400 undertaken with regard to the various languages D.1 General policy remarks regarding the 00800-01400 various articles of the Charter D.2.1 Danish Danish in the Danish language area in 10801-11404 Schleswig-Holstein Art. 8 10801-10838 Art. 9 10901-10904 Art. 10 11001-11005 Art. 11 11101-11126 Art. 12 11201-11210 Art. 13 11301-11303 Art. 14 11401-11404 D.2.2 Sorbian Sorbian (Upper and Lower Sorbian) in the 20000-21313 Sorbian language area in Brandenburg and Saxony Art. 8 20801-20869 Art. 9 20901-20925 Art. 10 21001-21037 Art. 11 21101-21125 Art. 12 21201-21206 Art. 13 21301-21313 D.2.3 North North Frisian in the North Frisian language 30801-31403 Frisian area in Schleswig-Holstein Art. 8 30801-30834 2 Art. 9 30901-30903 Art. 10 31001-31009 Art. 11 31101-31115 Art. 12 31201-31217 Art. 13 31301 Art. 14 31401-31403 D.2.4 Sater Sater Frisian in the Sater Frisian language 40801-41302 Frisian area in Lower Saxony Art. 8 40801-40825 Art. 9 40901-40903 Art. 10 41001-41025 Art. 11 41101-41120 Art. -

Bus Linie 638 Fahrpläne & Netzkarten
Bus Linie 638 Fahrpläne & Netzkarten 638 Brückenfehn Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 638 (Brückenfehn) hat 3 Routen (1) Brückenfehn: 12:35 (2) Hesel Sz: 06:50 - 07:40 (3) Hollen: 13:25 - 16:10 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 638 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 638 kommt. Richtung: Brückenfehn Bus Linie 638 Fahrpläne 20 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Brückenfehn LINIENPLAN ANZEIGEN Montag Kein Betrieb Dienstag Kein Betrieb Hesel(Ostfriesl) Schulzentrum Kirchstraße 26b, Hesel Mittwoch Kein Betrieb Hesel(Ostfriesl) B436/Fabrik Donnerstag 12:35 Hesel(Ostfriesl) B436/Fabrik Freitag Kein Betrieb Samstag Kein Betrieb Brinkum(Ostfriesl) Schule Sonntag Kein Betrieb Holtland B 436/Kreuzung Kleinbahnstraße, Holtland Holtland Grundschule Bus Linie 638 Info Siebestock Meier Richtung: Brückenfehn Stationen: 20 Hasselter Vorwerk Fahrtdauer: 40 Min Alte Kreisstraße 2, Germany Linien Informationen: Hesel(Ostfriesl) Schulzentrum, Hesel(Ostfriesl) B436/Fabrik, Hasselt(Ostfriesl) H. Duin Hesel(Ostfriesl) B436/Fabrik, Brinkum(Ostfriesl) Hasselter Straße 6, Germany Schule, Holtland B 436/Kreuzung, Holtland Grundschule, Siebestock Meier, Hasselter Vorwerk, Hasselt(Ostfriesl) A. Duin Hasselt(Ostfriesl) H. Duin, Hasselt(Ostfriesl) A. Duin, Lammertsfehn Schule, Lammertsfehn Abzw. Lammertsfehn Schule Selverde, Stallbrüggerfeld Duin, Stallbrüggerfeld Herrenmoorweg, Stallbrüggerfeld Janssen, Friesenstraße 41, Germany Stallbrüggerfeld Wergenweg, Busboomsfehn Dreieck, Lammertsfehn Abzw. Selverde Filsum Leeraner-/Deterner -

Zentrum Für Arbeit 04922 / 303 - 0
Städte und Gemeinden So finden Sie uns Landkreis Leer Stadt Borkum Zentrum für Arbeit 04922 / 303 - 0 Gemeinde Bunde 04953 / 809 – 0 Samtgemeinde Hesel Zentrum für Arbeit 04950 / 39 - 0 Gemeinde Jemgum 04958 / 9181 – 0 Samtgemeinde Jümme 04957 / 9180 – 0 Stadt Leer 0491 / 9782 – 0 Gemeinde Moormerland Zentrum für Arbeit 04954 / 801 – 0 Bavinkstraße 23 Gemeinde Ostrhauderfehn 26789 Leer 04952 / 805 – 0 Gemeinde Rhauderfehn Telefon: 0491 / 9994 – 0 04952 / 903 – 0 Fax: 0491 / 9994 – 2999 Gemeinde Uplengen E-Mail: [email protected] 04956 / 9117 – 0 Internet: www.zfa-leer.de Stadt Weener 04951 / 305 – 0 Unsere Öffnungszeiten: Gemeinde Westoverledingen 04955 / 933 – 0 Mo – Fr 08.00 Uhr – 12.30 Uhr außerdem Do 14.00 Uhr – 17.00 Uhr Unsere Partner in der Bavinkstraße Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Pro Aktiv Center (PACE) Der Weg Absprache möglich. 0491 / 9994 – 2217 zurück in die Familienservice Weser-Ems e.V. Unser Empfang ist Montags bis Donnerstags von 0491 / 9994 – 2308 08.00 – 17.00 Uhr und am Freitag von 08.00 – Arbeitswelt 12.30 Uhr für Sie besetzt. Schuldnerberatungsstelle des Synodalverband IV 0491 / 9994 - 2900 Stand August 2008 Kontakte Über uns Unsere Leistungen in der Bavinkstraße Unsere Leistungen in den Gemeinden Wir als Landkreis Leer sind eine von 69 Optionskommunen Im Zentrum für Arbeit in der Bavinkstraße in Leer kümmern Das Sozialgesetzbuch II ist Grundlage für die finanziellen in Deutschland, die seit 2005 alleinverantwortlich zuständig sich Arbeitsvermittler/-innen, Fallmanager/-innen, Leistungen im Rahmen des Arbeitslosengeld II. sind für die Beratung, Vermittlung und Betreuung von Akquisiteure / Akquisiteurinnen und Projektmitarbeiter/-innen hilfebedürftigen, arbeitsuchenden Menschen.