Rothe Erde Und Eilendorf Geschichte Des Stadtteils Rothe Erde Aus Der Sammlung Peter Packbier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Euregiobahn
Stolberg-Mühlener Bahnhof – Stolberg-Altstadt 2021 > Fahrplan Stolberg Hbf – Eschweiler-St. Jöris – Alsdorf – Herzogenrath – Aachen – Stolberg Hbf Eschweiler-Talbahnhof – Langerwehe – Düren Bahnhof/Haltepunkt Montag – Freitag Mo – Do Fr/Sa Stolberg Hbf ab 5:11 6:12 7:12 8:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 23:12 usw. x Eschweiler-St. Jöris ab 5:18 6:19 7:19 8:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19 23:19 alle Alsdorf-Poststraße ab 5:20 6:21 7:21 8:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 23:21 60 Alsdorf-Mariadorf ab 5:22 6:23 7:23 8:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23 23:23 Minu- x Alsdorf-Kellersberg ab 5:24 6:25 7:25 8:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 23:25 ten Alsdorf-Annapark an 5:26 6:27 7:27 8:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 23:27 Alsdorf-Annapark ab 5:31 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:32 23:32 Alsdorf-Busch ab 5:33 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:34 23:34 Herzogenrath-A.-Schm.-Platz ab 5:35 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:36 23:36 Herzogenrath-Alt-Merkstein ab 5:38 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:39 23:39 Herzogenrath ab 5:44 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:45 21:14 21:44 22:14 22:44 23:43 23:43 Kohlscheid ab 5:49 6:19 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:49 23:49 Aachen West ab 5:55 6:25 6:55 -
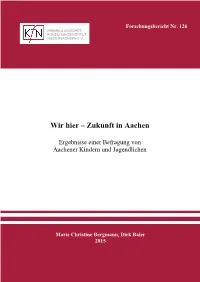
Wir Hier – Zukunft in Aachen
Forschungsbericht Nr. 126 KRIMINOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT NIEDERSACHSEN E.V. Forschungsbericht Nr. 102 Wir hier – Zukunft in Aachen Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Marie Christine Bergmann, Dirk Baier 2015 1 2 __________________________________________________ FORSCHUNGSBERICHT Nr. 126 _____________________________________ _____________ Wir hier – Zukunft in Aachen Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Marie Christine Bergmann, Dirk Baier 2015 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) Lützerodestraße 9, 30161 Hannover Tel. (05 11) 3 48 36-0, Fax (05 11) 3 48 36-10 E-Mail: [email protected] 3 4 Inhaltsverzeichnis 1. Ergebniszusammenfassung ...................................................................................................... 7 2. Befunde der Befragung von Schülern der neunten Jahrgangsstufe ................................... 11 2.1. Methode und Stichprobenbeschreibung ............................................................................. 11 Exkurs: Integration von Migrantenjugendlichen ....................................................................... 17 2.2. Lebenslagen Aachener Jugendlichen ................................................................................. 20 2.2.1. Einschätzungen zu Aachen: Gegenwart und Zukunft ................................................. 20 Gegenwart in Aachen ........................................................................................................ 21 Zukunft in Aachen -

Sozialplanung- Gesamtbericht 2018 (PDF)
Sozialräume der StädteRegion Aachen Anlage zur Sitzungsvorlage± Nr. 2018/0031 B 5 Baesweiler Sozialplanung B 4b B 4a B 3b B 3a B 2 H 3 H 1 B 1 Alsdorf A 1b Herzogenrath H 2 A 11a A 3 A 1a H 4 A 4 A 1b A 2a H 5 A 2b A 5 H 6 A 11b A 6 A 8 H 7 A 10 A 9 A 7 E 2 W 8 H 8 E 1 H 9 W 7 W 1 H 10 Eschweiler AC 9 W 6 W 4 E 3 H 11 E 5 W 2 E 6 E 7 W 5 E 8 E 4 E 9 W 3 Würselen E 10 E 13 E 11 E 12 AC 10 AC 8 AC 1 E 14 S 1 E 15 AC 2 S 2 AC 3 AC 7 S 8 S 6 S 9 AC 11 S 3a S 3b S 5 S 10 S 7 AC 6 AC 12 S 4 AC 4 AC 5 S 13 S 12 S 11 S 14 AC 13 Stolberg Aachen S 15 S 16 AC 14 R 1 R 2 SI 2 Roetgen Sozialräume SI 1 StädteRegion SI 3 Aachen M 1 Legende Simmerath Sozialräume Kommunen Monschau M 2 StädteRegion Aachen km 0 1 2 4 6 8 10 Bearbeiter: Christopher Herb (RWTH Aachen) Datum: 14.12.2017 Sozialberichterstattung StädteRegion Aachen 2018 – Gesamtbericht – Soziale Region Aktive Region Nachhaltige Region BildungsRegion Sozialberichterstattung StädteRegion Aachen 2018 - Gesamtbericht - Impressum ©StädteRegion Aachen (Hrsg.) Amt für Inklusion und Sozialplanung Aachen, Februar 2018 Fördergeber: Gliederung Vorwort und Einleitende Bemerkung der Dezernentin für Soziales und Gesundheit…………………………….. -

Belgien Belgien Niederlande
431 Grotenrath Post Broich Welldorf 1 1 Abzw. Windhausen Floverich Grünstr. 8 P 8 1 Setterich 7 Merzenhausen 2 Ü 2 7 9 2 2 Geilenkirchen 4 Übach-Palenberg4 Scherpenseel Geilenkirchen Geilenkirchen Geilenkirchen Geilenkirchen Linnich Linnich 8 9 Freialdenhoven Linnich Titz 9 Floverich Merzenhausen Denkmal 1 1 4 Puffendorfer Setterich Siedlung Am Erbbusch 3 Geilenkirchen 2 Str. Linnich Jülich Kreuz 3 Jugendtreff 51 151 3 B Frelenberg 69 Rur > Liniennetzplan R 2021 Scherpenseel Sandberg Merzenhausen , Hasenfelder Str. 4 E BW1 Scherpenseel 55 R Paul-Keller-Str. Loverich Schule 78 Scherpenseel Schule Kirche Marienstr. Wurmtal 54 Setterich Setterich Freialdenhoven Freialdenhoven 491 Rathaus Post Koslar Kreisbahnstr. 79 7 An den Aspen Röntgenstr. Wurmtalbrücke Carolus- 1 Loverich Setterich Ost Lindenend Beggendorf Koslar Magnus-Allee 1 7 1 Solar Campus Marienberg Carlstr. W 1 Koslar Bürgerhalle Scherpenseel B 5 1 Wurm ÜP1 5 Städtischer 1 0 Neue Mitte Setterich 491 491 8 2 RB2 Grenze 2 3 431 4 Neue Weide 1 Friedhof Übach-Palenberg 21 Übach-Palenberg Beggendorf 78 430 Lich-Steinstraß Beggendorf Theodor-Heuss-Str. 0 Mühlen- Bahnstr. Jülich Nord 2 Am Wasser- B 0 Am Ringofen S 2 0 Wasserturm Kirche 2 7 Matthiasplatz weg 7 B 1 S Übach-Palenberg Bf turm 270 Zitadelle ÜP1 430 431 Friedrich- Im Weinkeller Titz 21 Schlehdornweg Ebert-Str. Schloss Zweibrüggen 433 491 430 Max-Planck-Str. 21 Talstr. 431 Wehrhahnhof Achtung! Ebene „Druck 2 - Region Aachen“ Borsigstr. 216 220 223 238 270 491 6 0 Place de Montesson 0 431 Gewerbegebiet ITS 2 Übach 2 B 2 Rimburger Ev. Kirche Maastrichter Jülich Krankenhaus S 1 1 0 2 SB20 SB70 1 Markt 1 279 281 284 294 5 8 3 W 7 Holthausen 5 1 Acker Str. -

Aussenstellen Schweb MA Portal Ausweisverlaengerungen
Stand: August 2016 Außenstellen Schweb-Ausweise (Verlängerungen etc.) Dienststelle Name Telefon Straße PLZ Ort Mailadresse Stadt Aachen Bürgerservice Frau Vera Krause 0241 432-1210 Hackländer Str. 1 Aachen [email protected] Bezirksamt Brand Stadt Aachen (Service-Infostelle) Frau Birgit Wiegmann 0241 432-8131 Paul-Küpper-Platz 1 52078 Aachen [email protected] Service Infostelle Frau Martina Press Vertr.v. Fr. W. 432-8131 [email protected] Frau Müfide Basegmez 432-8135 [email protected] Frau Verena Schoeller 432-8150 [email protected] Stadt Aachen Bezirksamt Eilendorf Frau Therese Stenten 0241 432-8216 Heinrich-Thomas-Platz 1 52080 Aachen [email protected] Frau Bettina Schmitz 432-8217 [email protected] Stadt Aachen Bezirksamt Haaren Frau Doris Savelsberg 0241 432-8337 Germanusstr. 32-34 52080 Aachen [email protected] Herr Marko Krings 432-8336 [email protected] Frau Ingrid Ursel 432-8345 [email protected] Info-Stelle (macht auch Beratungen) Frau Michaela Havertz 432-8309 [email protected] Bezirksamt Stadt Aachen Kornelimünster/Walheim Frau Ruth Breuer 0241 432-8430 Schulberg 20 52076 Aachen [email protected] Frau Maria Kessel 432-8433 [email protected] Stadt Aachen Bezirksamt Laurensberg Frau Annemarie Guddat 0241 432-8510 Rathausstr. 12 52072 Aachen [email protected] Herr Tim Schumacher 432-8533 [email protected] Frau Andrea Lohbusch 432-8511 [email protected] Frau Melanie Schwan 432-8522 [email protected] Stadt Aachen Bezirksamt Richterich Frau Juliane Brüsseler 0241 432-8622 Roermonder Str. -

Dfbnet - Spielplan 26.07.2016 14:20
DFBnet - Spielplan 26.07.2016 14:20 Saison : 16/17 Staffel : 001 Kreisliga D Staffel 1 Verband : Fußball-Verband Mittelrhein Kennung : 230117 Mannschaftsart : 013 Herren Status : Spiele geplant Spielklasse : 058 Kreisliga D Staffelleiter : Yannick Longerich Spielgebiet : 007 Kreis Aachen Telefon : 01578-5075712 Rahmenspielplan : 1 E-Mail : [email protected] Sptg. Spielkennung Heimmannschaft Gastmannschaft Zeit/Tore Spielstätte Spielleitung Assistent 1 Assistent 2 Sonntag, 21.08.2016 1 230117001 Rasensport Brand III Sportfreunde Hörn III 11:00 Sportanlage Wolferskaul (Kunstrasen) 1 230117002 OSV Orsbach II VfL 05 Aachen II 11:00 Sportplatz Bungartsweg 1 230117003 BW Alsdorf II FV Vaalserquartier IV 11:00 Sportplatz Alsdorf-Nord 1 230117004 Borussia Brand II Arminia Eilendorf III 11:00 Schulzentrum Rombachstr. 1 230117005 SV Eilendorf IV VfJ Laurensberg II 13:00 Kunstrasenplatz Halfenstadion 1 230117006 JSC Blau-Weiss Aachen II Schwarz-Rot Aachen 15:00 Ludwig-Kuhnen-Stadion Sonntag, 28.08.2016 2 230117009 FV Vaalserquartier IV OSV Orsbach II 13:00 Kunstrasenplatz Alte Vaalser Str. 2 230117010 VfL 05 Aachen II Rasensport Brand III 13:00 Sportplatz Steinebrück 2 230117011 Munzurspor Aachen Borussia Brand II 15:00 Sportplatz SG Aachen 2 230117012 Rhenania Rothe Erde BW Alsdorf II 15:00 Sportplatz Rothe Erde 2 230117013 Sportfreunde Hörn III JSC Blau-Weiss Aachen II 15:00 Josef Glockner Sportanlage 2 230117014 Schwarz-Rot Aachen SV Eilendorf IV 15:00 Sportplatz Breslauer Str. Sonntag, 04.09.2016 3 230117017 Rasensport Brand III FV Vaalserquartier IV 11:00 Sportanlage Wolferskaul (Kunstrasen) 3 230117018 OSV Orsbach II Rhenania Rothe Erde 11:00 Sportplatz Bungartsweg 3 230117019 BW Alsdorf II Arminia Eilendorf III 11:00 Sportplatz Alsdorf-Nord 3 230117020 Borussia Brand II VfJ Laurensberg II 11:00 Schulzentrum Rombachstr. -

UF00047649 ( .Pdf )
Digitized with the permission of the FLORIDA DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS FLORIDA NATIONAL GUARD SOURCE DOCUMENT ADVISORY Digital images were created from printed source documents that, in many cases , were photocopies of original materials held elsewhere. The quality of these copies was often poor. Digital images reflect the poor quality of the source documents. Where possible images have been manipulated to make them as readable as possible. In many cases such manipulation was not possible. Where available, the originals photocopied for publication have been digitized and have been added, separately, to this collection. Searchable text generated from the digital images , subsequently, is also poor. The researcher is advised not to rely solely upon text-search in this collection. RIGHTS & RESTRICTIONS Items collected here were originally published by the Florida National Guard, many as part of its SPECIAL ARCHIVES PUBLICATION series. Contact the Florida National Guard for additional information. The Florida National Guard reserves all rights to content originating with the Guard . DIGITIZATION Titles from the SPECIAL ARCHIVES PUBLICATION series were digitized by the University of Florida in recognition of those serving in Florida's National Guard , many of whom have given their lives in defense of the State and the Nation. FLORIDA DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS Special Archives Publication Number 136 SUMMARY HISTORIES: WORLDWARII AIRBORNE AND ARMOURED DMSIONS State Arsenal St. Francis Barracks St. Augustine, Florida STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL POST OFFICE BOX 1008 STATE ARSENAL, ST. AUGUSTINE 32085-1008 These Special Archives Publications are produced as a service to Florida communities, historians and any other individuals, historical or geneaological societies and both national and state governmental agencies which find the information contained therein of use or value. -

Haaren Integriertes Handlungs- Konzept
Haaren Integriertes Handlungs- konzept www.aachen.de/haaren Impressum Herausgeber: Stadt Aachen - Der Oberbürgermeister Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Bearbeitung: 61/500 Stadterneuerung und Stadtgestaltung Gertrude Helm Marie Blanzé Isabelle Mehlhorn www.aachen.de/haaren Externe Beiträge: archigraphus - architektur & raumkonzepte Markus Ulrich, Joachim Schmidt, Andreas Kantartzis www.archigraphus.de 3+ Freiraumplaner Prof. Norbert Kloeters, Heinz W. Rohn www.3plusfreiraumplaner.de hks I architekten Jochen König www.hks-architekten.de Ein besonderer Dank geht an alle Haarener Ak- teure und die Bezirksvertretung Haaren, die mit ihrem großartigen Engagement zur Entwicklung des Integrierten Handlungskonzeptes beigetra- gen haben. Frau Gisela Nacken als Dezernentin für Planung und Umwelt danken wir für ihre tatkräftige Unterstützung bei der erfolgreichen Beantragung der Fördermittel sowie die konti- nuirliche Begleitung des Prozesses. Aachen, Februar 2014 gefördert durch: Haaren hat eine gute Lage, Infrastruktur und Nahversorgung. Haaren ist zugleich laut und räumlich begrenzt. Haaren altert und hat einen eigenen Charakter, der das Zusammenleben im Stadtbezirk prägt. Gruß- worte Vorwort Stadtbaurat Werner Wingenfeld Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! Nachdem die Bezirksvertretung Haaren und Für Ihr großes bürgerschaftliches Engagement der Planungsausschuss Anfang 2004 mit ihrer möchte ich mich bereits jetzt bedanken. Beschlussfassung u.a. zur Aufgabe der Haare- ner Allee die Voraussetzung geschaffen haben, Es spiegelt sich in der großen Bandbreite an die städtebauliche Entwicklung von Haaren verschiedenen Ideen und Vorschlägen wieder, in eine neue Richtung zu lenken, ging es in die als Ergebnis der Einbindung von Bürgerin- den letzten Jahren darum, die Perspektiven zu nen und Bürgern, von Vereinen, der Haarener konkretisieren. Daher freue ich mich, Ihnen den Politik und anderen Einrichtungen in das Kon- entwickelten Rahmenplan und das zugehörige zept eingeflossen sind. -

Bus Linie 70 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 70 Fahrpläne & Netzkarten 70 Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) - Aachen, Im Website-Modus Anzeigen Uniklinik Die Bus Linie 70 (Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) - Aachen, Uniklinik) hat 6 Routen (1) Aachen Bf. rothe Erde: 05:47 - 18:06 (2) Aachen, Uniklinik: 06:09 - 18:11 (3) Aachen, Vaalserquartier Vaals Grenze: 09:10 - 16:11 (4) Berensberg: 10:02 - 12:02 (5) Laurensberg Schulzentrum: 07:28 - 13:08 (6) Prager Ring: 19:06 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 70 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 70 kommt. Richtung: Aachen Bf. Rothe Erde Bus Linie 70 Fahrpläne 38 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Aachen Bf. rothe Erde LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 05:47 - 18:06 Dienstag 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Vaals Grenze Püngelerstraße 1, Aachen Mittwoch 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Keltenstraße Donnerstag 05:47 - 18:06 Alte Vaalser Straße 50, Aachen Freitag 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Schmiedgasse Samstag Kein Betrieb Alte Vaalser Straße 10, Aachen Sonntag Kein Betrieb Aachen, Philipp-Neri-Weg (Reutershag) Schurzelter Straße 567, Aachen Aachen, Kullen Hans-Böckler-Allee 2, Aachen Bus Linie 70 Info Richtung: Aachen Bf. Rothe Erde Aachen, Steinbergweg Stationen: 38 Hans-Böckler-Allee 109, Aachen Fahrtdauer: 40 Min Linien Informationen: Aachen, Vaalserquartier Aachen, Uniklinik Vaals Grenze, Aachen, Vaalserquartier Keltenstraße, Aachen, Vaalserquartier Schmiedgasse, Aachen, Aachen, Worringer Weg Philipp-Neri-Weg (Reutershag), Aachen, Kullen, Pauwelsstraße 20, Aachen Aachen, -

Bericht Region Aachen-Stadt 303 KB14.02.20
Abschlussbericht des Regionalteams Aachen-Stadt nach der Analysephase im Heute-bei-dir-Prozess - Korrigierte und ergänzte Fassung von Febr. 2020 - Bericht des Regionalteams Aachen-Stadt zum Ende der Analysephase Eigene Zielformulierung • Kennenlernen der Region, aller GdG`s, vieler Einrichtungen und Initiativen, möglichst aller pastoralen Mitarbeiter/-innen; • uns selbst als neues Regionalteam bekanntmachen und Vertrauen schaffen,mögliche Widerstände gegenüber dem Prozess ernst nehmen. • Sichtung und wohl möglich Sicherung der Funktionsfähigkeit von Einzelprojekten und pastoralen Feldern in den GdG`s • langfristig Vernetzungen herstellen (Ressourcen bündeln) • Identifikation relevanter Themen Was wurde gemacht? - Wer wurde besucht? • Alle GdG - Räte: Vorstellung des Regionalteams und des um vier ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen erweiterten „Prozessteams“; Infos zum Heute-bei-dir-Prozess und zu unserer Fragebogen-Aktion • persönliche Gespräche mit (fast) allen pastoralen Mitarbeiter / -innen in den GdG`s und Einrichtungen in der Region über: Arbeitsbereiche, Zusammenarbeit mit anderen „Playern“, Wünsche und Anmerkungen zum Heute-bei-dir-Prozess • Fragebogen-Aktion – verteilt über die GdG - Räte – Antworten von Einzelpersonen bis Gremien • Besuch einzelner Verbände, Einrichtungen und Initiativen z.B. ProArbeit, Regionaler Caritasverband, Gemeinschaft christlichen Lebens, Benediktinerabtei Kornelimünster, Gemeinschaft Sant' Egidio … • Neben den Tätigkeiten im Rahmen des Prozesses Richtung Prozess auch diverse Aufgaben im Regelgeschäft der Region, z.B. regelmäßige Teilnahme am Regionalen Pastoralrat, die Begleitung der Administration der Pfarre St. Josef und Fronleichnam (GdG AC - Ost / Eilendorf), Gespräche mit GdG - Leitern und pastoralen Mitarbeitern • Teilnahme an einzelnen regionalen pastoralen Veranstaltungen: „Maria 2.0 im Gottesdienst“ mit Auswertung einer Fragen-Aktion zum Thema: in St. Gregorius (AC - Burtscheid) am 19.05.2019 und bei der kfd (katholische Frauengemeinschaft Deutschland) - Veranstaltung am 8. -
Strikt-Konzept.Pdf
!"#!"#!"#$ % & '%&($ % & '%&($ % & '%&()* +')* +')* +' + +, ,,,' + % ' + % ' + % ,,,, (- .++ (- .++ & /01& /01& 2 2 4 & 4 &4 &5665665667777 . $ Inhaltsverzeichnis Seite 1 Vorbemerkungen 1 1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 1 1.2 Methodische Vorgehensweise und Primärerhebungen 2 1.2.1 Angebotsanalyse 2 1.2.2 Nachfrageanalyse 3 2 Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung 4 2.1 Siedlungsräumliche und demographische Strukturen 4 2.2 Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in der StädteRegion 7 3 Einzelhandelsstrukturen in der StädteRegion 9 3.1 Überblick 9 3.1.1 Betriebe - Verkaufsflächen - Umsätze 9 3.1.2 Großflächiger Einzelhandel 12 3.1.3 Wohnungsnahe Versorgung 14 3.1.4 Einkaufsorientierung in der StädteRegion 17 3.1.5 Einzelhandelszentralitäten der Kommunen in der StädteRegion 19 3.2 Standortprofile der Kommunen in der StädteRegion 23 3.2.1 Stadt Aachen 23 3.2.1.1 Einzelhandelssituation im Überblick 23 3.2.1.2 Zentrale Versorgungsbereiche 28 3.2.1.3 Wohnungsnahe Grundversorgung in der Stadt Aachen 34 3.2.2 Stadt Alsdorf 35 3.2.2.1 Einzelhandelssituation im Überblick 35 3.2.2.2 Zentrale Versorgungsbereiche 40 3.2.2.3 Wohnungsnahe Grundversorgung in der Stadt Alsdorf 42 I 3.2.3 Stadt Baesweiler 43 3.2.3.1 Einzelhandelssituation im Überblick 43 3.2.3.2 Zentrale Versorgungsbereiche 48 3.2.3.3 Wohnungsnahe Grundversorgung in der Stadt Baesweiler 51 3.2.4 Stadt Eschweiler 52 3.2.4.1 Einzelhandelssituation im Überblick 52 3.2.4.2 -
Aachen Bushof ˜ Gierstraße ˜ Kellershaustraße ˜ Minoritenstraße ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Zentis ˜ Driescher Gässchen (Techn
Kohlscheid Bank Brand − Gewerbegebiet Eilendorf Süd − Normaluhr − Aachen Bushof − Laurensberg − Vetschau 27 Richterich Roder Weg Haltestellen: Haltestellen (Fortsetzung): Haltestellen (Fortsetzung): ¸ Brand ˜ Schlossstraße ˜ Vetschau Bocholtzer Straße ˜ Brand Ringstraße ˜ Normaluhr ˜ Vetschau ˜ Richard-Wagner-Str. (Columbarium) ˜ Wallstraße ˜ Vetschau Schmiede ˜ Am Tiergarten ˜ Theater ˜ Richterich Lütterbüschgen ˜ Erberichshofstraße ˜ Elisenbrunnen ˜ Pfalzgrafenstraße ˜ Hermann-Löns-Straße ˜ UM Aachen Bushof ˜ Gierstraße ˜ Kellershaustraße ˜ Minoritenstraße ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Zentis ˜ Driescher Gässchen (Techn. Hochschule) ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Debyestraße ˜ Ponttor ˜ Richterich Kirche ˜ Gut Weide ˜ Bendplatz ˜ Hander Weg ˜ Zieglerstraße ˜ Jupp-Müller-Straße ˜ Richterich Rathaus ˜ Rödgerbach ˜ Laurensberg Wildbach ˜ Schloss-Schönau-Straße ˜ Meisenweg ˜ Laurensberg ˜ Richterich Schönauer Friede ˜ Schwalbenweg ˜ Laurensberg Rathaus ¸ Richterich Roder Weg ˜ Drosselweg ˜ Pannhauser Straße ˜ Richterich Dellstraße ˜ Adenauerallee ˜ Laurentiusstraße ˜ Bank Finkenstraße ˜ Zeppelinstraße ˜ Laurensberg Kirche ˜ Bank ˜ Bahnhof Rothe Erde ˜ Laurensberg Schulzentrum ˜ Amstelbach ˜ Goerdelerstraße ˜ Vetschauer Berg ¸ Bank Bachstraße ˜ Viktoriaallee ˜ Niersteiner Höfe Beachten Sie bitte unsere Sonderfahrpläne an Heiligabend/Weihnachten, Silvester/Neujahr und Karneval. 27 313 314 Kohlscheid Bank Brand − Gewerbegebiet Eilendorf Süd − Normaluhr − Aachen Bushof − Laurensberg − Vetschau 27 27 Richterich Roder Weg montags bis freitags