Zur Geschichte Des Kirchenliedes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Now Let Us Come Before Him Nun Laßt Uns Gehn Und Treten 8.8
Now Let Us Come Before Him Nun laßt uns gehn und treten 8.8. 8.8. Nun lasst uns Gott, dem Herren Paul Gerhardt, 1653 Nikolaus Selnecker, 1587 4 As mothers watch are keeping 9 To all who bow before Thee Tr. John Kelly, 1867, alt. Arr. Johann Crüger, alt. O’er children who are sleeping, And for Thy grace implore Thee, Their fear and grief assuaging, Oh, grant Thy benediction When angry storms are raging, And patience in affliction. 5 So God His own is shielding 10 With richest blessings crown us, And help to them is yielding. In all our ways, Lord, own us; When need and woe distress them, Give grace, who grace bestowest His loving arms caress them. To all, e’en to the lowest. 6 O Thou who dost not slumber, 11 Be Thou a Helper speedy Remove what would encumber To all the poor and needy, Our work, which prospers never To all forlorn a Father; Unless Thou bless it ever. Thine erring children gather. 7 Our song to Thee ascendeth, 12 Be with the sick and ailing, Whose mercy never endeth; Their Comforter unfailing; Our thanks to Thee we render, Dispelling grief and sadness, Who art our strong Defender. Oh, give them joy and gladness! 8 O God of mercy, hear us; 13 Above all else, Lord, send us Our Father, be Thou near us; Thy Spirit to attend us, Mid crosses and in sadness Within our hearts abiding, Be Thou our Fount of gladness. To heav’n our footsteps guiding. 14 All this Thy hand bestoweth, Thou Life, whence our life floweth. -
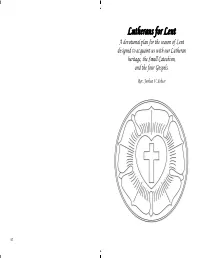
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

500Th Anniversary of the Lutheran Reformation
500TH ANNIVERSARY OF THE LUTHERAN REFORMATION L LU ICA TH EL ER G A N N A S V Y E N E O H D T LUTHERAN SYNOD QUARTERLY VOLUME 57 • NUMBERS 2 & 3 JUNE & SEPTEMBER 2017 The journal of Bethany Lutheran Theological Seminary ISSN: 0360-9685 LUTHERAN SYNOD QUARTERLY VOLUME 57 • NUMBERS 2 & 3 JUNE & SEPTEMBER 2017 The journal of Bethany Lutheran Theological Seminary LUTHERAN SYNOD QUARTERLY EDITOR-IN-CHIEF........................................................... Gaylin R. Schmeling BOOK REVIEW EDITOR ......................................................... Michael K. Smith LAYOUT EDITOR ................................................................. Daniel J. Hartwig PRINTER ......................................................... Books of the Way of the Lord The Lutheran Synod Quarterly (ISSN: 0360-9685) is edited by the faculty of Bethany Lutheran Theological Seminary 6 Browns Court Mankato, Minnesota 56001 The Lutheran Synod Quarterly is a continuation of the Clergy Bulletin (1941–1960). The purpose of the Lutheran Synod Quarterly, as was the purpose of the Clergy Bulletin, is to provide a testimony of the theological position of the Evangelical Lutheran Synod and also to promote the academic growth of her clergy roster by providing scholarly articles, rooted in the inerrancy of the Holy Scriptures and the Confessions of the Evangelical Lutheran Church. The Lutheran Synod Quarterly is published in March and December with a combined June and September issue. Subscription rates are $25.00 U.S. per year for domestic subscriptions and $35.00 U.S. per year for international subscriptions. All subscriptions and editorial correspondence should be sent to the following address: Bethany Lutheran Theological Seminary Attn: Lutheran Synod Quarterly 6 Browns Ct Mankato MN 56001 Back issues of the Lutheran Synod Quarterly from the past two years are available at a cost of $10.00 per issue. -

Concordia Journal Fall 2011 Volume 37 | Number 4 Concordia Seminary Concordia Seminary Place 801 MO 63105 St
Concordia Seminary Concordia Journal 801 Seminary Place St. Louis, MO 63105 COncordia Fall 2011 Journal volume 37 | number 4 Fall 2 01 1 volume 37 | number Oral Performance of Biblical Texts in the Early Church Publishing Authority: 4 The Text of the Book of Concord A Bibliography of the 1580 Dresden Concordia COncordia CONCORDIATHEOLOGY.ORG Journal Faculty blogs on current events, multimedia, preaching (ISSN 0145-7233) resources, articles and archives…all in one place. publisher Faculty Dale A. Meyer David Adams Erik Herrmann Victor Raj President Charles Arand Jeffrey Kloha Paul Robinson Andrew Bartelt R. Reed Lessing Robert Rosin Keep up with what’s new Executive EDITOR Joel Biermann David Lewis Timothy Saleska William W. Schumacher Gerhard Bode Richard Marrs Leopoldo Sánchez M. on Facebook and Twitter. Dean of Theological Kent Burreson David Maxwell David Schmitt Research and Publication William Carr, Jr. Dale Meyer Bruce Schuchard www.facebook.com/ EDITOR Anthony Cook Glenn Nielsen William Schumacher Travis J. Scholl Timothy Dost Joel Okamoto William Utech concordiatheology Managing Editor of Thomas Egger Jeffrey Oschwald James Voelz Theological Publications Jeffrey Gibbs David Peter Robert Weise Bruce Hartung Paul Raabe twitter.com/csltheology EDITORial assistant Melanie Appelbaum Exclusive subscriber digital access All correspondence should be sent to: via ATLAS to Concordia Journal & assistants CONCORDIA JOURNAL Concordia Theology Monthly: Carol Geisler 801 Seminary Place http://search.ebscohost.com Theodore Hopkins St. Louis, Missouri 63105 User ID: ATL0102231ps Check out our mobile site Melissa LeFevre 314-505-7117 Password: subscriber Technical problems? for theology on-the-go. Matthew Kobs cj @csl.edu Email [email protected] Issued by the faculty of Concordia Seminary, St. -
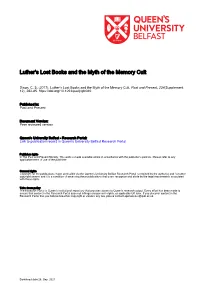
Luther's Lost Books and the Myth of the Memory Cult
Luther's Lost Books and the Myth of the Memory Cult Dixon, C. S. (2017). Luther's Lost Books and the Myth of the Memory Cult. Past and Present, 234(Supplement 12), 262-85. https://doi.org/10.1093/pastj/gtx040 Published in: Past and Present Document Version: Peer reviewed version Queen's University Belfast - Research Portal: Link to publication record in Queen's University Belfast Research Portal Publisher rights © The Past and Present Society. This work is made available online in accordance with the publisher’s policies. Please refer to any applicable terms of use of the publisher General rights Copyright for the publications made accessible via the Queen's University Belfast Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The Research Portal is Queen's institutional repository that provides access to Queen's research output. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact [email protected]. Download date:26. Sep. 2021 1 Luther’s Lost Books and the Myth of the Memory Cult C. Scott Dixon On the morning of 18 February 1546, in his birthplace of Eisleben, Martin Luther died of heart failure. Just as Johann Friedrich, Elector of Saxony, had feared, and Luther himself had prophesied, his trip to the duchy of Mansfeld to settle a jurisdictional dispute had proven too much. -

Bibliografie
Veröffentlichungen: Prof. Dr. Inge Mager 1) Georg Calixts theologische Ethik und ihre Nachwirkungen, SKGNS 19, Göttingen 1969 2) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 3: Ethische Schriften, Göttingen 1970 3) Theologische Promotionen an der Universität Helmstedt im ersten Jahrhundert des Bestehens, JGNKG 69, 1971, 83–102 4) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 4: Schriften zur Eschatologie, Göttingen 1972 5) Conrad Hornejus, NDB 9, 1972, 637f. 6) Lutherische Theologie und aristotelische Philosophie an der Universität Helmstedt im 16. Jahrhundert. Zur Vorgeschichte des Hofmannschen Streites im Jahre 1598, JGNKG 73, 1975, 83–98 7) Bibliographie zur Geschichte der Universität Helmstedt, JGNKG 74, 1976, 237–242 8) Reformatorische Theologie und Reformationsverständnis an der Universität Helmstedt im 16. und 17. Jahrhundert, JGNKG 74, 1976, 11–33 9) Timotheus Kirchner, NDB 11, 1977, 664f. 10) Das Corpus Doctrinae der Stadt Braunschweig im Gefüge der übrigen niedersächsischen Lehrschriftensammlungen, in: Die Reformation in der Stadt Braunschweig. Festschrift 1528–1978, Braunschweig 1978, 111–122.139–143 11) Georg Calixt, Werke in Auswahl, Bd. 1: Einleitung in die Theologie, Göttingen 1978 12) Die Beziehung Herzog Augusts von Braunschweig–Wolfenbüttel zu den Theologen Georg Calixt und Johann Valentin Andreae, in: Pietismus und Neuzeit 6, Göttingen 1980, 76–98 13) Calixtus redivivus oder Spaltung und Versöhnung. Das Hauptwerk des nordfriesischen Theologen Heinrich Hansen und die Gründung der Hochkirchlichen Vereinigung im Jahre 1918, Nordfries. Jb., N.F. 16, 1980, 127–139 14) Aufnahme und Ablehnung des Konkordienbuches in Nord–, Mittel– und Ostdeutschland, in: Bekenntnis und Einheit der Kirche, hrsg. v. M.Brecht u. R.Schwarz, Stuttgart 1980, 271–302 15) Brüderlichkeit und Einheit. -

Communion in Growth
Communion in Growth Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry A Report from the Lutheran-Catholic Dialogue Commission for Finland Communion in Growth Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry A Report from the Lutheran-Catholic Dialogue Commission for Finland Evangelical Lutheran Church of Finland Catholic Church in Finland Helsinki 2017 Communion in Growth Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry A Report from the Lutheran-Catholic Dialogue Commission for Finland © Evangelical Lutheran Church of Finland Catholic Church in Finland Language editor: Rupert Moreton, Lingua Fennica Book design: Unigrafia/ Hanna Sario Layout: Emma Martikainen Photo: Heikki Jääskeläinen: Icon of St. Henry the martyr, the first bishop in Finland by bishop Arseni of Joensuu ISBN 978-951-789-585-9 (paperback) ISBN 978-951-789-586-6 (PDF) Grano Helsinki 2017 CONTENTS Introduction .................................................................................................... 7 The Joint Declaration on the Doctrine of Justification and the Way Forward....................................................................................................... 7 Aim and Method of the Declaration............................................................ 9 I THE CHURCH AS COMMUNION IN THE TRIUNE GOD 1. Communion Ecclesiology as a Shared Framework ...................................... 13 2. The Sacramental Nature of the Church ...................................................... 18 3. The Common Understanding of the Church ............................................ -

Kasvavaa Yhteyttä
Kasvavaa yhteyttä Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta Suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission raportti Kasvavaa yhteyttä Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta Suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission raportti Suomen evankelis-luterilainen kirkko Katolinen kirkko Suomessa Helsinki 2017 Kasvavaa yhteyttä Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta Suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission raportti © Suomen evankelis-luterilainen kirkko Katolinen kirkko Suomessa Englanninkielisen dialogiraportin Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry Suomennos: Tiina Huhtanen, Ilmari Karimies, Tomi Karttunen, Katri Tenhunen (suomennoksen tarkistus) Ulkoasu: Unigrafia / Hanna Sario Taitto: Emma Martikainen Kannen kuva: Heikki Jääskeläisen valokuva Joensuun piispan Arsenin pyhää Henrik Marttyyriä, Suomen ensimmäistä piispaa esittävästä ikonista ISBN 978-951-789-591-0 (nid.) ISBN 978-951-789-592-7 (PDF) Grano Kuopio 2017 SISÄLLYS Johdanto .......................................................................................................... 7 Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista ja tie eteenpäin ............................ 7 Julistuksen tavoite ja metodi ........................................................................ 9 I KIRKKO YHTEYTENÄ KOLMIYHTEISESSÄ JUMALASSA 1. Kommuunio-ekklesiologia yhteisenä viitekehyksenä ................................... 13 2. Kirkon sakramentaalinen luonne ................................................................ 18 3. Yhteinen käsitys -

Kirkeårets Tekster Og Bønner Til Bruk I Menighetens Samling Om Ord Og Sakrament
KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I MENIGHETENS SAMLING OM ORD OG SAKRAMENT 24.10.2016 Kåre Svebak nn 87 KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER Den Hellige Skrift er kristnes katedral, hvor Jesus Kristus er omviseren. Skriftens Herre og innhold hører sammen. Med ham blir kirkeårskalenderen en omvisning i Bibelen. Første rekkes tekster samsvarer med postille-tradisjonen siden reformasjonsti- den. Tekstrekkener tilpasset Svenska Kyrkans utvalg fra 1862 og Den finske evangelisk-lutherske kirkes evangeliebok fra 1969– til fellesnordisk bruk. Tilpas- ningen har noen gjenopprettelser i den norske kirkeårskalenderen. Søndag e Nyttårsdag gir rom for Kristi dåp. Maria Kirkegangsdag (el Kyndelsmess 2.2.) og Maria Budskapsdag (25.3) er Kristus-dager til markering av hovedunderet i frelsens historie – ”unnfanget av Den Hellige Ånd”. Feiringen kan skje på nær- meste lørdag. 5. s i faste har fått tilbake posisjonen som lutherdommens store prekensøndag. Borte er Bots- og bededag – en arv fra statspietismens tid. Prakti- serer vi dåpen, er hver dag en bots- og bededag. Et Inngangsord markerer emnet for dagens lesninger og preken. Introitus-salmene fremføres responsorialt med bibelord fra Nytestamentet. Slik markerer vi at Jesus Kristus er Skriftens Herre og kirkens Lærer, virksom til stede I den forsamlede menighet. (Joh 1:45, 5:39. Lk 16:29, 18:31, 24:27, 44. Apg 17:11, Rom 15:4, 2 Tim 3:15f, 1 Pet 1:11, Åp 19:20.) Bibeloversettelsen følger som regel Bibelselskapets bibelutgave 1978 (2001) og Arvid Tångbergs oversettelse av Salmenes Bok (1995) eller NO 1938. Avvikende benevnelser følger Per Jonssons Svensk Kyrkobibel (Malmõ 1997): ”Helvete” brukt analogt med grunntekstens ord om Guds fiendemakter (sheol, Hades), til forskjell fra antikkens forestilling om de dødes oppbevaringssted, kalt «dødsri- ket». -

An Introduction to the Book of Concord
21st Conference of the International Lutheran Council Berlin, Germany August 27 – September 2, 2005 Almighty God Has Allowed the Light of His Holy Gospel and His Word that Alone Grants Salvation to Appear An Introduction to the Book of Concord Robert Kolb Proclaiming God's Word and Confessing the Faith Sixteenth-century Lutherans believed that they lived in the shadow of the Last Judgment. Because of that they believed that "in the last days of this transitory world he Almighty God, out of immeasurable love, grace, and mercy for the human race, has allowed the light of his holy gospel and his Word that alone grants salvation to appear and shine forth purely, unalloyed and unadulterated out of the superstitious, papist darkness for the German nation . " (Preface of the Book of Concord, 15801). The editors of the Book of Concord reflected the widely held perception of their time that God had sent Martin Luther as his special prophet to proclaim the Gospel of Jesus Christ before his return to judge the world. They also viewed the presentation of Luther's teaching to Emperor Charles V in the Augsburg Confession as a crucial act of God in spreading Luther's message throughout the world. Followers of Luther were convinced that God acts in a fallen world above all through his Word and that the power of the Gospel of Christ rescues sinners from death and restores them to their true humanity as children of God. What the church did with and through God's Word formed the central concern of human history, they believed. -

PDF Musical Excellence: the Spiritual Panacea of the Future
222 HARVARD SQUARE SYMPOSIUM | THE FUTURE OF KNOWLEDGE Musical Excellence: The Spiritual Panacea of the Future Cristian Caraman ABSTracT: The present paper presents The biblical reference points of music, The manifestations of Protestant music culture and The excellence in music. The Protestant music started with Luther, Calvin and continued with Bach, Handel, Brahms, asserting itself in Europe, North America, Africa, and recently in Asia. The Protestant culture, especially the musical one, has penetrated all aspects of civilization, being by far, through its representatives, one of the most powerful spiritual dimensions in human history. The future of a better world consists of a more educated and more sensible generation in which music can make people better. The values of the Protestant–Evangelical music can contribute to the human spiritual dimension and to the beauty of its culture and civilization. KEY WORDS: culture, music, religion, Bible, Protestantism. The Biblical Reference Points of Music Through music, future generations of young people will develop out differenteasier and attitudes they will toward become society the artist and willof thebe ablefuture. to discover Music is the a benefits of art. Furthermore, the groups they are part of will stand correctly and only then how to sing. The study of violin will best developvibration. their The hearing, young voice and the student study will of guitar first learn will gain how the to breathestudent more self-confidence and will gain a bigger power of concentration 222 Caraman: Musical Excellence: The Spiritual Panacea of the Future 223 then the other young people. The grace of playing the violoncello or the piano will in the same time correct the position of the back. -

Musica Poetica in Sixteenth-Century Reformation Germany
Musica Poetica in Sixteenth-Century Reformation Germany WONG,'Heleri]<:in Hoi .' ,. :,... ... ",-j." ... _ t.,~ . t " A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Mas'ter of Philosophy In Music The Chinese University of Hong Kong December 2009 Thesis Committee Professor OLSON Greta Jean (Chair) Professor Michael Edward MCCLELLAN (Thesis Supervisor) Professor Victor Amaro VICENTE (Committee Member) Professor MCKINNEY Timothy (External Examiner) Abstract of Thesis Entitled: Musica Poetica in Sixteenth-Century Reformation Germany Submitted by WONG, Helen Kin Hoi for the Degree of Master of Philosophy in Music at The Chinese University of Hong Kong in December 2009 ABSTRACT Musica poetica is a branch of music theory developed by German pedagogues of the Reformation era. It is the discipline within music composition that was grounded on the powerful relationships between music and text. The term musica poetica was first coined by the Lutheran musician/teacher Nicolaus Listenius in 1533 to distinguish it from musica theorica (the study of music as a mathematical science) and musica practica (applied theory dealing with aspects of performance), the two disciplines continuing from the Medieval education curriculum. By the middle of the sixteenth century, musica poetica began to be firmly established, alongside musica theorica and musica practica, as an independent branch of composition instruction, and was taught in the Latin schools of Lutheran Germany. As the treatises on musica poetica convey, the teaching of musica poetica was modelled on pedagogical principles of rhetoric that were taught in the humanistic curriculum of the Latin schools. In defining compositional procedures in relation to text-setting, these treatises borrowed or emulated terminologies from the discipline of classical rhetoric, and treated a musical composition as a work of oration, with an aesthetic aim of producing a work that could instruct, move and delight (docere, movere, delectare) the auditor.