Nun Danket Alle Gott
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Now Let Us Come Before Him Nun Laßt Uns Gehn Und Treten 8.8
Now Let Us Come Before Him Nun laßt uns gehn und treten 8.8. 8.8. Nun lasst uns Gott, dem Herren Paul Gerhardt, 1653 Nikolaus Selnecker, 1587 4 As mothers watch are keeping 9 To all who bow before Thee Tr. John Kelly, 1867, alt. Arr. Johann Crüger, alt. O’er children who are sleeping, And for Thy grace implore Thee, Their fear and grief assuaging, Oh, grant Thy benediction When angry storms are raging, And patience in affliction. 5 So God His own is shielding 10 With richest blessings crown us, And help to them is yielding. In all our ways, Lord, own us; When need and woe distress them, Give grace, who grace bestowest His loving arms caress them. To all, e’en to the lowest. 6 O Thou who dost not slumber, 11 Be Thou a Helper speedy Remove what would encumber To all the poor and needy, Our work, which prospers never To all forlorn a Father; Unless Thou bless it ever. Thine erring children gather. 7 Our song to Thee ascendeth, 12 Be with the sick and ailing, Whose mercy never endeth; Their Comforter unfailing; Our thanks to Thee we render, Dispelling grief and sadness, Who art our strong Defender. Oh, give them joy and gladness! 8 O God of mercy, hear us; 13 Above all else, Lord, send us Our Father, be Thou near us; Thy Spirit to attend us, Mid crosses and in sadness Within our hearts abiding, Be Thou our Fount of gladness. To heav’n our footsteps guiding. 14 All this Thy hand bestoweth, Thou Life, whence our life floweth. -

The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I
The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Edited by Theodore Hoelty-Nickel Valparaiso, Indiana The greatest contribution of the Lutheran Church to the culture of Western civilization lies in the field of music. Our Lutheran University is therefore particularly happy over the fact that, under the guidance of Professor Theodore Hoelty-Nickel, head of its Department of Music, it has been able to make a definite contribution to the advancement of musical taste in the Lutheran Church of America. The essays of this volume, originally presented at the Seminar in Church Music during the summer of 1944, are an encouraging evidence of the growing appreciation of our unique musical heritage. O. P. Kretzmann The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Table of Contents Foreword Opening Address -Prof. Theo. Hoelty-Nickel, Valparaiso, Ind. Benefits Derived from a More Scholarly Approach to the Rich Musical and Liturgical Heritage of the Lutheran Church -Prof. Walter E. Buszin, Concordia College, Fort Wayne, Ind. The Chorale—Artistic Weapon of the Lutheran Church -Dr. Hans Rosenwald, Chicago, Ill. Problems Connected with Editing Lutheran Church Music -Prof. Walter E. Buszin The Radio and Our Musical Heritage -Mr. Gerhard Schroth, University of Chicago, Chicago, Ill. Is the Musical Training at Our Synodical Institutions Adequate for the Preserving of Our Musical Heritage? -Dr. Theo. G. Stelzer, Concordia Teachers College, Seward, Nebr. Problems of the Church Organist -Mr. Herbert D. Bruening, St. Luke’s Lutheran Church, Chicago, Ill. Members of the Seminar, 1944 From The Musical Heritage of the Lutheran Church, Volume I (Valparaiso, Ind.: Valparaiso University, 1945). -

Bibliographie
Bibliographie Es werden alle Titel aufgeführt, aus denen im Text zitiert bzw. auf die ausdrücklich verwiesen wor den ist. Die Anordnung der Titel folgt dem alphabethischen Wortlaut, aber ohne Berücksichtigung der Artikel. Umfangreiche Titel aus dem 17. Jahrhundert werden gekürzt. Wenn Nachdrucke oder neuere, leichter zugängliche Ausgaben existieren, wird in der Regel auf diese verwiesen. Lediglich im Text genannte Titel wurden nicht aufgenommen. 1. Bibliographien/wichtige Überblickswerke/Einführungen Die hier verzeichneten Titel sowie Einzelbeiträge sind ebenfalls unter der Rubrik >Forschungsliteratur< aufgeführt. Burbaum, Sabine: Barock, in: Kunst-Epochen, Bd. 8, Stuttgart 2003. Deutsche Drucke des Barock 1600-1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, München, New York u.a. 1977-1996. Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, München 21999. Dünnhaupt, Gerhard: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock, Stuttgart 1990-1993. Emrich, Wilhelm: Deutsche Literatur der Barockzeit, Königstein/Ts. 1981. Enzyklopädie der Neuzeit, hg. von Friedrich Jaeger u. a., Stuttgatt, Weimar 2005 ff. Faber du Fa ur, Curt v.: German Baroque Literature. A Cataloque of the Collection in the Yale Uni- versity, New Haven 1958, 1969. Faulstich, Werner: Die Geschichte der Medien, Göttingen 1997-2004. Freund, Winfried: Abenteuer Barock. Kultur im Zeitalter der Entdeckungen, Darmstadt 2004. Gaede, Friedrich: Humanismus- Barock- Aufklärung. Geschichte der deutschen Literatur vom 16. bis zum 18. Jahrhundett, in: Handbuch der deutschen Literaturgeschichte, Abt. Darstellungen, Bd. 2, Bern, München 1971 Grimm, Gunter E., Max, Frank Rainer (Hg.): Deutsche Dichter. Bd. 2: Reformation, Renaissance und Barock, Stuttgart 1990. Habersetzer, Kar! Heinz: Bibliographie der deutschen Barockliteratur. Ausgaben und Reprints 1945-1976, Wiesbaden 1978. Hoffmeister, Gerhart: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987. -

The Sources of the Christmas Interpolations in J. S. Bach's Magnificat in E-Flat Major (BWV 243A)*
The Sources of the Christmas Interpolations in J. S. Bach's Magnificat in E-flat Major (BWV 243a)* By Robert M. Cammarota Apart from changes in tonality and instrumentation, the two versions of J. S. Bach's Magnificat differ from each other mainly in the presence offour Christmas interpolations in the earlier E-flat major setting (BWV 243a).' These include newly composed settings of the first strophe of Luther's lied "Vom Himmel hoch, da komm ich her" (1539); the last four verses of "Freut euch und jubiliert," a celebrated lied whose origin is unknown; "Gloria in excelsis Deo" (Luke 2:14); and the last four verses and Alleluia of "Virga Jesse floruit," attributed to Paul Eber (1570).2 The custom of troping the Magnificat at vespers on major feasts, particu larly Christmas, Easter, and Pentecost, was cultivated in German-speaking lands of central and eastern Europe from the 14th through the 17th centu ries; it continued to be observed in Leipzig during the first quarter of the 18th century. The procedure involved the interpolation of hymns and popu lar songs (lieder) appropriate to the feast into a polyphonic or, later, a con certed setting of the Magnificat. The texts of these interpolations were in Latin, German, or macaronic Latin-German. Although the origin oftroping the Magnificat is unknown, the practice has been traced back to the mid-14th century. The earliest examples of Magnifi cat tropes occur in the Seckauer Cantional of 1345.' These include "Magnifi cat Pater ingenitus a quo sunt omnia" and "Magnificat Stella nova radiat. "4 Both are designated for the Feast of the Nativity.' The tropes to the Magnificat were known by different names during the 16th, 17th, and early 18th centuries. -

Document Cover Page
A Conductor’s Guide and a New Edition of Christoph Graupner's Wo Gehet Jesus Hin?, GWV 1119/39 Item Type text; Electronic Dissertation Authors Seal, Kevin Michael Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction, presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 09/10/2021 06:03:50 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/645781 A CONDUCTOR'S GUIDE AND A NEW EDITION OF CHRISTOPH GRAUPNER'S WO GEHET JESUS HIN?, GWV 1119/39 by Kevin M. Seal __________________________ Copyright © Kevin M. Seal 2020 A Document Submitted to the Faculty of the FRED FOX SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2020 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Doctor of Musical Arts Document Committee, we certify that we have read the document prepared by: Kevin Michael Seal titled: A CONDUCTOR'S GUIDE AND A NEW EDITION OF CHRISTOPH GRAUPNER'S WO GEHET JESUS HIN, GWV 1119/39 and recommend that it be accepted as fulfilling the document requirement for the Degree of Doctor of Musical Arts. Bruce Chamberlain _________________________________________________________________ Date: ____________Aug 7, 2020 Bruce Chamberlain _________________________________________________________________ Date: ____________Aug 3, 2020 John T Brobeck _________________________________________________________________ Date: ____________Aug 7, 2020 Rex A. Woods Final approval and acceptance of this document is contingent upon the candidate’s submission of the final copies of the document to the Graduate College. -

Reclams Buch Der Deutschen Gedichte
1 Reclams Buch der deutschen Gedichte Vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert Ausgewählt und herausgegeben von Heinrich Detering Reclam 2 3 Reclams Buch der deutschen Gedichte Band i 4 4., durchgesehene und erweiterte Auflage Alle Rechte vorbehalten © 2007, 2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart Gestaltung bis S. 851: Friedrich Forssman, Kassel Gestaltung des Schubers: Rosa Loy, Leipzig Satz: Reclam, Ditzingen Druck und buchbinderische Verarbeitung: GGP Media GmbH, Pößneck Printed in Germany 2017 reclam ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart isbn 978-3-15-011090-4 www.reclam.de Inhalt 5 Vorwort 9 [Merseburger Zaubersprüche] 19 • [Lorscher Bienensegen] 19 • Notker iii. von St. Gallen 20 • Der von Kürenberg 20 • Albrecht von Johansdorf 21 • Dietmar von Aist 23 • Friedrich von Hausen 24 • Heinrich von Morungen 25 • Heinrich von Veldeke 28 • [Du bist mîn, ich bin dîn] 29 • Hartmann von Aue 30 • Reinmar 30 • Walther von der Vogelweide 34 • Wolfram von Eschenbach 46 • Der Tannhäuser 48 • Neidhart 52 • Ulrich von Lichtenstein 55 • Mechthild von Magdeburg 57 • Konrad von Würzburg 59 • Frauenlob 61 • Johannes Hadloub 62 • Mönch von Salzburg 63 • Oswald von Wolkenstein 65 • Hans Rosenplüt 71 • Martin Luther 71 • Ulrich von Hutten 74 • Hans Sachs 77 • Philipp Nicolai 79 • Georg Rodolf Weckherlin 81 • Martin Opitz 83 • Simon Dach 85 • Johann Rist 91 • Friedrich Spee von Lan- genfeld 93 • Paul Gerhardt 96 • Paul Fleming 104 • Johann Klaj 110 • Andreas Gryphius 111 • Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau -

Gesungene Aufklärung
Gesungene Aufklärung Untersuchungen zu nordwestdeutschen Gesangbuchreformen im späten 18. Jahrhundert Von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Fachbereich IV Human- und Gesellschaftswissenschaften – zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von Barbara Stroeve geboren am 4. Oktober 1971 in Walsrode Referent: Prof. Dr. Ernst Hinrichs Korreferent: Prof. Dr. Peter Schleuning Tag der Disputation: 15.12.2005 Vorwort Der Anstoß zu diesem Thema ging von meiner Arbeit zum Ersten Staatsexamen aus, in der ich mich mit dem Oldenburgischen Gesangbuch während der Epoche der Auf- klärung beschäftigt habe. Professor Dr. Ernst Hinrichs hat mich ermuntert, meinen Forschungsansatz in einer Dissertation zu vertiefen. Mit großer Aufmerksamkeit und Sachkenntnis sowie konstruktiv-kritischen Anregungen betreute Ernst Hinrichs meine Promotion. Ihm gilt mein besonderer Dank. Ich danke Prof. Dr. Peter Schleuning für die Bereitschaft, mein Vorhaben zu un- terstützen und deren musiktheoretische und musikhistorische Anteile mit großer Sorgfalt zu prüfen. Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Hermann Kurzke, der meine Arbeit geduldig und mit steter Bereitschaft zum Gespräch gefördert hat. Manche Hilfe erfuhr ich durch Dr. Peter Albrecht, in Form von wertvollen Hinweisen und kritischen Denkanstößen. Während der Beschäftigung mit den Gesangbüchern der Aufklärung waren zahlreiche Gespräche mit den Stipendiaten des Graduiertenkollegs „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär“ unschätzbar wichtig. Stellvertretend für einen inten- siven, inhaltlichen Austausch seien Dr. Andrea Neuhaus und Dr. Konstanze Grutschnig-Kieser genannt. Dem Evangelischen Studienwerk Villigst und der Deutschen Forschungsge- meinschaft danke ich für ihre finanzielle Unterstützung und Förderung während des Entstehungszeitraums dieser Arbeit. Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, die dieses Vorhaben über Jahre bereit- willig unterstützt haben. -

& 34 Œœ˙˙ Œœ ˙ ˙Œœœœ Œ Œ Œ Œœœœœ Œœœœœ Œœ ? 34 Œ Œ ˙ ˙Œœ ˙ #Œœ˙˙Œœ ˙Œ Œœœœœœ
Se, dagen gryr och mörkret flyr 1 Jublande = 88-100 q [] œ 3 ˙ œ œ œ œ œ Œ œ œ & 4œœ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår jord: San - ning - en œ ˙ œ 3 œ ˙ #œœ ˙ œ ˙ œ œ œ ? 4 œ ˙ œ œ œ Œ j j œ. œ œ Œ ∑∑ & ˙ œ œ ˙œ . œ #œœ ˙ ner nu veck - las ut! En lju - sets dag för san - nings kla - ra ljus. Guds ord, lik - som ett up - pen - ba - rad är. Allt folk skall hö - ra ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ? ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ j j ∑ œ. œ œ. œ & Ó œœ œ . œ œ œ ˙ œ œ œ . œ œ œ värl - den gryr; en lju - sets dag för värl - den him - melskt regn, Guds ord, lik - som ett him - melskt Her - rens ord. Allt folk skall hö - ra Her - rens œ œ œ #œ œ ˙ ∑∑∑ ? ˙ Œ [] ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ & ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ gryr; min själ, din tack - sam - het ut - gjut! regn, milt fal - ler ö - ver jor - dens grus. ord. O Si - on, gläd dig, lov hem - bär! ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ # œ ˙ œ ? Ó ˙ ˙ Text: Parley P. Pratt, 1807–1857 Jesaja 60:1–3 Musik: George Careless, 1839–1932 3 Nephi 16:7–20 2 Den himmelska elden Jublande = 96-112 q [] j bb 4 ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ & 4 œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œœ. -
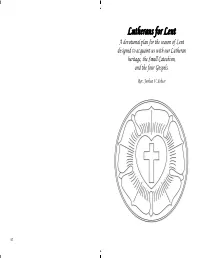
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

Baroque and Classical Style in Selected Organ Works of The
BAROQUE AND CLASSICAL STYLE IN SELECTED ORGAN WORKS OF THE BACHSCHULE by DEAN B. McINTYRE, B.A., M.M. A DISSERTATION IN FINE ARTS Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Approved Chairperson of the Committee Accepted Dearri of the Graduate jSchool December, 1998 © Copyright 1998 Dean B. Mclntyre ACKNOWLEDGMENTS I am grateful for the general guidance and specific suggestions offered by members of my dissertation advisory committee: Dr. Paul Cutter and Dr. Thomas Hughes (Music), Dr. John Stinespring (Art), and Dr. Daniel Nathan (Philosophy). Each offered assistance and insight from his own specific area as well as the general field of Fine Arts. I offer special thanks and appreciation to my committee chairperson Dr. Wayne Hobbs (Music), whose oversight and direction were invaluable. I must also acknowledge those individuals and publishers who have granted permission to include copyrighted musical materials in whole or in part: Concordia Publishing House, Lorenz Corporation, C. F. Peters Corporation, Oliver Ditson/Theodore Presser Company, Oxford University Press, Breitkopf & Hartel, and Dr. David Mulbury of the University of Cincinnati. A final offering of thanks goes to my wife, Karen, and our daughter, Noelle. Their unfailing patience and understanding were equalled by their continual spirit of encouragement. 11 TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS ii ABSTRACT ix LIST OF TABLES xi LIST OF FIGURES xii LIST OF MUSICAL EXAMPLES xiii LIST OF ABBREVIATIONS xvi CHAPTER I. INTRODUCTION 1 11. BAROQUE STYLE 12 Greneral Style Characteristics of the Late Baroque 13 Melody 15 Harmony 15 Rhythm 16 Form 17 Texture 18 Dynamics 19 J. -

The Christology of Bach's St John Passion
PARADOSIS 3 (2016) ‘Zeig uns durch deine Passion’: The Christology of Bach’s St John Passion Andreas Loewe St Paul’s Cathedral Melbourne Melbourne Conservatorium of Music Introduction On a wet, early spring afternoon, on Good Friday 1724, the congregants of Leipzig’s Nikolaikirche witnessed the first performance of Bach’s St John Passion.1 For at least a generation, Good Friday in Leipzig’s principal Lutheran churches—St Thomas’, St Nikolai and the ‘New’ Church—had concluded with the singing of Johann Walter’s chanted Passion.2 As part of the final liturgical observance of the day, the story of the death of Jesus would be sung, combining words and music in order to reflect on the significance of that day. Bach took the proclamation of the cross to a new level – theologically and musically. Rather than use a poetic retelling of the Passion story as his textual basis, Bach made use of a single gospel account, matched with contemporary poems and traditional chorales to retell the trial and death of Jesus. By providing regular opportunities for theological reflection, he purposefully created a “sermon in sound” and so, in his music making, he closely mirrors Lutheran Baroque homiletic principles. An orthodox Lutheran believer throughout his life, Bach’s Passion serves as a vehicle to invite his listeners to make their own his belief that it was “through Christ’s agony and death” that “all the world’s 1 Andreas Elias Büchner, Johann Kanold, Vollständiges und accurates Universal-Register, Aller wichtigen und merckwürdigen Materien (Erfurt: Jungnicol, 1736), 680. 2 As popularised in Gottfried Vopelius, ed., Neu Leipziger Gesangbuch/ Von den schönsten und besten Liedern verfasset/ In welchem Nicht allein des sel. -

Risen Savior Lutheran Church
Risen Savior Lutheran 2018 Church Pastor Art in the Lord’s House Key Our last stained-glass windows and additional wood carvings perhaps will be coming soon… Events The Lutheran Reformation did not simply destroy what came before it. The Confessions make it clear that we retain and preserve what we can according to the Gospel, as in these examples, which our congregations and Synod are still bound: Oct. 7 ➔ “We keep traditional liturgical forms, such as the order of the lessons, prayers, Oktoberfest vestments, etc.” (Apology XXIV). ➔ “Those ancient customs should be kept which can be kept without sin or without great Oct. 13 disadvantage. This is what we teach….We gladly keep the old traditions set up in the Highway church because they are useful and promote tranquility …the children chant the Psalms in order to learn.” (Apology XV). Clean-up ➔ “The [Service] is retained among us and is celebrated with the greatest reverence. Almost all the customary ceremonies are also retained.” (Augsburg Confession XXIV) Oct. 15 In many cases this applied to the visual arts as well. While Great Britain and Switzerland Blood Drive bear the scars of Reformed iconoclasm, many churches in Lutheran Germany still display the beauty of medieval Christianity. Art is like worship. In a practical, utilitarian world it seems rather useless and perhaps Oct. 28 even foolish, even a waste of money. Art is just pretty stuff, the things we hang up in our Festival of the homes to decorate the plain wall. It has meaning only so long as we choose it to and it is Reformation something we discard when we are over it or when our interests or tastes change.