Hansische Geschichtsblätter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania
100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania Estonia, of Treasures 100 100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania 1 This book is the joint initiative of and part of the cooperation between the National Heritage Board of the Republic of Estonia, the National Heritage Board of Republic of Latvia and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The book is inspired by the European Year of Cultural Heritage 2018, supported within the framework of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe “2018 European Heritage Days” and has received a grant from the State Culture Capital Foundation of Latvia. Authors of texts: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla Translation: Kristjan Teder, Madli Kullaste, SIA SERRES, Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras Editing: Carolin Pihlap, Janis Zilgalvis, Nijolė Bitinienė, Reelika Niit, Rita Mikelionytė, Triin Reidla Designer: Tuuli Aule Printed by: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Laki 26, Tallinn, 12915 ISBN 978-9949-7293-0-2 (printed) ISBN 978-9949-7293-1-9 (pdf) Tallinn, 2018 100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania 2 3 This book is the joint initiative of and part of the cooperation between the National Heritage Board of the Republic of Estonia, the National Heritage Board of Republic of Latvia and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The book is inspired by the European Year of Cultural Heritage 2018, supported within the framework of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe “2018 European Heritage Days” and has received a grant from the State Culture Capital Foundation of Latvia. -

100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania
100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania Estonia, of Treasures 100 100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania 1 This book is the joint initiative of and part of the cooperation between the National Heritage Board of the Republic of Estonia, the National Heritage Board of Republic of Latvia and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The book is inspired by the European Year of Cultural Heritage 2018, supported within the framework of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe “2018 European Heritage Days” and has received a grant from the State Culture Capital Foundation of Latvia. Authors of texts: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla Translation: Kristjan Teder, Madli Kullaste, SIA SERRES, Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras Editing: Carolin Pihlap, Janis Zilgalvis, Nijolė Bitinienė, Reelika Niit, Rita Mikelionytė, Triin Reidla Designer: Tuuli Aule Printed by: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Laki 26, Tallinn, 12915 ISBN 978-9949-7293-0-2 (printed) ISBN 978-9949-7293-1-9 (pdf) Tallinn, 2018 100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania 2 3 This book is the joint initiative of and part of the cooperation between the National Heritage Board of the Republic of Estonia, the National Heritage Board of Republic of Latvia and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The book is inspired by the European Year of Cultural Heritage 2018, supported within the framework of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe “2018 European Heritage Days” and has received a grant from the State Culture Capital Foundation of Latvia. -
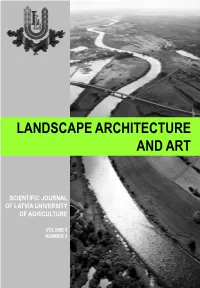
Landscape Architecture and Art
LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ART SCIENTIFIC JOURNAL OF LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE VOLUME 5 NUMBER 5 ISSN 2255-8632 print Scientific Journal of Latvia University of Agriculture Landscape Architecture and Art, Volume 5, Number 5 ISSN 2255-8640 online SCIENTIFIC JOURNAL OF LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ART VOLUME 5 NUMBER 5 JELGAVA1 2014 Scientific Journal of Latvia University of Agriculture Landscape Architecture and Art, Volume 5, Number 5 EDITOR IN CHIEF Aija Ziemeļniece, Dr. arch., Professor, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia EDITORIAL BOARD Uģis Bratuškins, Dr. arch., Professor, Riga Technical University, Riga, Latvia Maria Ignatieva, Dr. phil., Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden Karsten Jorgensen, Dr. scient., Professor, Norwegian University of Life Sciences, Oslo, Norway Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., Professor, Riga Technical University, Riga, Latvia Juhan Maiste, Dr. art., Professor, University of Tartu, Tartu, Estonia Eglė Navickienė, Dr. arch., Assoc. Professor, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania Valeriy Nefedov, Dr. arch., Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, Russia Thomas Oyen, Professor, Neubrandenburg University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany Gintaras Stauskis, PhD arch., Assoc. Professor, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania Ivars Strautmanis, Dr. habil. arch., Professor, Riga Technical University, Riga, Latvia Ojārs -

Stadtgeschichte Des Baltikums Oder Baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an Ein Neues Forschungsfeld Zur Baltischen Geschichte
Aus rechtlichen Gründen wurden die Bilder entfernt TAGUNGEN zur Ostmitteleuropaforschung 33 Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte Herausgegeben von Heidi Hein-Kircher und Ilgvars Misāns Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte TAGUNGEN ZUR OSTMITTELEUROPAFORSCHUNG Herausgegeben vom Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft 33 Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte Herausgegeben von HEIDI HEIN-KIRCHER und ILGVARS MISĀNS VERLAG HERDER-INSTITUT · MARBURG · 2016 Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar © 2016 – 2., überarbeitete und erweiterte Aufl age © 2015 by Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 35037 Marburg, Gisonenweg 5-7 Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten Satz: Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 35037 Marburg Druck: KN Digital Printforce GmbH, Ferdinand-Jühlke-Straße 7, 99095 Erfurt Umschlagbilder: links: Postkarte: Gruss aus Riga (um das Jahr 1900). Im unteren Teil – das Schwarzhäupterhaus (rechts) -

Publikationen Der Baltischen Historischen Kommission Und Das Baltikum Betreffende Veröffentlichungen Ihrer Mitglieder
Publikationen der Baltischen Historischen Kommission und das Baltikum betreffende Veröffentlichungen ihrer Mitglieder 11. Ausgabe Stand: 20. März 2018 Die hier von Paul Kaegbein zusammengestellten und jetzt auch durchsuchbaren Verzeichnisse werden kontinuierlich ergänzt und aktualisiert. Sie enthalten zunächst Titel, die seit 2005 eine Reihe von Jahren der Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland (AHF) in München bis zu ihrer Auflösung Ende 2013 für die von ihr damals herausgegebene „Historische Bibliographie“ gemeldet wurden. Für die seither erschienenen Titel wurde das ursprüngliche Konzept beibehalten. Von Mitgliedern der Baltischen Historischen Kommission publizierte Beiträge über andere Kommissionsmitglieder sind in dem ebenso als Online-Publikation erscheinenden Verzeichnis „Veröffentlichungen über Mitglieder der Baltischen Historischen Kommission“ - URL: www.balt-hiko.de - enthalten. Im Abschnitt A sind die Titel chronologisch, im Abschnitt B zunächst alphabetisch nach Autoren und dann wiederum chronologisch geordnet. Bei erneuter Veröffentlichung von früher erschienenen Texten oder solchen in anderen Sprachen wurde zusätzlich die Original-Publikation genannt. Ein knappes Drittel der in dieser Ausgabe verzeichneten Titel - 759 von insgesamt 2492 - enthält Hinweise auf Texte, die auch im Internet zu finden sind. Hinsichtlich dieser ständig zunehmenden Zahl von Online-Publikationen sei auf das Verzeichnis „Baltica online“ verwiesen, das ebenfalls unter dem genannten URL zu finden ist. Um freundliche Mitteilung noch fehlender Titel (auch Online-Publikationen) sowie eventuell inzwischen geänderter URL-Adressen wird per E-Mail ([email protected]) gebeten. A. Von der Baltischen Historischen Kommission bzw. ihren Mitgliedern herausgegebene und betreute Publikationen 1 1. Aspekte der Reformation im Ostseeraum. (Verantw.: Ralph Tuchtenhagen. Red.: Konrad Maier.) Lüneburg 2005. 514 S. (Nordost-Archiv. N. F. Bd. 13: 2004.) [Betr. -
Forschungen Zur Baltischen Geschichte
FORSCHUNGEN ZUR BALTISCHEN GESCHICHTE 8 2013 Herausgegeben von Mati Laur und Karsten Brüggemann unter Mitwirkung von Anti Selart, Andris Levans und Konrad Maier in Verbindung mit Detlef Henning (Lüneburg), Carsten Jahnke (Kopenhagen), Juhan Kreem (Tallinn), Enn Küng (Tartu), Ilgvars Misāns (Riga), Evgenija Nazarova (Moskau), Ulrike Plath (Tallinn), David J. Smith (Glasgow), Andris Šnē (Riga), Gvido Straube (Riga), Tõnu Tannberg (Tartu), Ülle Tarkiainen (Tartu), Matthias Thumser (Berlin), Rita Regina Trimonienė (Šiauliai), Ralph Tuchtenhagen (Berlin), Horst Wernicke (Greifswald), Seppo Zetterberg (Jyväskylä) Akadeemiline Ajalooselts Forschungen zur baltischen Geschichte - Bd. 8 hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2013 Redaktion und Drucklegung wurden gefördert durch die Wissenschaftsförderung der Republik Estland ETF (Eesti Teadusfond) 6941, ETF 8209, SF (Sihtfi nantseerimine) 0130038s09 und SF 0180006s11 die Akademische Historische Gesellschaft (Tartu) die Baltische Historische Kommission e.V. die Fakultät für Geschichte und Philosophie der Universität Lettlands in Riga das Historische Institut der Universität Tallinn das Institut für Geschichte und Archäologie der Universität Tartu das Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V. an der Universität Hamburg (Nordost-Institut) und vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages Redaktion: Institut für Geschichte und Archäologie der Universität Tartu Ülikooli -
Eiropas Kultūras Mantojuma Dienas 2019
EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA EIROPASDIENAS KULTŪRAS2019 MANTOJUMARESTAURĀCIJA DIENAS 2019 RESTAURĀCIJA Izdevuma sagatavošanā izmantoti Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli. Sagatavojot tekstus izmantoti Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkotāju materiāli. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pateicas visiem, kuri palīdzēja un piedalījās izdevuma tapšanā. Materials from the National Heritage Board of Latvia Monuments Documentation Centre are used in this edition. The National Heritage Board expresses gratitude to all those contributed to the creation of this edition. Dizains / Graphic design: Sandra Betkere Vāka foto / Cover photo: Marika Vanaga Iespiests / Printing: Apgāds MANTOJUMS Poligrāfiskais atbalsts / Support: SIA ADverts Tulkojums / Translation: SIA SERRES Izdevuma koordinēšana / Technical coordination: Alma Kaurāte Teksta korektūra / Proofreading: Laine Kristberga © Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2019 ISBN 978-9934-8869-0-4 PIEJūras BRīvdabas MUZEJS KURZEME THE SEASIDE OPEN-AIR Museum 50 TĀšU MUIža Liepājas SV. TRīSVIENības luterāņU baznīca THE TĀšI MANOR 16 Liepāja HOLY TRINITY Lutheran Cathedral 52 DZīvojamās ēkas Ventspilī, TIRGUS IELĀ RESIDENTIAL HOUSES at TIRGUS STREET, Ventspils 18 LATGALE SABILES sinagoga THE SABILE SYnagogue 20 KUļņevas (Ilzeskalna) Sāpju Dievmātes pareizticīGO baznīCAS INTERJERS UN ikonostass GLEZNAS “KRISTUS SVēTī BēRNUS” (JOHANS Zāmuels Benedikts GRUNE, THE INTERIOR AND Iconostas OF THE KUļņeva 1823, audekls, EļļA) restaurācija (Ilzeskalns) OrthodoX -

The Altar Pulpit in Estonian Church Interiors
Reet Pius THE ALTAR PULPIT IN ESTONIAN CHURCH INTERIORS The function of the altar in Lutheran liturgy is connected to the Sacrament of the Eucharist. The Sacrament of the Last Supper symbolises the shar- ing of God and the altarpiece or altar decoration supported this with a picture on the same subject. The first altarpiece in Estonia to depict the Last Supper was donated to the Kihelkonna Church in 1591. Of the thirty-five known altars that date from the 16th century to the first dec- ade of the 18th century, the Last Supper was the subject in twenty-one of them.1 In the late 17th century, the Crucifixion of Christ started to domi- nate as the main theme for altars.2 Theologically, this communicated the message of salvation through faith. These two themes predominated in the altar design of Estonian churches until the end of the first quarter of the 19th century. 3 Alongside the seeming traditionalism or even still lifes in altar art, the change that occurred in the 18th century, which resulted in greater attention being paid to the architectural design of the altar and small altarpiece that marked the Communion table has been ignored, or is to- tally lacking. During the final quarter of the 18th century, altar pulpits DOI: http://dx.doi.org/10.12697/BJAH.2014.7.03 Translation by Juta Ristsoo 1 Reet Rast, “Altar – jumala laud ja esindusobjekt”, Eesti kunsti ajalugu, 2, 1520-1770 (Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2005), 320. 2 Rast, “Altar – jumala laud ja esindusobjekt”, 323. 3 New topics and the arrival of painting compositions is covered by Hanna Ingerpuu’s research. -

Rogramme Web-Site Is Is Web-Site Programme
Programme web-site is www.estlatrus.eu is web-site Programme potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation. The The Federation. Russian and EU the between crossroads the on location beneficial and potential development activities for the improvement of the regional competitiveness by utilising its its utilising by competitiveness regional the of improvement the for activities development The new and unique route for the first time connects Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border border cross joint supports financially 2007-2013 Instrument Partnership and Neighbourhood Ломоносов The Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme in the framework of European European of framework the in Programme Cooperation Border Cross Russia – Latvia – Estonia The bigger and smaller cities in Saint-Petersburg VTA © 2014 © VTA Russia, Estonia and Latvia Петергоф 1 Printed by: Printing house Latgales Druka Latgales house Printing by: Printed and highlights the identity, traditions and rich cultural offer in each country Санкт-Петербург Design: Anda Nordena, SIA AUTOS SIA Nordena, Anda Design: Translation: Vidzeme Tourism Association Tourism Vidzeme Translation: with special emphasis on the green heritage – estates and their beautiful Project partners, Tourism information centres information Tourism partners, Project parks. The green heritage culture route tempts to explore not only estates Красное Село Пушкин Estonia Content/photos: Vidzeme Tourism Association, Tourism Vidzeme Content/photos: and their parks, but also castles, churches and other architectural treasures. (Russia) Families with children are welcome to participate in various interactive Ропша Museum Agency Agency Museum programmes and workshops offered by museums, as well as to enjoy the Räpina Russia of the Leningrad region Leningrad the of (Estonia) (Latvia) (Latvia) delicacies made by local producers. -

Mūzikas Akadēmijas Raksti
Mūzikas akadēmijas raksti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2019 XVI Mūzikas akadēmijas raksti, XVI Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2019, 200 lpp. ISSN 2243-5719 Galvenā redaktore • Baiba Jaunslaviete Krājuma sastādītāja • Lolita Fūrmane Angļu valodas tekstu tulkotājs un redaktors • Egils Kaljo Māksliniece un maketētāja • Kristīna Bondare Nošu datorsalikums • Līga Pētersone Redakcijas kolēģija • Editorial Board Boriss Avramecs (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Valdis Bernhofs (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Anda Beitāne (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Tamāra Bogdanova (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Mārtiņš Boiko (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Jons Brūveris (Jonas Bruveris; Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija) Ēvalds Daugulis (Daugavpils Universitāte) Lolita Fūrmane (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Baiba Jaunslaviete (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Kevins K. Kārnss (Kevin C. Karnes; Emorija Universitāte, Atlanta) Arnolds Klotiņš (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts) Jānis Kudiņš (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Tatjana Kuriševa (Tatjana Kurysheva; P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorija) Jeļena Ļebedeva (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Georgs Pelēcis (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Ilze Šarkovska-Liepiņa (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts) Jānis Torgāns (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) Audrone Žuraitīte (Audronė Žiūraitytė; Lietuvas