About the Urban Development of Hallstatt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Salt Deposits in the UK
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by NERC Open Research Archive Halite karst geohazards (natural and man-made) in the United Kingdom ANTHONY H. COOPER British Geological Survey, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG, Great Britain COPYRIGHT © BGS/NERC e-mail [email protected] +44 (-0)115 936 3393 +44 (-0)115 936 3475 COOPER, A.H. 2002. Halite karst geohazards (natural and man-made) in the United Kingdom. Environmental Geology, Vol. 42, 505-512. This work is based on a paper presented to the 8th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental impact of karst, Louisville, Kentucky, April 2001. In the United Kingdom Permian and Triassic halite (rock salt) deposits have been affected by natural and artificial dissolution producing karstic landforms and subsidence. Brine springs from the Triassic salt have been exploited since Roman times, or possibly earlier, indicating prolonged natural dissolution. Medieval salt extraction in England is indicated by the of place names ending in “wich” indicating brine spring exploitation at Northwich, Middlewich, Nantwich and Droitwich. Later, Victorian brine extraction in these areas accentuated salt karst development causing severe subsidence problems that remain a legacy. The salt was also mined, but the mines flooded and consequent brine extraction caused the workings to collapse, resulting in catastrophic surface subsidence. Legislation was enacted to pay for the damage and a levy is still charged for salt extraction. Some salt mines are still collapsing and the re-establishment of the post-brine extraction hydrogeological regimes means that salt springs may again flow causing further dissolution and potential collapse. -

EXPERIMENTAL SALINITY ALLEVIATION at MALAGA BEND of the PECOS RIVER, EDDY COUNTY, NEW MEXICO by John S
UMW PB80-177900 Experimental Salinity Alleviation at lalaga Bend of the Pecos River Eddy County, New Mexico (U.S.) Geological Survey Albuquerque, NM Dec 79 EE QE — 75 .U58w no.80-4 1979 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE National Technical Information Service 111111S. LIBRARY. OCT 05 198,, , '-,RARy Bureau or Acclamation Denver, Coinro, BUREAU OF RECLAMAT ON DENVER LIBRAF 111011111111 92015347 . BIBLIOGRAPHIC DATA 1. Report No. 2. C CI ii fr's.-1 77 cinn SHEET USGS/WRD/WRI-80/a22,„ 4. Title and Subtitle 41. 5. Report Dam Experimental salinity alleviation at Malaga Bend of December 1979 the Pecos River, Eddy County, New Mexico 6. 7. Author(s) 8. Performing Organization Repc. No. John S. Havens and D. W. Wilkins USGS/WRI-80-4 9. Performing Organization Name and Address 10. Project/Task/Work Unit No. U. S. Geological Survey Water Resources Division 11. Contract/Grant No. P.O. Box 26659 Albuquerque, New Mexico 87125 . 12. Sponsoring Organization Name and Address 13. Type of Report & Period U. S. Geological Survey Covered Water Resources Division Final P.O. Box 26659 14. Albu.uer.ue, New Mexico 87125 15. Supplementary Notes . 16. Abstracts Upward-leaking brine, from a confined aquifer_ at the base of the Rustler Formation, mixes with fresher water in a shallow aquifer, resulting in discharge to the Pecos River .n southern Eddy County, New Mexico, of about 0.5 cubic feet per second of saturated .rine. Pumping brine from the aquifer at a rate greater than 0.5 cubic feet per second owered the potentiometric head in the confined aquifer. -

Life at Low Water Activity
Published online 12 July 2004 Life at low water activity W. D. Grant Department of Infection, Immunity and Inflammation, University of Leicester, Maurice Shock Building, University Road, Leicester LE1 9HN, UK ([email protected]) Two major types of environment provide habitats for the most xerophilic organisms known: foods pre- served by some form of dehydration or enhanced sugar levels, and hypersaline sites where water availability is limited by a high concentration of salts (usually NaCl). These environments are essentially microbial habitats, with high-sugar foods being dominated by xerophilic (sometimes called osmophilic) filamentous fungi and yeasts, some of which are capable of growth at a water activity (aw) of 0.61, the lowest aw value for growth recorded to date. By contrast, high-salt environments are almost exclusively populated by prokaryotes, notably the haloarchaea, capable of growing in saturated NaCl (aw 0.75). Different strategies are employed for combating the osmotic stress imposed by high levels of solutes in the environment. Eukaryotes and most prokaryotes synthesize or accumulate organic so-called ‘compatible solutes’ (osmolytes) that have counterbalancing osmotic potential. A restricted range of bacteria and the haloar- chaea counterbalance osmotic stress imposed by NaCl by accumulating equivalent amounts of KCl. Haloarchaea become entrapped and survive for long periods inside halite (NaCl) crystals. They are also found in ancient subterranean halite (NaCl) deposits, leading to speculation about survival over geological time periods. Keywords: xerophiles; halophiles; haloarchaea; hypersaline lakes; osmoadaptation; microbial longevity 1. INTRODUCTION aw = P/P0 = n1/n1 ϩ n2, There are two major types of environment in which water where n is moles of solvent (water); n is moles of solute; availability can become limiting for an organism. -

Salt (Chemistry) - Wikipedia
Salt (chemistry) - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry) Salt (chemistry) In chemistry, a salt is a chemical compound consisting of an ionic assembly of cations and anions.[1] Salts are composed of related numbers of cations (positively charged ions) and anions (negatively charged ions) so that the product is electrically neutral (without a net charge). ese component ions can be inorganic, − − − such as chloride (Cl ), or organic, such as acetate (CH3CO2); and can be monatomic, such as fluoride (F ) 2− or polyatomic, such as sulfate (SO4 ). Contents Types of salt Properties Color Taste Odor Solubility Conductivity Melting point Nomenclature Formation Strong salt Weak salt See also References Types of salt Salts can be classified in a variety of ways. Salts that produce hydroxide ions when dissolved in water are called alkali salts. Salts that produce acidic solutions are acid salts. Neutral salts are those salts that are neither acidic nor basic. Zwierions contain an anionic and a cationic centre in the same molecule, but are not considered to be salts. Examples of zwierions include amino acids, many metabolites, peptides, and proteins.[2] Properties Color Solid salts tend to be transparent as illustrated by sodium chloride. + − In many cases, the apparent opacity or transparency are only BMIM PF6 , an ionic liquid related to the difference in size of the individual monocrystals. Since light reflects from the grain boundaries (boundaries between 1 von 6 29.03.21, 15:43 Salt (chemistry) - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry) crystallites), larger crystals tend to be transparent, while the polycrystalline aggregates look like white powders. -

The Rise and Fall of the Marshalls of Northwich, Salt Proprietors: a Saga of the Industrial Era in Cheshire, 1720-1917
THE RISE AND FALL OF THE MARSHALLS OF NORTHWICH, SALT PROPRIETORS: A SAGA OF THE INDUSTRIAL ERA IN CHESHIRE, 1720-1917 BY D. A. IREDALE, M.A., PH.D. HEN Thomas Marshall from the Hartford Beach, near WNorthwich, appeared before a parliamentary committee in London in 1817, he proudly proclaimed himself the largest salt proprietor in the kingdom. The wealthiest merchant in mid-Cheshire, Marshall determined that his family should one day sit on committees and at table with the greatest in the land. To this end he sent his son to Eton, Cambridge, and the Middle Temple. And his grandson did indeed climb towards the highest levels of society. I FOUNDING THE FAMILY FORTUNE During the seventeenth century the Marshalls lived in Nant- wich. They began business as shoemakers, then as framework knitters. By hard work they grew prosperous, so that when Richard Marshall died in 1692 the family owned a fine "dwelling house in the welshrow" and valuable textile machinery. But living in one of Cheshire's salt towns, the family naturally acquired a "wich-house & twelve leads walling", that is, equip ment for raising and boiling brine to produce salt. Salt had long been valued as a preservative and seasoner of food by the fisheries and the navy, by dairy farmers and every housewife, but during the industrial age it was to become an important raw material in the glass, soap, and chemical industries. To invest in salt, therefore, was to plan sensibly for future prosperity. The Marshalls sent much of their cloth and, probably, small loads of salt overland to Northwich, and then by river or road to Liverpool. -

Over and Winsford Archaeological Assessment 2003
CHESHIRE HISTORIC TOWNS SURVEY Over and Winsford Archaeological Assessment 2003 CHESHIRE HISTORIC TOWNS SURVEY Over and Winsford Archaeological Assessment 2003 Environmental Planning Cheshire County Council Backford Hall Backford Chester CH1 6PZ These reports are the copyright of Cheshire County Council and English Heritage. We would like to acknowledge the assistance of Cheshire and Chester Archives and Local Studies, Frodsham and District Local History Group, Winsford Local History Society, Andrew Fielding, Lion Salt Works Project Director and Dr Chris Lewis, University of Liverpool, in the preparation of these reports. The archive is held by the Cheshire County Sites and Monuments Record. The Ordnance Survey mapping within this document is provided by Cheshire County Council under licence from the Ordnance Survey, in order to fulfil its public function to make available Council held public domain information. The mapping is intended to illustrate the spatial changes that have occurred during the historical development of Cheshire towns. Persons viewing this mapping should contact Ordnance Survey copyright for advice where they wish to licence Ordnance Survey mapping/map data for their own use. The OS web site can be found at www.ordsvy.gov.uk OVER & WINSFORD ARCHAEOLOGICAL ASSESSMENT Jo Clark 1. SUMMARY The small medieval settlements of Over and Wharton, which lie 1.5km west and 0.75km east of the River Weaver respectively, have long since been subsumed by the expanding township of Winsford, which lies between the two on the banks of the river. Winsford’s prosperity was founded upon the exploitation of brine in the 18th and 19th centuries and the efficient transportation afforded by the Weaver Navigation. -
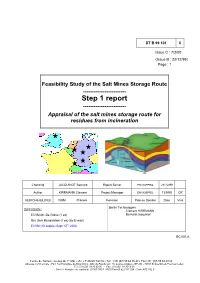
Feasibility Study of the Salt Mines Storage Route, Step 1
DT B 99 101 C Issue C : 7/2/00 (Issue B : 22/12/99) Page : 1 Feasibility Study of the Salt Mines Storage Route ------------------------ Step 1 report ------------------------ Appraisal of the salt mines storage route for residues from incineration Checking JACQUINOT Bernard Expert Senior ENVIGEPRO 21/12/99 Author KIRRMANN Clément Project Manager ENVIGEPRO 13/9/00 CK RESPONSABILITIES NOM Prénom Fonction Pole ou Société Date Visa Bertin Technologies DIFFUSION : Clément KIRRMANN ECVM Mr. De Grève (1 ex) Bernard Jacquinot Mrs Unni Musdalslien (1 ex) (by E-mail) ECVM (10 copies) Sept 13th, 2000 BC.001.A Centre de Tarnos • avenue du 1er Mai • Z.I. • F 40220 Tarnos • Tél. : (33) (0)5 59 64 86 48 • Fax (33) (0)5 59 64 49 64 Adresse commerciale : Parc Technologique de Bois d'Arcy - ZAC du Pas du Lac 10, avenue Ampère - BP 284 - 78053 St Quentin-en-Yvelines Cedex Tél : (33) (0)1 39 30 60 00 - Fax : (33) (0)1 39 30 09 50 y Société Anonyme au capital de 20 000 000 F y RCS Paris B 422 511 204 - Code APE 742 C DT B 99 101 C Page : 2 Référence interne DT B 99 101 B Système hôte WORD 6 (95) /CK Fonds documentaire Dossier d’affectation Général Nomenclature de gestion affaire 00559 lot 1 Document contractuel OUI HISTORIQUE DES EVOLUTIONS MODIFICATIONS Authors / Checking Indice Date (raisons principales, paragraphes et pages concernés, références des demandes de modification, ...) A 13/12/99 Création du document C.KIRRMANN Provisional version sent to Mrs Unni Musdalslien and M.De 15/12/99 Grève B 21/12/99 Completed version taking into account comments of -

Liquids Gathering Pipelines: a Comprehensive Analysis
Prepared for: North Dakota Industrial Commission and Energy Development Liquids and Transmission Committee Gathering Pipelines: A Comprehensive Analysis Prepared by: Energy & Environmental Research Center University of North Dakota 15 North 23rd Street, Stop 9018 Grand Forks, ND 58202-9018 December 2015 EERC DISCLAIMER LEGAL NOTICE This research report was prepared by the Energy & Environmental Research Center (EERC), an agency of the University of North Dakota, as an account of work sponsored by the North Dakota Industrial Commission. Because of the research nature of the work performed, neither the EERC nor any of its employees makes any warranty, express or implied, or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed or represents that its use would not infringe privately owned rights. Reference herein to any specific commercial product, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise does not necessarily constitute or imply its endorsement or recommendation by the EERC. NDIC DISCLAIMER This report was prepared by the EERC pursuant to an agreement partially funded by the Industrial Commission of North Dakota, and neither the EERC nor any of its subcontractors nor the North Dakota Industrial Commission nor any person acting on behalf of either: (A) Makes any warranty or representation, express or implied, with respect to the accuracy, completeness, or usefulness of the information contained in this report or that the use of any information, apparatus, method, or process disclosed in this report may not infringe privately owned rights; or (B) Assumes any liabilities with respect to the use of, or for damages resulting from the use of, any information, apparatus, method, or process disclosed in this report. -

The Infrastructure Planning (Applications: Prescribed Forms and Procedure) Regulations 2009
Keuper Gas Storage Project Project Overview November 2015 Application Reference No: EN030002 THE INFRASTRUCTURE PLANNING (APPLICATIONS: PRESCRIBED FORMS AND PROCEDURE) REGULATIONS 2009 KEUPER GAS STORAGE PROJECT PROJECT OVERVIEW Zyda Law 60 Cygnet Court Timothy’s Bridge Road Stratford upon Avon Warwickshire CV37 9NW www.zydalaw.com Regulation No: 5(2)(q) Document Ref: 8.1 Author: Zyda Law 60 Cygnet Court Stratford upon Avon Warwickshire CV37 9NW Date: November 2015 Version: Final Contents 0. Executive Summary ............................................................................................... v Introduction ................................................................................................................... v The Applicant ................................................................................................................ vi DCO Development Areas .............................................................................................. vi The Project .................................................................................................................... vi Phase 1 ................................................................................................................... vii Year 1 ............................................................................................................... vii Year 2 ............................................................................................................... vii Phase 2 .................................................................................................................. -

Citizenship Performance and Urban Social Space in Bogotá, 1985-2015
Confronting Violence: Citizenship Performance and Urban Social Space in Bogotá, 1985-2015 Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Geoffrey Eugene Wilson B.A., M.F.A. Graduate Program in Theatre The Ohio State University 2019 Dissertation Committee Ana Elena Puga, D.F.A., Advisor Jennifer Schlueter, Ph.D. Shilarna Stokes, Ph.D. Copyrighted by Geoffrey Eugene Wilson 2019 Abstract This dissertation combines performance analysis, cultural materialism, and theory on urban social space to develop a theory of citizenship performance. I analyze three performances that occurred in public spaces in Bogotá, Colombia each of which responds to violence resulting from Colombia’s long civil war and challenges dominant notions of who belongs to the cultural community, as well as how the community behaves collectively. I argue that citizenship performances respond to violence within Colombian culture in three ways: first, they remap community behavior by modelling alternative modes of public moral comportment; second, they destabilize and recode the symbolic languages of the cultural community; third, they assert the cultural citizenship of marginalized communities by presencing their lives, struggles, and histories in public social space. The first chapter analyzes a performance project by Bogotá’s alternative theatre company Mapa Teatro, that maps out the social histories of the former barrio Santa Inés, also known as El Cartucho. Beginning in 2001, Mapa Teatro began work on a series of performances and installations which documented the demolition of the barrio, culminating in a multimedia production called Witness to the Ruins, a citizenship performance that staged the lives of the former residents of Santa Inés on the rubble of the barrio itself, before it was transformed and gentrified into the Parque Tercer Milenio (Third Millennium Park). -

Great Saltworks of Salins-Les-Bains Grassias, I., Ph
Literature consulted (selection): Great Saltworks of Salins-les-Bains Grassias, I., Ph. Markarian, & P. Petrequin, O. Weller, De pierre et de sel. Les salines de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains, Musée (France) des techniques et cultures comtoises, 2006. Technical Evaluation Mission: 3–6 September 2008. No 203bis Additional information requested and received from the State Party: A letter was sent to the State Party on 10 December 2008 requesting the State Party to: Official name as proposed – Review the buffer zone for Arc-et-Senans and include by the State Party: From the Great Saltworks of the brine pipeline; Salins-les-Bains to the Royal – Provide assurances regarding the adoption of the Saltworks of Arc-et-Senans, the production of open-pan management plan and the implementation of the joint management structure for the two sites; and salt – Review the urban development of Salins-les-Bains in Location: Franche-Comté Region, the immediate vicinity of the Saltworks and the Doubs and Jura historical enclosure with the visual impact of the Département, casino. France The State Party sent a reply (80 pages) dated 27 February Brief description: 2009. An analysis of this documentation is included in this evaluation. The Great Saltworks of Salins-les-Bains have exploited the brine extracted from the considerable underground deposits Date of ICOMOS approval of this report: 10 March 2009. since the Middle Ages and, in all likelihood, since before that. It is one of the rarer testimonies to the production of open-pan salt (crystallization by heating), with its 2. THE PROPERTY underground and above-ground buildings and technical facilities still in place. -

Introductions to Heritage Assets: Pre-Industrial Salterns
Pre-industrial Salterns Introductions to Heritage Assets Summary Historic England’s Introductions to Heritage Assets (IHAs) are accessible, authoritative, illustrated summaries of what we know about specific types of archaeological site, building, landscape or marine asset. Typically they deal with subjects which have previously lacked such a published summary, either because the literature is dauntingly voluminous, or alternatively where little has been written. Most often it is the latter, and many IHAs bring understanding of site or building types which are neglected or little understood. This IHA provides an introduction to pre-industrial salterns. Salterns, or ‘salt works’, are places where crystalline salt was extracted from salt water - either sea water, or brine from inland springs. Salt production follows a process of evaporation until crystals of sodium chloride are precipitated from sea-water or inland brine. Descriptions of the asset type as well as its development and associations, along with a brief chronology, are included. A list of in-depth sources on the topic is suggested for further reading. This document has been prepared by Dave Went and edited by Joe Flatman, Sarah- Jane Hathaway and Pete Herring. It is one of a series of 41 documents. This edition published by Historic England October 2018. All images © Historic England unless otherwise stated. Please refer to this document as: Historic England 2018 Pre-industrial Salterns: Introductions to Heritage Assets. Historic England. Swindon HistoricEngland.org.uk/listing/selection-criteria/scheduling-selection/ihas-archaeology/ Front cover An aerial photograph from 1946 showing the pattern of saltern mounds, some in pasture, others ploughed flat, in the parishes of Marshchapel and North Coates, Lincolnshire.