2003·2004·2005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

„Alleingang Verhindern“
Zurück in Deutschland, hört er Ge- schichte in München bei Eric Voegelin. Es ist die Zeit der Suche nach Parabeln zur Entstehung des Faschismus. Lange vor ’68 gilt der junge Heimkehrer aus den USA „Alleingang verhindern“ als Fixpunkt einer aufmüpfigen Uni-Szene, die in Schwabinger Schwemmen dialek- Der Vorschlag, in Berlin statt des Holocaust-Mahnmals tisch aufrüstet – Debattierer messen sich, ein Museum zu errichten, verärgert Experten und Bauherren. indem sie wortreich für das Gegenteil ih- rer Überzeugung eintreten. or gut zehn Jahren lud eine tung. Folgerichtig verlangt Lea Rosh, Naumann, bester Redner und seines West-Berliner Bürgerinitiative Naumann möge sich mit dem Förder- „dramatisch zerfurchten Gesichts am Kla- Vunter Führung der Journalistin kreis und Berlin ins Benehmen setzen, vier“ wegen Mädchenschwarm, gründet Lea Rosh erstmals zu einer öffentlichen bevor er unausgegorene Ideen in die eine Zeitung, die als pro-kommunistisch ver- Diskussion über den Bau eines „Denk- Welt setze. „Ein Alleingang des Bun- dächtigt und verboten wird. Er geht auf die mals für die ermordeten Juden Euro- des“, sagt auch der Chef der Berliner Straße und promoviert über Karl Kraus. pas“ ein. Die Zahl der Vorschläge für Senatskanzlei, Volker Kähne, „muß Er wird Journalist bei „Zeit“ und SPIE- ein solches Mahnmal, die seitdem er- verhindert werden.“ GEL und später Rowohlt-Chef in Ham- sonnen und publiziert wurden, dürfte Die drei Auslober hatten nach zwei burg, schlägt Rad und läßt Federn als Ver- inzwischen die 600 überschritten aufwendigen künstlerischen Wett- leger in New York. Im Sommer 1998 sitzt er haben. bewerben und drei Kolloquien den Ent- wurf von Richard Serra und Peter Ei- senman favorisiert, doch eine Ent- scheidung vertagt. -

Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi
www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi Forced Laborers Introduction . 1 Compensation for Nazi Forced Labor? Attempt at a Definition . 5 Compensation of Nazi Forced Laborers, 1945–1990 . 10 Supplement 1: The Compensation of Nazi Forced Laborers in the GDR . 28 The Compensation of Nazi Forced Laborers since 1990 . 31 Supplement 2: The Compensation of Nazi Forced Laborers in Austria . 42 Conclusion . 43 Norbert Wollheim Memorial J.W. Goethe-Universität / Fritz Bauer Institut Frankfurt am Main, 2010 www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt: Financial Compensation for Nazi Forced Laborers, p. 1 Introduction After tough negotiations with the Conference on Jewish Material Claims against Germany, the Krupp Group made the following announcement on December 23, 1959: At least DM 6 million but no more than DM 10 million would be paid to former Jewish concentration camp prisoners who could show that they ―were employed in plants of Krupp or its subsidiaries during the war as a result of Na- tional Socialist actions‖; each entitled claimant would receive the sum of DM 5,000. The sole owner Alfried Krupp, according to the company newsletter, had ―resolved upon this agreement in order to make a personal contribution toward the healing of the wounds suffered in the war.‖ By his own admission, the agreement signified ―no recognition of any legal obligation,‖ but instead represented a charitable gesture, further emphasized by the announcement of the signing of the document one day before Christmas.1 The Claims Conference, however, had to guarantee that no legal actions against Krupp would be taken in the future with regard to compensation. -

Zwei Jahrzehnte Diskussion Um Staatliche Erinnerungssymbole in Bonn Und Berlin
Zwei Jahrzehnte Diskussion um staatliche Erinnerungssymbole in Bonn und Berlin Horst Seferens Immer wieder haben sich die Gedenkstätten mit zentralen, nationalen Mahnmalen aus- Dr. Günter Morsch, einandergesetzt. In einem offenen Brief, der im GedenkstättenRundbrief Nr. 14/1986 Direktor der Stiftung Brandenburgische abgedruckt war, wurden die Pläne, in den Bonner Rheinauen eine »zentrale Mahn- und Gedenkstätten und Gedenkstätte für die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft« zu schaffen, heftig kritisiert. Leiter der Gedenkstätte Statt dessen heißt eine Überschrift im GedenkstättenRundbrief Nr. 17/1986 »Statt Mahn- und Museum Sachsenhausen, hatte mal in Bonn Gedenkstätten vor Ort«. zugesagt, diesen Auch über das vor allem von Lea Rosh und Eberhard Jäckel in die Diskussion gebrachte Beitrag zu verfassen. Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde lange und intensiv diskutiert. Der Wegen eines Unfalls konnte er dieses erste Briefwechsel hierzu im Archiv des Gedenkstättenreferats ist datiert vom 12. August Versprechen nicht 1988. Neben vielen inhaltlichen und ästhetischen Kritikpunkten wurde vor allem einhalten. moniert, dass mit dem Mahnmal plus Ort der Information ein »künstlich authentischer Dr. Horst Seferens hat sich dankenswerter Ort« geschaffen wird, der durch die Nutzung der Metatheorie des Holocaust nicht nur Weise kurzfristig zu einer Loslösung der Geschichte des Judenmords aus dem historischen Zusammen- bereit erklärt, seinem hang, sondern auch zu einer Folklorisierung der Beschäftigung mit der Geschichte und Part zu übernehmen. -

Inside Jews, Inside Germany: Internalised Reconciliations
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY Faculty of Arts and Social Sciences Inside Jews, Inside Germany: Internalised Reconciliations by Lisa Dabscheck A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Doctor of Creative Arts Sydney, Australia 2019 i Production Note: Signature removed prior to publication. ii ACKNOWLEDGEMENTS My heartfelt thanks go to the generous and “sehr reflektiert” individuals who invited me into their inner worlds, sharing with me their ruminations without which this project would not have been possible. To Benyamin Reich, Béa and Greg Loeb, Myriam Halberstam and Stephan J. Kramer, Raphael Seligmann, Flora Hirschfeld, Lisa Gaufman, Robert Schulzmann, Glafira Silvestra, Ken Speyer, Skull Judenfreund and to ‘Susanne’ and ‘Sascha’ who prefer to be recorded here as such. To the survivors: Henry Rotmensch, Natan Grossmann, and Inge Borck together with Herr Wagner and Herr Wolf, my deepest thanks. And to Joram Ronel and Miriam Acoca at Café Zelig. To those others I met along the way who shared with me their intelligence, acumen and encouragement: Konrad Kwiet, Terry Swartzberg, Levi Ufferfilge, Sandra Anusiewicz-Baer, Alina Gromova, Toby Axelrod, Alexander Hausgall and Dekel Peretz. At Beth Shalom I found great insight and gentle communion with the mensch and Rabbi Tom Kučera and in the extraordinary voice of Cantor Nikola David. It was there that I met my dear friend and confidant Amber Rose Bedal, whose experience chimed so profoundly with mine and to whom, with the heaviest of hearts, I must give my thanks in Memoriam. At the University of Technology Sydney my sincere thanks to the Faculty of Arts and Social Sciences, School of Communication. -

Identitätsort Berlin
Identitätsort Berlin Die politische Hauptstadtarchitektur und ihre symbolische Funktion im Prozeß nationaler Identitätsbildung Dissertation von Rüdiger Traxler zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Philosophie, eingereicht am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin 2011 Erstgutachter: Priv.-Doz. Dr. Werner Süß Zweitgutachter: Prof. Dr. Gerhard Göhler Tag der Disputation: 29. Juni 2011 1 Inhaltsverzeichnis A EINLEITUNG 1 Nationalhauptstadt Berlin – Wieviel Symbolik erträgt die Bundesrepublik Deutschland? .......... 7 2 Berlins historisch begründete Symbolfunktion und identitätsstiftende Relevanz ....................... 14 3 Berlins politische Hauptstadtarchitektur und deren Vermittlungsprozesse ................................. 22 3.1 Reichstagsgebäude ........................................................................................................................ 25 3.2 Denkmal für die ermordeten Juden Europas ........................................................................... 26 3.3 Brandenburger Tor ....................................................................................................................... 29 4 Forschungsgrundlagen, Forschungsstand und Methodik ............................................................... 30 B ZUR INTEGRIERENDEN UND IDENTITÄTSSTIFTENDEN FUNKTION VON SYMBOLEN ALS ELEMENTE MACHTSTRUKTURIERTER KOMMUNIKATIONSPROZESSE IM SOZIALEN RAUM 1 Die Bedeutung des Nationalstaats als symbolische Zurechnungseinheit und nationaler Identität -

Shaping Memory with Monuments: Diverging Representations of Holocaust Commemoration
Shaping Memory with Monuments: Diverging Representations of Holocaust Commemoration By Sarah Trager Friday, December 21, 2012 HIST 302 Final Paper TRAGER 1 Question How did the construction of Holocaust memorial and collective memory in Germany and Israel reflect and shape the national identity of each country? Introduction This essay examines Holocaust commemoration in contemporary Germany and Israel (1990s-present) by analyzing the correlation between each country’s public memory of the Holocaust and its structural manifestations. In particular, their memorials and museums came to represent each country’s view of the Holocaust. Because both countries have promoted several versions of their national Holocaust narrative since 1945, Yad Vashem and the “Memorial to the Murdered Jews of Europe” are emblematic of these shifting phases of national memory. An unimaginable tragedy, the Holocaust left deep imprints on German and Israeli societies. While both countries recognized that a Holocaust memorial would be unable to fully embody the horror victims had experienced, their decision to commemorate victims and survivors, was significant in shaping and reflecting their country’s collective memory of the Holocaust. Sixty years after the war, the two nations experienced significant shifts in this public memory. With the 2005 installation of Berlin’s “Memorial to the Murdered Jews of Europe,” Germany reaffirmed its responsibility for Nazi atrocities and declared the memorial to serve as a lasting, overt reminder to Germans to never forget this portion of their national history. That same year, the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem re-opened after a ten-year expansion. What once had largely been a tribute to the Jewish heroes and martyrs of the Holocaust, now included exhibits that highlighted victimhood and personal testimonies. -

Sprengsatz Auf Zwei Beinen
Deutschland MAHNMAL-DEBATTE Sprengsatz auf zwei Beinen Im Ausland erntet der designierte Staatsminister für Kultur, Michael Naumann, Anerkennung – in Bonn und Berlin wird der Quereinsteiger mißtrauisch beäugt. Sein Alternativ-Vorschlag zum Holocaust-Mahnmal löst nun heftigen Streit aus. Von Walter Mayr oben rauschen, Fliegen zwicken an Irritiert nimmt Naumann zur Kenntnis, Institut eine Stätte der Erinnerung in Ber- Männerhälsen. In zehn Minuten be- wie sich manche im Gestrüpp ihrer Funk- lin zu planen. Rginnt die Nobelpreis-Gala. „Vertre- tionen verheddern. Naumann solle doch Bei einem Essen mit Vertretern der jüdi- te ich Deutschland würdig?“ fragt Micha- sagen, daß er den Juden kein Denkmal set- schen Öffentlichkeit am 24. November in el Naumann. zen wolle, sagt Lea Rosh im Namen des der Residenz des deutschen Botschafters in Sein Gesicht sagt ja. Der Kulturbeauf- Förderkreises. „Es ist gut, daß sich in der Washington beugt Naumann dem Mißver- tragte der Bundesregierung genießt sich. festgefahrenen Situation in Berlin so kurz ständnis vor, Deutschland wolle sich aus der Smokingjacke und Kummerbund glattge- Mahnmal-Diskussion steh- strichen, zerteilt er leichten Fußes die Lob- len. Und ist ansonsten Ohr. by im Konzerthaus von Stockholm. Gleich Sich „Beglaubigungen muß König Carl Gustav kommen. und Lizenzen“ fern der Hei- Und dann José Saramago, Gewinner des mat zu besorgen sei typisch Literatur-Nobelpreises 1998, der an diesem für jene „über die ganze Abend verliehen wird. „Mein Freund“, Nachkriegszeit eingeübte sagt Naumann, „ich war sein Verleger.“ Er Geste der Unmündigkeit“, läßt sich nieder im abgedunkelten Parkett giftelt’s prompt aus dem und schiebt die Brille ins Haupthaar.Wann Wohnzimmer der nationa- immer von oben Scheinwerferlicht fällt, len Selbstfindungsgruppe, funkelt der deutsche Ehrengast wie ein dem Feuilleton der „Frank- Glühwürmchen bei Neumond. -

Erinnerung Und Geschichte 1994
Repositorium für die Medienwissenschaft Eike Wenzel, Gertrud Koch, Michael E. Geisler u.a. (Hg.) Augen-Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft. Heft 17: Erinnerung und Geschichte 1994 https://doi.org/10.25969/mediarep/673 Veröffentlichungsversion / published version Teil eines Periodikums / periodical part Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Wenzel, Eike; Koch, Gertrud; Geisler, Michael E. (Hg.): Augen-Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft. Heft 17: Erinnerung und Geschichte (1994). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/673. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under a Deposit License (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, non-transferable, individual, and limited right for using this persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses document. This document is solely intended for your personal, Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für non-commercial use. All copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute, or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the conditions of vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder use stated above. -
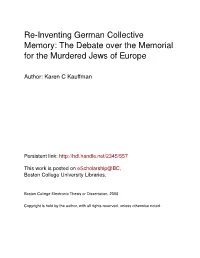
Re-Inventing German Collective Memory: the Debate Over the Memorial for the Murdered Jews of Europe
Re-Inventing German Collective Memory: The Debate over the Memorial for the Murdered Jews of Europe Author: Karen C Kauffman Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/557 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2008 Copyright is held by the author, with all rights reserved, unless otherwise noted. Re-Inventing German Collective Memory: The Debate over the Memorial for the Murdered Jews of Europe An Advanced Independent Research Project By Karen Kauffman Boston College History Department Class of 2008 Table of Contents Introduction . 1 Chapter 1 – Learning from the Holocaust: The Debate over Meaning and Responsibility . 21 Chapter 2 – Defining the Holocaust: The Debate to Determine its Victims . 54 Chapter 3 – Representing the Holocaust: The First Design Competition . 90 Chapter 4 – Representing the Holocaust: The Second Design Competition . 118 Conclusion . 146 Appendix A – Glossary of Key Terms . .. 161 Appendix B – Glossary of Key Names . 166 Appendix C – Chronology . 173 Appendix D – Publications and Political Parties . 183 Bibliography of Works Cited . 184 Acknowledgements Since I began work on what would become my thesis more than two years ago, studying German memory of the Holocaust has become much more than an academic pursuit. Engaging with this topic has developed into a personal passion, the apex of which is in the pages that follow. Whether this document is only an intermediate point in a longer career of historical study or the capstone achievement of my academic years, working on this project has been an incredibly meaningful experience for me academically and personally. -
Text Into Film and Beyond Germanistik in Ireland: Jahrbuch Der / Yearbook of the German Studies Assocation of Ireland (GSAI), Volume 7, 2012
UCC Library and UCC researchers have made this item openly available. Please let us know how this has helped you. Thanks! Title Adaptation: text into film and beyond Germanistik in Ireland: Jahrbuch der / yearbook of the German studies assocation of Ireland (GSAI), Volume 7, 2012 Editor(s) MagShamhráin, Rachel Strümper-Krobb, Sabine Publication date 2012 Original citation MagShamhráin, R. and Strümper-Krobb, Sabine (2012). Adaptation: text into film and beyond, Germanistik in Ireland: Jahrbuch der / Yearbook of the German Studies Assocation of Ireland (GSAI) Vol. 7. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag. Type of publication Book Link to publisher's https://germaninireland.wordpress.com/yearbook/ version Access to the full text of the published version may require a subscription. Rights © 2012. German Studies Association of Ireland Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/7828 from Downloaded on 2021-10-07T02:43:54Z GERMANISTIK IN IRELAND Jahrbuch der / Yearbook of the German Studies Association of Ireland (GSAI) Volume 7 2012 Special Issue: Adaptation: Text into Film and Beyond Editors: Rachel MagShamhráin (University College Cork) Sabine Strümper-Krobb (University College Dublin) Advisory Board: Gordon Burgess (Aberdeen) Klaus Kiefer (Munich) Florian Krobb (Maynooth) Bill Niven (Nottingham Trent) Klaus Dieter Rossade (Open University) Hans-Walter Schmidt-Hannisa (Galway) Liliane Weissberg (Pennsylvania) TABLE OF CONTENTS Introduction…………………...................................................................……… 5 ADAPTATION: TEXT INTO FILM -

Lea Rosh Publizistin Im Gespräch Mit Christoph Lindenmeyer
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0611/20061116.shtml Sendung vom 16.11.2006, 20.15 Uhr Lea Rosh Publizistin im Gespräch mit Christoph Lindenmeyer Lindenmeyer: Willkommen zum alpha-forum, meine Damen und Herren. Heute lernen Sie eine große und erfolgreiche Fernsehpublizistin kennen, eine Persönlichkeit, die sich immer wieder engagiert für das Gewissen und gegen das Vergessen. Herzlich willkommen, Lea Rosh. Gerade vor dieser Sendung habe ich erfahren, dass Sie im Förderverein des neuen Potsdamer Theaters sind, das im Jahr 2006 mit einer Uraufführung eröffnet wurde. Rosh: Mit fünf Premieren! Es waren fünf Premieren. Lindenmeyer: Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Gesprächs jedoch ist erst eine dieser Premieren gelaufen. Viele weitere werden aber noch kommen in diesem Jahr. Das ist ein wunderschönes Theater und Sie treiben privat das Geld dafür ein. Jetzt frage ich aber nicht, wie viel Geld fehlt, sondern ich frage Sie, wie oft Sie ins Theater gehen. Rosh: Ich gehe sehr viel ins Theater. Ins Hans-Otto-Theater gehe ich regelmäßig seit ungefähr einem Dreivierteljahr, seitdem Uwe Laufenberg dort Intendant ist. Aber ich bin in Berlin natürlich auch bis dahin schon sehr, sehr viel ins Theater gegangen: ins Deutsche Theater, in die Kammerspiele, ins Maxim Gorki Theater, wo ich sechs Jahre lang den Förderverein geführt und geleitet habe. Die Aufgabe von solchen Fördervereinen besteht darin, sich mäzenatisch zu engagieren für das Theater, denn der Staat – das sage ich den Leuten immer wieder – kann unsere Hochkultur nicht mehr finanzieren. Wir müssen also schon selbst dazu beitragen, wenn wir ins Theater oder in die Oper gehen wollen. -

Copyright @2011
CESAA Essay Prize Winner ANZJES 2(2)/3(1) Mastering the Unmasterable? Vergangenheitsbewältigung of Germany’s National Socialist past ISABEL GRELAK1 University of New South Wales [email protected] Abstract “The question about what nations should do about a difficult past is one of the great subjects of our time.”2 This essay engages with the process of Vergangenheitsbewältigung and asks the thorny question: how close is Germany to mastering a Nazi past notoriously described as “unmasterable”?3 Following discussion defining the scope of Holocaust victims and what overcoming the past entails, focus turns to the ‘Memorial to the Murdered Jews of Europe.’ Drawing insight from prominent discourse, its commemorative aims and functions are examined. Ultimately, it is concluded that whilst the memorial has brought Germany somewhat closer to coming to terms with its past by ensuring the Holocaust does not pass from public consciousness; it also consolidates a hierarchy of victims. Without seeking to diminish or challenge the suffering of the six million Jews killed in the Holocaust, this essay highlights the exclusive nature of commemorative practice in Germany, impeding its ability to come to terms with all of its Nazi crimes. Key words: Germany, Holocaust, memorial, Nazi, past, unmasterable. “The question about what nations should do about a difficult past is one of the great subjects of our time.”4 It is a question that touches all of humanity, yet presents no simple answers. It is amidst a backdrop of memory discourse engaging with this question that Germany’s struggle to master its National Socialist past has commanded global attention.