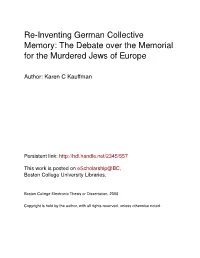Zurück in Deutschland, hört er Geschichte in München bei Eric Voegelin. Es ist die Zeit der Suche nach Parabeln zur Entstehung des Faschismus. Lange vor ’68 gilt der junge Heimkehrer aus den USA als Fixpunkt einer aufmüpfigen Uni-Szene, die in Schwabinger Schwemmen dialektisch aufrüstet – Debattierer messen sich, indem sie wortreich für das Gegenteil ihrer Überzeugung eintreten.
Naumann, bester Redner und seines
„dramatisch zerfurchten Gesichts am Klavier“ wegen Mädchenschwarm, gründet eine Zeitung, die als pro-kommunistisch verdächtigt und verboten wird. Er geht auf die Straße und promoviert über Karl Kraus.
Er wird Journalist bei „Zeit“ und SPIE-
GEL und später Rowohlt-Chef in Hamburg, schlägt Rad und läßt Federn als Verleger in NewYork. Im Sommer 1998 sitzt er
„Alleingang verhindern“
Der Vorschlag, in Berlin statt des Holocaust-Mahnmals ein Museum zu errichten, verärgert Experten und Bauherren.
or gut zehn Jahren lud eine tung. Folgerichtig verlangt Lea Rosh, West-Berliner Bürgerinitiative Naumann möge sich mit dem Förder-
V
unter Führung der Journalistin kreis und Berlin ins Benehmen setzen,
Lea Rosh erstmals zu einer öffentlichen bevor er unausgegorene Ideen in die Diskussion über den Bau eines „Denk- Welt setze. „Ein Alleingang des Bunmals für die ermordeten Juden Euro- des“, sagt auch der Chef der Berliner pas“ ein. Die Zahl der Vorschläge für Senatskanzlei, Volker Kähne, „muß ein solches Mahnmal, die seitdem er- verhindert werden.“ sonnen und publiziert wurden, dürfte inzwischen die 600 überschritten aufwendigen künstlerischen Wetthaben.
Die drei Auslober hatten nach zwei bewerben und drei Kolloquien den Entwurf von Richard Serra und Peter Eisenman favorisiert, doch eine Entscheidung vertagt. Geht es aber nach Naumann, soll jetzt aus dem geplanten Mahnmal ein Museum mit Bibliothek, Forschungs- und Ausstellungsstätte werden, garniert mit einem „Garten des Spiels und der Besinnung“.
Zur Finanzierung des multifunktionalen Museums, meint der künftige Staatsminister, könne ein Teil des 20000 Quadratmeter großen Grundstücks verkauft werden.Wie dann der bunte Mix auf einem verkleinerten Areal am Brandenburger Tor untergebracht werden soll, weiß auch er wohl noch nicht.
Ignatz Bubis, der dafür sorgte, daß
Helmut Kohl das bundeseigene Grundstück südlich des Brandenburger Tores für das Mahnmal zurVerfügung stellte, findet Naumanns radikale Umwidmung abwegig. „Ein Museum“, sagt der Präsident des Zentralrats der deutschen Juden, „ist doch kein Mahnmal und kann es auch nicht ersetzen.“
„Wie sich der Vorschlag in die bereits bestehende Erinnerungslandschaft einfügen könnte“, ist Michaele Schrey-
Mahnmal-Entwurf von Peter Eisenman: „ W iderstand leisten, auch in der Regierung“
am Maschsee in Hannover einem Zigarrenraucher gegenüber, der Kanzler werden will und einen Kulturminister braucht.
Naumann weiß, mit wem er es zu tun hat.
1988, im Arbeitsgerichtsprozeß zwischen dem Rowohlt-Verlag und Freimut Duve, hat er als Verlagschef und Beklagter den SPD- Politiker undAnwalt Gerhard Schröder kennengelernt. Damals sprach er keck: „Sie sind Oppositionsführer. Ein Mann, der gewinnen will. Dies hier ist für Sie eine verlorene Sache.“ Abwarten, erwiderte Schröder. Am Ende stand ein Vergleich.
Vergangene Woche präsentierte der er, der Vorsitzenden der grünen Frakdesignierte Staatsminister für Kultur, tion im Berliner Abgeordnetenhaus, Michael Naumann, einen neuen Vor- rätselhaft. Mit dem Haus derWannseeschlag, und seitdem ist die Verwirrung Konferenz, demnächst der „Topograin der hochkomplizierten Debatte phie des Terrors“ und dem Jüdischen
- komplett.
- Museum besitzt die Hauptstadt drei
War man in langer Diskussion dahin profilierte wissenschaftliche Institutiogelangt, daß der Bund, das Land Berlin nen, die über den Holocaust arbeiten und der Förderkreis von Lea Rosh als und aufklären. Hinzu kommen noch gleichberechtigte Finanziers und Bau- das Centrum Judaicum und das Zenherren das Denkmal errichten sollen, trum für Antisemitismusforschung.
- hat der Kulturbeauftragte jetzt „mit
- „Hätte Herr Naumann gewußt, was
voller Rückendeckung des Kanzlers“ es in Berlin bereits alles gibt“, vermuein Konzept entwickelt, das im Bun- tet Kähne, „hätte er sein Konzept modestag diskutiert, abgestimmt und dann difiziert.“ Der Senatskanzlei-Chef ist
Zehn Jahre später einigt man sich erneut
– Naumann macht Kultur im Kanzleramt.
Braucht einer Nähe zur Macht, der Sätze aus dem Sakko-Ärmel schüttelt wie: „Intelligenz ist kein Datum, das verfällt“? Einer, der im besten Sinn der Aufklärung von Zweifeln befallen ist und als Grundstimmung „depressive Zuversicht“ angibt?
- realisiert werden soll.
- sich zudem sicher, daß NaumannsVor-
Die mit dem Mahnmal befaßtenVer- schlag nicht der letzte in der Dauertreter des Landes Berlin und des För- debatte gewesen ist. derkreises erfuhren davon aus der Zei-
Michael Sontheimer
d e r s p i e g e l 5 2 / 1 9 9 8
31