Briefwechsel Mit M. Vasmer Aus Den Jahren 1950–1960
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cultural Changes in the Turkic World
Cultural Changes in the Turkic World © 2016 Orient-Institut Istanbul ISTANBULER TEXTE UND STUDIEN HERAUSGEGEBEN VOM ORIENT-INSTITUT ISTANBUL BAND 7 © 2016 Orient-Institut Istanbul Cultural Changes in the Turkic World edited by Filiz Kıral, Barbara Pusch, Claus Schönig, Arus Yumul WÜRZBURG 2016 ERGON VERLAG WÜRZBURG IN KOMMISSION © 2016 Orient-Institut Istanbul Umschlaggestaltung: Taline Yozgatian Titelfoto: Barbara Pusch Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-95650-181-4 ISSN 1863-9461 © 2016 Orient-Institut Istanbul (Max Weber Stiftung) Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung des Werkes außerhalb des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Orient-Instituts Istanbul. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikro- verfilmung sowie für die Einspeicherung in elektronische Systeme. Gedruckt mit Unter- stützung des Orient-Instituts Istanbul, gegründet von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ergon-Verlag GmbH Keesburgstr. 11, -
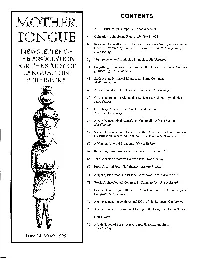
Mother Tongue 24 Must Be Put Out, After All! the Key Findings Will Simply Be Numbered- No Special Order
MOTHER CONTENTS ASLIP Business plus Important Announcements TONGUE 4 Obituaries: John Swing Rittershofer (1941-1994) 6 Reviews of Cavalli-Sforza et al's History and Geography of Human Genes. Reviewed by: Rebecca L. Cann, Frank B. Livingstone, and NEWSLETIER OF Hal Fleming THE ASSOCIATION 30 The "Sogenannten" Ethiopian Pygmoids: Hal Fleming FOR THE STUDY OF 34 Long-Range Linguistic Relations: Cultural Transmission or Consan lANGUAGE IN guinity?: Igor M Diakonoff 41 Statistics and Historical Linguistics: Some Comments PREHISTORY Sheila Embleton 46 A Few Remarks on Embleton's Comments: Hal Fleming 50 On the Nature of the Algonquian Evidence for Global Etymologies Marc Picard 55 Greenberg Comments on Campbell and Fleming Joseph H. Greenberg 56 A Few Delayed Final Remarks on Campbell's African Section Hal Fleming 57 Some Questions and Theses for the American Indian Language Classification Debate (ad Campbell, 1994): John D. Bengtson 60 A Note on Amerind Pronouns: Merritt Ruhlen 62 Regarding Native American Pronouns: Ives Goddard 65 Two Aspects of Massive Comparisons: Hal Fleming 69 Proto-Amerind *qets' 'left (hand)': Merritt Ruhlen 71 Arapaho, Blackfoot, and Basque: A "Snow" Job: Marc Picard 73 World Archaeological Congress 3. Summary by: Roger Blench 76 Comment on Roger Blench's Report on World Archaeological Congress: Hal Fleming 77 Announcement: Seventh Annual UCLA Indo-European Conference 78 Announcement: 11th Annual Meeting of the Language Origins Society 79 Quick Notes 86 A Valediction of Sorts: Age Groups, Jingoists, and Stuff Hal Fleming Issue 24, March 1995 MOTHER TONGUE Issue 24, March 1995 OFFICERS OF ASLIP (Address appropriate correspondence to each.) President: Harold C. -

N Achruf Für Karl Heinrich Menges
Türk DilleriAraştırmaları 9 (1999): 209-210 N achruf für Karl Heinrich Menges Gerhard Doerfer (Göttingen) Es gibt nur drei Rassenin der Welt: Führer, Geführte und Eremiten. Führer - das sind jene groBen Verführer der Völker, kriminelle Typen und Massenmörder wie Churchill, Hitler, Stalin, Truman; Geführte - das sind jene Massen, die den Führem törichterweise vertrauen; Eremiten: die groBen Einsamen, die sich vom Saıp.sara des Führens und Geführtwerdens abseİts halten. Karl Heinrich Menges war ein Eremit. In seinem Leben hat er stets seine eigene Position bewahrt. Man mag mit seinen Ansichten konform gehen oder sie ablehnen - aber was er tat und schrieb war voller Geist. Es ist nicht unbekannt, daB ich, sein Schüler, in Bezug auf die altaische Frage anderer Meinung bin. Aber ich kann nur die W orte eines Kollegen unterstreichen: "Hatten do ch alle Altaisten menges'sches Format, die Auseinandersetzung könnte ein intellektuelles Vergnügen sein!". K. H. Menges wurde am 22. April 1908 zu Frankfurt am Main geboren. Und den Akzent der alten'Reichsstadt hat er bis zu seinem Tode (20.9.1999) bewahrt. Geb~n wir ınm nun selbst das Wort: "Da ich Ende N ovember 1936 im Zusammenh~ng mit politischen Massenverhauftung~n, welche die Gestapo in Frankfurt am Main und Berlin vorgenommen hatte, ausführlich verhört wurde und dabei erkannte, daB meiner persönlichen Freiheit wie wissenschaftlichen Tatigkeit in Deutschland bald ein Ende bereİtet werden könnte, begab ich mich ... in die Emigration, zuerst nach der eSR, dann der Türkei, von wo ich 1940 an die Columbia University ... berufen wurde." Auch in der Emigration bewahrte er sich sein eigenes Urteil und geriet keineswegs zum bIinden Anbeter von Modetrends (wie des "Struktualismus"). -
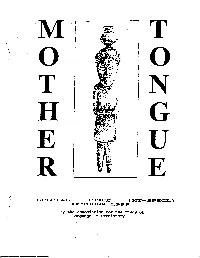
By the Association for the Study of Language in Prehistory MOTHER TONGUE Publication of the Association for the Study of Language in Prebistory
T / ~' '".;, ~ .,... 0 0 T N H G E u R E ,... SPEC:X:AL :X:SSUE (M'r-SPECL·) OCTOBER .1999 By the Association for the Study of Language In Prehistory MOTHER TONGUE Publication of the Association for the StudY of Language In Prebistory. Special Issue. October 1999 The Association for the study of Language In Prehistory (ASLIP) is a nonprofit organization, incorporated under the laws of the Commonwealth of Massachusetts. Its purpose is to encourage and support the study of language in prehistory in all fields and by all means, including research on the early evolution of human language, supporting conferences, setting up a data bank, and publishing a newsletter and a journal to report these activities. Membership: Annual dues for ASLIP membership and subscription to Mother Tongue are us $25 in all countries, except those with currency problems. For membership information, contact the Treasurer of ASLIP : Peter Horquest 1632 N. Santa Rita Tucson, Arizona (AZ) 85719 USA OFFICERS QF ASLIP (Address appropriate correspondence to each) President John D. Bengtson 1 156 15th Avenue NE I Minneapolis, MN 55413-1164, USA 1 Tel. 612-34·8-5910 Vice President Roger Williams Wescott 1 16-A Heritage Crest I Southbury, CT 06488 USA I Tel. 203-264-1716 Secretary Murray Denofsky 1 252 Medford Street, #809 1 Somerville, MA 02143 USA 1 Tel 617-625-8960 Treasurer Peter Norquest 1 1632 N. santa Rita 1 Tucson, Arizona (AZ) 85719 USA 1 Tel. 520-903-0648 BOABD OF DIRECTQRS Ofer Bar-Yosef (Peabody M, Harvard) Kenneth Hale (M,I.T.) Anne w. -
Central Files: Personal Name Subseries with Notes
Central Files: Personal Name Subseries with Notes Aalto, Alvar, file, 1964. (1 folder) 673/26 10/1964-11/1964 Records regarding an honorary degree from Columbia University that was awarded to Alvar Aalto, a Finnish architect and designer. Records include correspondence and a newspaper clipping. Abel, Elie, file, 1969-1971. (1 folder) 509/19 12/1969-6/1971 Correspondence between Elie Abel, Jeffery Loubat Professor and dean of the Graduate School of Journalism at Columbia University, and high level University administrators. Correspondence relates to the school. Topics include: faculty appointments, funding for the school, and budgeting. Abel, Theodore Fred, file, 1947-1948. (1 folder) 668/39 8/1947-5/1948 Correspondence between Theodore Fred Abel, professor of sociology and executive officer of the Department of Sociology at Columbia University, and the provost and secretary of the University. Correspondence relates to the department. Topics include faculty appointments, and budgeting. Abrams, Charles, file, 1966-1967. (1 folder) 36 /21 12/1966-8/1967 Correspondence between Charles Abrams and Columbia University administrators. Abrams was a professor of urban planning and director of the Institute of Urban Environment in the School of Architecture. Records relate to the institute, the school, and urban planning. Records include: correspondence regarding efforts to acquire grant funding for a study of urban minority problems to be conducted by the institute and the Division of Urban Planning; a copy of "The City," Abrams' address at the University of Chicago; a report by Abrams for the Community Renewal Program; and reports regarding urban renewal in Philadelphia and the use of computers by the urban planning division. -

Koreans in Central Europe (Reading Sample)
Contents Editor’s Note ix Introduction 1 Andreas SCHIRMER Glimpses of To Yu-ho’s Life in Europe and Korea 13 LEE Chang-hyun A Korean Who Taught Japanese in 1930s Vienna: Do Cyong-ho (To Yu-ho) (Based on Finnish and Japanese Sources) 33 OGAWA Yoshimi and Chikako SHIGEMORI BUČAR To Yu-ho in Vienna 45 Andreas SCHIRMER Pioneering, Prolific, Purged: Aspects of To Yu-ho 59 HONG Sŏn-p’yo Sound Recordings of Koreans in the Vienna Phonogrammarchiv: The Voices of To Yu-ho (1934) and Kim Kyŏng-han (1944) 77 Christian LEWARTH Memories of To Yu-ho: A Personal Reminiscence 92 Helga PICHT Notes from Moscow 97 HAN Hŭng-su / Ekaterina POKHOLKOVA (transl.) Han Hŭng-su in Vienna and Beyond: Puzzle Pieces of a Puzzling Life 111 Andreas SCHIRMER Han Hŭng-su in German-Occupied Prague 185 Zdenka KLÖSLOVÁ Han Hŭng-su Captured on Film 210 Zdenka KLÖSLOVÁ and Andreas SCHIRMER Han Hŭng-su in Postwar Prague and His Return to Korea 213 Zdenka KLÖSLOVÁ Bibliography of Han Hŭng-su: Published and Unpublished Books, Articles, and Translations 269 Jaroslav OLŠA jr. and Andreas SCHIRMER Alice Hyun: Spy or Revolutionary? 289 JUNG Byung Joon A Korean-American Physician Stranded and Despairing in the Czechoslovak Periphery: Dr. Wellington Chung 301 Vladimír HLÁSNY Contributors 315 Volume 1 Berlin Koreans and Pictured Koreans Introduction Andreas Schirmer The Berlin Koreans, 1909–1940s Frank Hoffmann Modular Spectacle: The 1904 Liebig Trading Card Set on Korea Frank Hoffmann Ultra-Right Modernism, Colonialism, and a Korean Idol: Nolde’s Missionary Frank Hoffmann Image Credits -

NEWSLETTER of the ASSOCIATION for the STUDY of LANGUAGE in PREIDSTORY Issue 11, September 1990
... T. T ·.N,.. H G E u R E NEWSLETTER OF THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LANGUAGE IN PREIDSTORY Issue 11, September 1990 ... ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LANGUAGE IN PREIDSTORY OFFICERS: Harold C. Fleming, President Allan R. Bombard, Vice President Anne W. Beaman, Secretary Mary Ellen Lepionka, Treasurer The Association for the Study of Language in Prehistory (ASLIP) is dedicated to exploring all aspects of distant relationship among the languages of the world. Membership dues (in U.S. dollars) are $10.00 for the United States and Canada, $16.00 for Latin America, and Western Europe, and $18.00 elsewhere. Inquiries, manuscripts and news items for inclusion in Mother Tongue, and applications for membership should be sent to: Allan R. Bombard, Vice President Association for the Study of Language in Prehistory 73 Phillips Street Boston, MA 02114-3426 U.S.A. --- ~----- ----------------------------------- ----------------- MOTHER TONGUE Issue 11, September 1990 TABLE OF CONTENTS 1. Allan R. Bombard: Some Nostratic Etymologies 2. Karl Krippes: The Altaic Component of a Nostratic Dictionary 3. A. Murtonen: Comments on Bombard's "Lexical Parallels between Proto-Indo-European and Other Languages" (Supplement to Mother Tongue 9) 4. Patrick C. Ryan: Pre-Nostratic "Pronouns": Early Noun Substitutions 5. Roger W. Wescott: Review of Colin Renfrew, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins 6. Meeting Notice: 6th International Conference on Austronesian Linguistics 7. Reprints: "Tracking Mother of 5,000 Tongues" (reprinted, with permission, from the February 5, 1990, issue of Insight magazine) "America's Talk: The Great Divide. Do Indian Languages Hold Clues to the Peopling of the New World?" (reprinted, with permission, from the June 9, 1990, issue of Science News) EDITOR'S PAGE 1. -

Briefwechsel Von Karl Heinrich Menges Und Gerhard Doerfer
Briefwechsel von Karl Heinrich Menges und Gerhard Doerfer Altaische Reminiszenzen Briefwechsel von Karl Heinrich Menges und Gerhard Doerfer aus den Jahren 1955–1985 herausgegeben und kommentiert von Michael Knüppel Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Verlag Traugott Bautz GmbH 99734 Nordhausen 2010 ISBN 978-3-88309-595-0 Inhalt Vorwort ................................................................................................. 7 1. Einleitung ................................................................................. 9 1.1 Karl Heinrich Menges – Leben und Werk ................... 13 1.2 Gerhard Doerfer – Leben und Werk ............................ 26 1.3 Biobibliographisches zu Karl Heinrich Menges (22.4.1908 –20.9.1999) ................................................ 34 1.4 Biobibliographisches zu Gerhard Doerfer (8.3.1920–27.12.2003) ................................................ 37 2. Konkordanz ............................................................................ 39 3. Der Briefwechsel ..................................................................... 41 4. Anhänge ............................................................................... 183 5. Abkürzungsverzeichnis ......................................................... 209 6. Literaturverzeichnis .............................................................. -

Karl August Wittfogel Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf2s20027x No online items Register of the Karl August Wittfogel papers Finding aid prepared by Linda Bernard and Katherine Reynolds Hoover Institution Library and Archives © 1997 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA 94305-6003 [email protected] URL: http://www.hoover.org/library-and-archives Register of the Karl August 66033 1 Wittfogel papers Title: Karl August Wittfogel papers Date (inclusive): 1728-1992 Collection Number: 66033 Contributing Institution: Hoover Institution Library and Archives Language of Material: English Physical Description: 408 manuscript boxes, 11 card file boxes, 2 oversize boxes, 6 album boxes, 61 envelopes, 1 oversize folder, 15 microfilm reels, 1 videotape cassette, 2 phonorecords, 19 slides(183.0 Linear Feet) Abstract: Speeches and writings, memoirs, correspondence, notes, studies, reports, printed matter, and audiovisual materials, relating to the history of China from ancient times to the twentieth century; the development of Chinese studies in the West; the concept of an Asiatic mode of production; and the history of German, Russian, Chinese and international communist movements. Includes some papers of Esther Schiff Goldfrank and G. L. Ulmen. Creator: Wittfogel, Karl August, 1896-1988 Creator: Goldfrank, Esther Schiff Creator: Ulmen, G. L. Hoover Institution Library & Archives Access The collection is open for research; materials must be requested at least two business days in advance of intended use. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Library & Archives Acquisition Information Acquired by the Hoover Institution Library & Archives in 1966. Preferred Citation [Identification of item], Karl August Wittfogel papers, [Box no., Folder no. -

Identifying the Huns and the Xiongnu (Or Not): Multi-Faceted Implications and Difficulties
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2020-09-14 Identifying the Huns and the Xiongnu (or Not): Multi-Faceted Implications and Difficulties Sun, Xumeng Sun, X. (2020). Identifying the Huns and the Xiongnu (or Not): Multi-Faceted Implications and Difficulties (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. http://hdl.handle.net/1880/112546 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Identifying the Huns and the Xiongnu (or Not): Multi-Faceted Implications and Difficulties by Xumeng Sun A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS GRADUATE PROGRAM IN HISTORY CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2020 © Xumeng Sun 2020 ii Abstract The origin of the Huns has been a myth since they made the first appearance in the Eastern Europe in the 370s CE. The early Roman and Gothic historians assume they came from the North, “the frozen ocean,” or the East, associated with the Alans. It was not until the eighteenth century that the French Orientalist Joseph de Guignes first proposed from the political perspective that the mysterious Huns came from Northeastern Asia, where the nomadic Xiongnu rose and became the most powerful enemy of Qin and Han dynasties (221BCE- 220 CE) in China. -

10-19 Sträter Dissertation FINALDATEI
DISSERTATION ZWISCHEN DEN ZEILEN. Das Öffentlichkeitsverständnis der Berufsbildung für Medien in den rohstoffreichen Golfstaaten. Grenzen und Chancen akademischer Expats aus dem Westen. VERFASSER Andreas Sträter, Master of Arts Journalistik Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Philosophie (Dr. phil.) der Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dortmund Betreuer: Prof. i.R. Dr. Horst Pöttker, Technische Universität Dortmund Zweitgutachter: Prof. Holger Wormer, Technische Universität Dortmund Dortmund, im Sommer 2019 2 Kurzzusammenfassung Die Dissertation mit dem Titel „Zwischen den Zeilen. Das Öffentlichkeitsverständnis der Be- rufsbildung für Medien in den rohstoffreichen Golfstaaten. Grenzen und Chancen akademi- scher Expats aus dem Westen“ beschäftigt sich mit dem journalistischen Selbstverständnis in der akademischen Berufsbildung für Medienberufe in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Katar. Aus einem westlichen Blickwinkel geht die Studie der Frage nach, mit welchem Selbst- und Öffentlichkeitsverständnis Professoren und Journalistenausbilder be- rufsbildende Medienfächer unterrichten. Dabei werden Grenzen ausgelotet innerhalb derer sich die Akteure, die aus freien, demokratischen Sphären stammen, vor Ort bewegen können. Im theoretischen Teil wird zunächst das journalistische Selbstverständnis westlicher Prägung gegen das einer nicht-demokratischen Sphäre gestellt. Entwickelt wird letzteres über theoreti- sche Modellierungen mithilfe der soziologischen Ansätze des Asienwissenschaftlers Karl -

D 25. Per/Coll.+Cont
3607 Transliterarion of non-Roman scripts in bibliographical references Hebrew characters and vocalization signs: ’= a, v = b(fricative), w = v, x = h , t' = y , kh = k (fricative), ‘ = o , f = f (fricative), c = c , q = q , ç = ß , sh = S , t = t , ë = shwa mobile, é = céré (e.g. sé = x4), e = segol (se = x3), á = qámác; a = patakh , ä = patakh furtivum; a⁄ = reduced a (an allophon of ë); vowels indicated by matres lectionis are transliterated with a circumflex: û = u, ô = &, î = i with a letter i, ê (or ey, if pronounced so) = e (céré ) with i, â = a with a mater lectionis a , but è = segol with i. Georgian characters: c = C, c’ = c, ch = Ç, ch’ = ç, ˝ = Z, g (and gh) = G , j = Û, k = K, k’ = k, p = P , p’ = p, q = q, sh = ß , t = T , t’ = t , x = x , zh = Ω . Where a capital letter for G is needed, we transliterate it as "gh". Armenian characters: b = b, c = c, c‘ = ç, ch = 4, ch‘ = ¢, d = d, dz = 3, e = e, ê = é, ë = `, ew = ú , g = g , gh = ¬, j = £, k = k, k‘ = ˚, p = p , p‘ = π , r = r , rr = ® , sh = 2, t = t , t‘ = † , x = x , y = j, zh = 1 . In the initial position e-= ye-. Transliteration of Coptic Letters: aa, vb, gg, dd, ee, zz, i e2, † t˙, Ii, k k, l l, m m, n n, ≈ x, o o, oy u, p p, r r, s s, t t, y w, f p˙, x k˙, π ps, O o2, W s7, F f, 3 X, £ (graphic variant of the prec.