Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Download
Early Theatre 9.2 Joanne Findon Napping in the Arbour in the Digby Mary Magdalene Play The turning point in the late medieval Digby Mary Magdalene play occurs when Mary Magdalene falls asleep in an arbour. This scene immediately follows her seduction in a tavern, and her words here indicate that she has given herself over to a life of sensuality. She has come to this arbour – a liminal space that partakes of both Nature and Culture – to await the arrival of one or more lovers. MARI: A, God be wyth my valentynys, My byrd swetyng, my lovys so dere! For þey be bote for a blossum of blysse! Me mervellyt sore þey be nat here, But I woll restyn in þis erbyre, Amons thes bamys precyus of prysse, Tyll som lovyr wol apere That me is wont to halse and kysse. [Her xal Mary lye doun and slepe in þe erbyre] (ll. 564-72)1 In her sleep, she hears the voice of an angel who repeats and recrafts her words, warning her “Ful bytterly thys blysse it wol be bowth!” (l. 589) and insisting that “Salue for þi sowle must be sowth” (l. 594) if she wishes to avoid eternal punishment. In repeating Mary’s word ‘blysse’, (l. 589) the angel highlights the price of unbridled sensual pleasure; his use of ‘bowth’ to echo Mary’s word ‘bote’ (l. 566) has a similar function. The angel’s ‘salue’ (l. 594) recalls the ‘bamys’ (l. 569) of the arbour which Mary sees as an appropriate setting for her encounter with her ‘valentynys’; yet of course these ‘bamys’ are intended for erotic attraction, while the ‘salue’ is for healing her soul of lust and pride. -
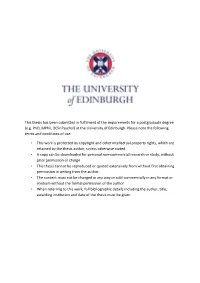
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G. Phd, Mphil, Dclinpsychol) at the University of Edinburgh
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Desire for Perpetuation: Fairy Writing and Re-creation of National Identity in the Narratives of Walter Scott, John Black, James Hogg and Andrew Lang Yuki Yoshino A Thesis Submitted to The University of Edinburgh for the Degree of Doctor of Philosophy Department of English Literature 2013 Abstract This thesis argues that ‘fairy writing’ in the nineteenth-century Scottish literature serves as a peculiar site which accommodates various, often ambiguous and subversive, responses to the processes of constructing new national identities occurring in, and outwith, post-union Scotland. It contends that a pathetic sense of loss, emptiness and absence, together with strong preoccupations with the land, and a desire to perpetuate the nation which has become state-less, commonly underpin the wide variety of fairy writings by Walter Scott, John Black, James Hogg and Andrew Lang. -

Wiccan Handbook
DPC DRAGON PALM CIRCLE Wiccan Handbook WiccanHandbook DRAGON PALM CIRCLE Wiccan Handbook Dragon Palm Circle Sevierville, TN 4th Edition July 2002 Compiled by Dreamweaver 1st edition January 1998 2nd edition March 2000 3rd edition August 2001 Table of Contents Introduction i Day 17 Lunar Magick 17 C H A P T E R 1 Lunar Cycles 17 Wiccan Rede 1 Lunar Month 18 Blessing for a Child 2 Witches Rune 2 Witches Creed 2 Charge of the Goddess 3 C H A P T E R 2 Signs 5 Number, planets, and signs 5 Number system for letters 6 C H A P T E R 3 Wiccan Rede 7 Three Fold Law 7 Wiccan Code of Chivalry 7 C H A P T E R 4 Calling Quarters 10 C H A P T E R 5 Colors 12 C H A P T E R 6 Herbs, stones, and colors 13 Eleminals 16 C H A P T E R 7 Introduction This is a book of information that include laws, poems, and what different things mean. This book is not a book to learn Wicca, but a handbook that contains some things that can be useful in putting together spells and rituals. The Wiccan Handbook This handbook has been put together to give you information you may need in forming rituals and participating in rituals. This will not include everything, but enough to get you started. Note about edition: Items are added and taken away depending upon the usefulness of the items. This is a good book to have in Circles for the Rede and Rune. -

This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from Explore Bristol Research
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from Explore Bristol Research, http://research-information.bristol.ac.uk Author: O Lynn, Aidan Anthony Title: Ghosts of War and Spirits of Place Spectral Belief in Early Modern England and Protestant Germany General rights Access to the thesis is subject to the Creative Commons Attribution - NonCommercial-No Derivatives 4.0 International Public License. A copy of this may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode This license sets out your rights and the restrictions that apply to your access to the thesis so it is important you read this before proceeding. Take down policy Some pages of this thesis may have been removed for copyright restrictions prior to having it been deposited in Explore Bristol Research. However, if you have discovered material within the thesis that you consider to be unlawful e.g. breaches of copyright (either yours or that of a third party) or any other law, including but not limited to those relating to patent, trademark, confidentiality, data protection, obscenity, defamation, libel, then please contact [email protected] and include the following information in your message: •Your contact details •Bibliographic details for the item, including a URL •An outline nature of the complaint Your claim will be investigated and, where appropriate, the item in question will be removed from public view as soon as possible. Ghosts of Place and Spirits of War: Spectral Belief in Early Modern England and Protestant Germany Aidan Anthony O’Lynn A dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts School of History August 2018 Word Count: 79950 i Abstract This thesis focuses on themes of place and war in the development of ghostlore in Early Modern Protestant Germany and England. -

Do Canto À Escrita: Novas Questões Em Torno Da Lírica Galego-Portuguesa – Nos Cem Anos Do Pergaminho Vindel
ESTUDOS 14 DO CANTO À ESCRITA: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa – Nos cem anos do pergaminho Vindel Graça Videira Lopes, Manuel Pedro Ferreira, eds. DO CANTO À ESCRITA: NOVAS QUESTÕES EM TORNO DA LÍRICA GALEGo-PoRTUGUESA – NOS CEM ANOS DO PERGAMINHO VINDEL IEM – Instituto de Estudos Medievais CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Coleção ESTUDOS 14 DO CANTO À ESCRITA: NOVAS QUESTÕES EM TORNO DA LÍRICA GALEGo-PoRTUGUESA – NOS CEM ANOS DO PERGAMINHO VINDEL Graça Videira Lopes Manuel Pedro Ferreira Editores Lisboa 2016 Comissão Científica: Ana Paiva Morais (Universidade Nova de Lisboa) José António Souto Cabo (Universidade de Santiago de Compostela) O Instituto de Estudos Medievais e o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (FCSH/NOVA) são financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Publicação financiada por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito dos Projectos UID/HIS/00749/2013 e UID/EAT/00693/2013. Título Do canto à escrita: novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa – Nos cem anos do Pergaminho Vindel Editores Graça Videira Lopes, Manuel Pedro Ferreira Edição IEM – Instituto de Estudos Medievais / CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Referência da CODAX, Martin, Las siete canciones de amor, poema musical del siglo XII: publícase imagem da capa en facsímil, ahora por primera vez, con algunas notas recopiladas por Pedro Vindel. Madrid: Pedro Vindel, 1915. Exemplar pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal. Colecção Estudos 14 ISBN 978-989-99567-0-4 (IEM) / 978-989-97732-5-7 (CESEM) Paginação e execução Ricardo Naito / IEM – Instituto de Estudos Medievais, com base no design de Ana Pacheco Depósito legal 406157/16 Impressão Europress – Indústria Gráfica Índice Apresentação .................................................................................................................... -

Georgetown University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in German
“‘ON THE VERGE OF HEARING’: EPISTEMOLOGY AND THE POETICS OF LISTENING IN THE HUMAN-NIXIE ENCOUNTER IN GERMAN LITERATURE” A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German By Deva Fall Kemmis Hicks, M.A. Washington, DC April 18, 2012 Copyright 2012 by Deva Fall Kemmis Hicks All Rights Reserved ii “‘ON THE VERGE OF HEARING’: EPISTEMOLOGY AND THE POETICS OF LISTENING IN THE HUMAN-NIXIE ENCOUNTER IN GERMAN LITERATURE” Deva Fall Kemmis Hicks, M.A. Thesis Advisor: G. Ronald Murphy, Ph.D. ABSTRACT This dissertation examines selected texts of German literature in which a human being gains access to knowledge outside human scope by means of an encounter with the water nixie, seen in her mythological variations as siren, water sprite, undine, melusine, nymph, or mermaid. Texts to be considered include Das Nibelungenlied (ca. 1200), Johann Wolfgang von Goethe’s “Der Fischer” (ca. 1779), Franz Kafka’s “Das Schweigen der Sirenen” (1917), Ingeborg Bachmann’s “Undine Geht” (1961), and Johannes Bobrowski’s “Undine” (1964). In each of these texts it is not the eyes that play the central role in the epistemological character of the human-nixie encounter, but the ears. In this project I argue that the human posture of attentive listening that precedes the encounter with the nixie indicates a state of readiness that leads to a moment of extraordinary awareness, in which the epistemological experience is transformational. Further, I suggest that poetry plays a pivotal role in the moment of epiphany, or of transformational knowing, for the reader. -

III. Literatur. 1
20 PETftt, ttoizzle- twigs', dial, word IV, 507. weathercock, use of the word III, 288, undertaker , 188, 212, 273; IV, 436, 334, 352. vouchsafe, substantive IV, 386. Wilie-beguiles HI, 125. Wright (Joseph), The English Dialect Dictionary. Pts. XXIV—XXVIII. Frowde. Bespr. Notes & Queries 10th Series 17, 377-, Zs. f. deutsche Wort- forschung VII, 4; Allgemeine Zeitung 237 (A. Schröer: Die Voll- endung des englischen Dialektwörterbuchs). — The English Dialect Grammar. 720 pp. H. Frowde. net, 6/. Bespr. Notes & Queries 10th Series IV, 377; The Athenaeum 4072; The Journal of English and Germanic Philol. VI, 4 (G. T. Flom). — Completion of English Dialect Dictionary. Cf. Notes & Queries 10th Series IV, 381. Wundt (W.), Völkerpsychologie. I. Die Sprache. 2. Aufl. II. Teil. Leipzig, Engelmann. M. 14. Bespr. Wochenschrift für klass. Philologie XXII, 23 (Schneidewin); Zs. f. roman. Philol. XXX, 4 (0. Dittrich); Neue Philol. Rund- scliau 1906, No. IS (J. Keller); Zs. f. deutsche Philol. XXXV1I1,4 (Fr. Kaufmann). Wyld (H. C.), The History of Old English Fronted (Palatalized) Initial in Middle and Modern English Dialects. On the Etymologies of the English Words blight and blain, chornels and Kernels. Otia Merseiana II. Williams & Norgate. Yorkshire Dialect Society. Transactions of. P. 6. Byles. Bradford. Zo6ga (G. T.), Icelandic-English Dictionary. S. hierzu Sigfus B Ion dal, Anmälan av Zoega etc. Arkiv for nordisk filologi XXII, 1. Literatur- blatt f. germ, und rom. Philol. XXVH, 7 (Gebhardt). III. Literatur. 1. Allgemeines. 8. die Rubriken: Aesthetik. Altenglieche Literatur. Amerikanische Literatur. Balladen. Biographien. Drama. Elisabethanieche Literatur £pos. .Eeeaya. Irische Literatur. Kritik. Legende. Liedersammlungen. Literaturgeschichte. Lyrik. Mittelenglische Literatur. -

Three Old French Narrative Lays
THREE OLD FRENCH NARRATIVE LAYS TROT, LECHEOR, NABARET Edited and translated by Glyn S. Burgess and Leslie C. Brook Liverpool Online Series Critical Editions of French Texts 1 Liverpool Online Series Critical Editions of French Texts Series Editor Timothy Unwin Editorial Board Peter Ainsworth Glyn Burgess Alan Howe Richard Waller Advisory Board David Bellos Rosemary Lloyd Beverley Ormerod Henry Phillips Gerald Prince Deirdre Reynolds Jean-Marie Volet Jane Winston Published by The University of Liverpool, Department of French Modern Languages Building Liverpool L69 3BX © Glyn Burgess and Leslie Brook All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers. Printed by Alphagraphics® Tel: 0151 236 0559 First published 1999 ISBN 0 9533816 0 9 Three Old French Narrative Lays Trot, Lecheor, Nabaret Liverpool Online Series Critical Editions of French Texts The aim of this series is to establish a resource bank of critical editions and translations of French texts. These are to be made available in electronic form, with parallel paper publication of a small number of copies of each item. Online versions of items in the series are designed to be viewed as an exact replica of the printed copies, with identical pagination and formatting. They are stored on the University of Liverpool server at the following URL: http://www.liv.ac.uk/www/french/LOS/ The texts are available in PDF (Portable Document Format) form, requiring the use of Adobe Acrobat Reader. -

Melusine Machine
MELUSINE MACHINE The Metal Mermaids of Jung, Deleuze and Guattari [Received January 28th 2018; accepted July 28th 2018 – DOI: 10.21463/shima.12.2.07] Cecilia Inkol York University, Toronto <[email protected]> ABSTRACT: This article takes the image of the feminine water spirit or mermaid as the focus of its philosophical contemplation, using her image as a map to traverse the thought- realms of Jung, Deleuze and Guattari. The feminine, watery symbol in this elaboration acts as the glue that enjoins the ideas of Jung with Deleuze and Guattari and reveals the imbrication of their ideas. Through their streams of thought, the mermaid is formulated as an emblem of technology, as a metaphor that makes reference to the unconscious and its technological involutions, her humanoid-fish form providing an image of thought or way of talking about the transformation of form, and the flitting, swimming valences at work in the unconscious. KEYWORDS: Jung, Deleuze, Guattari, mermaid, nixie, unconscious, technology Introduction This article pivots around a particular image — the feminine water spirit, embodied in her forms of mermaid, nixie 1 or water sprite — through the thought-architectures of the philosophers Jung, Deleuze and Guattari; it traces the filaments that connect these philosophers to this feminine image, as well as to one another, unfurling the imbrication and lineage of their ideas. Within the thought-structures of Deleuze, Guattari and Jung, her fluid figure is elucidated as an emblem of technology, as a metaphor that refers to the unconscious and its technological involutions; her humanoid-fish form providing an image of thought or way of talking about the transformation of form, and the flitting, swimming valences at work in the unconscious. -

Fairies, Kingship, and the British Past in Walter Map's De Nugis Curialium and Sir Orfeo
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Fairies, Kingship, and the British Past in Walter Map's De Nugis Curialium and Sir Orfeo Permalink https://escholarship.org/uc/item/8zh4b6x4 Author Schwieterman, Patrick Joseph Publication Date 2010 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Fairies, Kingship, and the British Past in Walter Map’s De Nugis Curialium and Sir Orfeo by Patrick Joseph Schwieterman A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Maura Nolan, Chair Professor Jennifer Miller Professor John Lindow Fall 2010 Fairies, Kingship, and the British Past in Walter Map’s De Nugis Curialium and Sir Orfeo © 2010 by Patrick Joseph Schwieterman Abstract Fairies, Kingship, and the British Past in Walter Map’s De Nugis Curialium and Sir Orfeo by Patrick Joseph Schwieterman Doctor of Philosophy in English University of California, Berkeley Professor Maura Nolan, Chair My dissertation focuses on two fairy narratives from medieval Britain: the tale of Herla in Walter Map’s twelfth-century De Nugis Curialium, and the early fourteenth-century romance Sir Orfeo. I contend that in both texts, fairies become intimately associated with conceptions of the ancient British past, and, more narrowly, with the idea of a specifically insular kingship that seeks its legitimization within that past. In Chapter One, I argue that Map’s longer version of the Herla narrative is his own synthesis of traditional materials, intended to highlight the continuity of a notion of British kingship that includes the pygmy king, Herla and Henry II. -

'Fairy' in Middle English Romance
'FAIRY' IN MIDDLE ENGLISH ROMANCE Chera A. Cole A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2014 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/6388 This item is protected by original copyright This item is licensed under a Creative Commons Licence ‘FAIRY’ IN MIDDLE ENGLISH ROMANCE Chera A. Cole A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the School of English in the University of St Andrews 17 December 2013 i ABSTRACT My thesis, ‘Fairy in Middle English romance’, aims to contribute to the recent resurgence of interest in the literary medieval supernatural by studying the concept of ‘fairy’ as it is presented in fourteenth- and fifteenth-century Middle English romances. This thesis is particularly interested in how the use of ‘fairy’ in Middle English romances serves as an arena in which to play out ‘thought-experiments’ that test anxieties about faith, gender, power, and death. My first chapter considers the concept of fairy in its medieval Christian context by using the romance Melusine as a case study to examine fairies alongside medieval theological explorations of the nature of demons. I then examine the power dynamic of fairy/human relationships and the extent to which having one partner be a fairy affects these explorations of medieval attitudes toward gender relations and hierarchy. The third chapter investigates ‘fairy-like’ women enchantresses in romance and the extent to which fairy is ‘performed’ in romance. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love.