Der Landesherr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
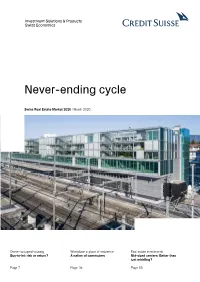
Never-Ending Cycle
Investment Solutions & Products Swiss Economics Never-ending cycle Swiss Real Estate Market 2020 | March 2020 Owner-occupied housing Workplace ≠ place of residence Real estate investments Buy-to-let: risk or return? A nation of commuters Mid-sized centers: Better than just middling? Page 7 Page 18 Page 55 Imprint Publisher: Credit Suisse, Investment Solutions & Products Nannette Hechler-Fayd’herbe Head of Global Economics & Research +41 44 333 17 06 nannette.hechler-fayd’[email protected] Fredy Hasenmaile Head Real Estate Economics +41 44 333 89 17 [email protected] Cover picture Building: Gleis 0, Aarau. Directly next to Aarau railway station: this residential and office building sets ecological, economic and social standards. Building owner: A real estate fund of Credit Suisse Asset Management. Printing FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, 8132 Egg bei Zürich Copy deadline February 3, 2020 Publication series Swiss Issues Immobilien Orders Directly from your relationship manager, from any branch of Credit Suisse. Electronic copies via www.credit-suisse.com/realestatestudy. Internal orders via MyShop quoting Mat. No. 1511454. Subscriptions quoting publicode ISE (HOST: WR10). Visit our website at www.credit-suisse.com/realestatestudy Copyright The publication may be quoted providing the source is indicated. Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG and/or affiliated companies. All rights reserved. References Unless otherwise specified, the source of all quoted information is Credit Suisse. Authors Fredy Hasenmaile, +41 44 333 89 17, [email protected] Alexander Lohse, +41 44 333 73 14, [email protected] Thomas Rieder, +41 44 332 09 72, [email protected] Dr. -

Aus: Verzeichnis Der Kirchenbücher Im Aargau, Hg. V. Schweizerischen Gesellschaft Für Familienforschung (Arbeitshilfen Für Familienforscher in Der Schweiz Nr
DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Kultur Bibliothek und Archiv Aargau – Staatsarchiv 17. August 2016 EINFÜHRUNG ZU DEN KIRCHENBÜCHERN IM AARGAU von Piroska R. Máthé aus: Verzeichnis der Kirchenbücher im Aargau, hg. v. Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung (Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz Nr. 11), Teilband 1, 2006, S. 11-29. Allgemeines Der Kanton Aargau als Inventarisierungsgebiet für Kirchenbücher ist sowohl historisch als auch kon- fessionell heterogen. • Historisch sind seit 1415/60 bis 1798 beziehungsweise bis zur Kantonsgründung 1803 grob um- rissen drei Untertanengebiete zu unterscheiden: der bernische Unteraargau mit den Bezirken Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg und Zofingen; die Gemeinen Herrschaften der eidgenössischen Orte in der Grafschaft Baden und in den Freien Ämtern mit den Bezirken Baden, Bremgarten, Muri und Zurzach; das vorderösterreichische Fricktal mit den Bezirken Laufenburg und Rheinfel- den. • Konfessionell erfolgte die erste Trennung 1528 mit der Einführung der Reformation im Unteraar- gau durch Bern; die katholisch verbliebenen Gebiete gehörten zu zwei Bistümern, nämlich zu Konstanz (rechts der Aare) und Basel, das als reorganisiertes Bistum seit 1828 für das ganze Kantonsgebiet zuständig ist. In den Randlagen der Grafschaft Baden gab es schon vor dem Sieg der reformierten über die katholischen Orte von 1712 konfessionell gemischte Gemeinden, oft mit Simultankirchen (s. a. Baden, Birmenstorf/Gebenstorf, Endingen/Tegerfelden, Würenlos, Zur- zach). Ein weitere konfessionelle -

Monuments Militaires Dans Le Canton D'argovie
1 Militärische Denkmäler im Kanton Aargau Inventar der Kampf- und Führungsbauten Monuments militaires dans le canton d’Argovie Inventaire des ouvrages de combat et de commandement Herausgeber und Vertrieb EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT armasuisse, Bereich Bauten Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern Redaktion Silvio Keller, Architekt HTL Maurice Lovisa, Architekt ETHL, Bern Patrick Geiger, lic. phil. I Übersetzung Übersetzungsdienst armasuisse, Clama ag, 3050 Schwarzenburg Konzept, Gestaltung Paola Moriggia, Bern Lektorat deutsch Jiri Kvapil, cand. iur. Lektorat französisch Übersetzungsdienst armasuisse, Clama ag, 3050 Schwarzenburg Titelbild: Geländepanzerhindernis Fisibach Mühlegässchen Bild rechts: Grenzwachtposten im Kraftwerk Laufenburg (Schweizerisches Bundesarchiv) Bisher sind in chronologischer Reihenfolge die nachstehenden Broschüren erschienen: TI, NE/JU, SH/TG, NW/OW/LU, SO/BL/BS, VS, GR, ZH, UR/SZ/ZG und AI/AR/GL/SG sowie ein Spezialheft über das ehemalige Artilleriewerk Foppa Grande im Tessin. Edition et publication DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS armasuisse, domaine des constructions Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne Rédaction Silvio Keller, architecte ETS Maurice Lovisa, architecte EPFL, Berne Patrick Geiger, lic. phil. I Traduction Service de traduction armasuisse, Clama ag, 3050 Schwarzenburg Conception, réalisation Paola Moriggia, Berne Relectures allemand Jiri Kvapil, cand. iur. Relectures français Service de traduction DDPS, Clama ag, 3050 -

Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008
Economic History Working Papers No: 250/2016 Multiple Core Regions: Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008 Christian Stohr London School of Economics Economic History Department, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE, London, UK. T: +44 (0) 20 7955 7084. F: +44 (0) 20 7955 7730 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT OF ECONOMIC HISTORY WORKING PAPERS NO. 250 - SEPTEMBER 2016 Multiple Core Regions: Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008 Christian Stohr London School of Economics Abstract This paper estimates regional GDP for three different geographical levels in Switzerland. My analysis of regional inequality rests on a heuristic model featuring an initial growth impulse in one or several core regions and subsequent diffusion. As a consequence of the existence of multiple core regions Swiss regional inequality has been comparatively low at higher geographical levels. Spatial diffusion of economic growth has occurred across different parts of the country and within different labor market regions at the same time. This resulted in a bell- shape evolution of regional inequality at the micro regional level and convergence at higher geographical levels. In early and in late stages of the development process, productivity differentials were the main drivers of inequality, whereas economic structure was determinant between 1888 and 1941. Keywords: Regional data, inequality, industrial structure, productivity, comparative advantage, switzerland JEL Codes: R10, R11, N93, N94, O14, O18 Acknowledgements: I thank Heiner Ritzmann-Blickensdorfer and Thomas David for sharing their data on value added by industry with me. I’m grateful to Joan Rosés, Max Schulze, and Ulrich Woitekfor several enlightening discussions. -

Jubiläumsausgabe 275 Jahre Schützengesellschaft Langenthal
Jubiläumsausgabe 275 Jahre Schützengesellschaft Langenthal www.sglangenthal.ch 1741 - 2016 Jubiläumsschrift 275 Jahre Schützengesellschaft Langenthal 1991 – 2016 Gesamtredaktion: Hans-Jörg Lüscher, Thunstetten Umschlaggestaltung: Paul Geiser sel., Grafiker ASG, Langenthal Innengestaltung: Cornelia Bärtschi, Langenthal Herstellung: Merkur Druck AG, Langenthal Vorausgegangene bestehende Werke: - 1741-1912 „Vereinschronik zur Fahnenweihe“ – 1913 erschienen - 1741-1941 „200 Jahre Schützengesellschaft Langenthal – 1946 erschienen - 1945-1966 „225 Jahre Schützengesellschaft Langenthal“ – Sonderausgabe „Echo vom Hinterberg“ – 1966 erschienen - 1741-1991 „250 Jahre Schützengesellschaft Langenthal“ – 1991 erschienen Vorwort Hans Rudolf Wyss, Ehrenmitglied und OK-Präsident BKSF 1991 Schon sind seit dem 250-Jahr-Jubiläum der Schützengesellschaft Langenthal (SGL) wieder 25 Jahre verflossen. Die Zeitspanne eines Vierteljahrhunderts zusammen zu fassen und für kommende Schützen-Generationen zu erhalten, ist die Aufgabe der vorliegenden „kleinen Festschrift“. 1991 feierte die SGL ihr hohes 250 jähriges Jubiläum im Rahmen des 31. Kantonalschützenfestes im Oberaargau. Die eigentliche Jubiläumsfeier mit der bemerkenswerten Festansprache des dama- ligen Bundesrats Adolf Ogi fand in einem grossen Festzelt am Ortsrand von Langenthal am Weg zur Schiessanlage Weier statt. Alle Höhepunkte aus der Vereinsgeschichte der SGL in den letzten 25 Jahren werden in dieser Schrift dargestellt. Bereits im Ausblick zur Festschrift aus dem Jahr 1991 haben die Verfasser auf die sich anbahnenden gesellschaftlichen und wehrpolitischen Veränderungen hingewiesen. Zwar wurden Volksinitiativen, die die Schweizer Wehrmänner „entwaffnen“ und die Schweizer Armee abschaffen wollten, vom Schweizer Volk deutlich verworfen. Aber die armeekritischen Kreise in der Bevölkerung werden in ihren Bemühungen, Armee und Landesverteidigung weiter zu schwächen, nicht nachlassen. Schützen tun darum gut daran, sich auch in Zukunft aktiv für den Erhalt einer glaubwürdigen Landesverteidigung zu engagieren. -

Bibliographie Der Schweizergeschichte Bibliographie De L'histoire Suisse Bibliografìa Della Storia Svizzera 2003
Bibliographie der Schweizergeschichte Bibliographie de l’histoire suisse Bibliograf ìa della storia svizzera 2003 Herausgegeben von der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern Publiée par la Bibliothèque nationale suisse, Berne Bibliographie der Schweizergeschichte Bibliographie de l’histoire suisse 2003 l’histoire de Bibliographie Schweizergeschichte der Bibliographie Pubblicata dalla Biblioteca nazionale svizzera, Berna Bibliographie der Schweizergeschichte Bibliographie de l’histoire suisse Bibliograf ìa della storia svizzera 2003 Herausgegeben von der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern Publiée par la Bibliothèque nationale suisse, Berne Pubblicata dalla Biblioteca nazionale svizzera, Berna 2006 ISSN 0378-4584 Redaktion / Pierre Louis Surchat Rédaction / Schweizerische Landesbibliothek / Bibliothèque nationale suisse Redazione: Hallwylstrasse 15 3003 CH-Bern E-Mail: [email protected] online: www.snl.ch/biblio Vertrieb: BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 CH-Bern Telefax 031 325 50 58 E-Mail [email protected] Internet www.bbl.admin.ch/bundespublikationen Diffusion / Diffusione: OFCL, Diffusion publications, 3003 CH-Berne Fax 031 325 50 58 E-Mail [email protected] Internet www.bbl.admin.ch/bundespublikationen Art. Nr. 304.545.d.f.i 10.06 500 157876 III Bemerkungen des Herausgebers Die seit 1913 regelmässig erscheinende Bibliographie der Schweizergeschichte erfasst die im In und Ausland erschienen Publikationen (Monographien, Sammelschriften, Zeitschriftenartikel und Lizenziatsarbeiten auf allen Arten von -

Die Gesellschaft Zu Schiffleuten in Bern 1342-2017
DIE GESELLSCHAFT ZU SCHIFFLEUTEN IN BERN 1342-2017 Der Gesellschaft zu Schiffleuten in Bern zum 675-jährigen Bestehen März 2017 Herausgegeben von der Waisenkommission Titelseite Schifflibecher des Berner Goldschmieds Hans Jakob Binder, Mitte 17. Jahrhundert, Silber, teilweise vergoldet, Höhe 35 cm, Gewicht 642 g. Depositum der Gesellschaft zu Schiffleuten im Historischen Museum Bern Inv. Nr. 15100 Aus der Mitte des Schiffs ragt ein Mast mit einem silbernen, geblähten Segel und einem schwarzroten Wimpel hervor. Auf dem kurzen Deck auf der Heckseite steht ein Steuermann in landsknechtartiger Kleidung und bedient ein langes Ruder. Die beiden Seitenwände des Schiffsrumpfes zieren breite ovale Medaillons mit getriebenen Darstellungen von Meeres- gottheiten mit Fischschwänzen: vom Heck aus gesehen auf der rechten Seite ein Triton, der das Horn bläst, auf der linken Seite Poseidon (?) mit bärtigem Haupt und einem Dreizack. Die Medaillons werden seitlich eingefasst von männlichen Maskarons, aus deren Bärten sich Blattvoluten entfalten. Das Schiff ruht auf einem Röhrenschaft, den drei silberne, kräftig ge- gossene Ohrmuschelbügel umfassen. An diesen hängen auf drei Seiten kleine, birnenförmige Bammeln. Das obere Schaftende umgibt ein Kranz von ausgeschnittenen silbernen Spiralblät- tern. Im unteren Teil des ovalen, zweistufigen Fusses winden sich über den Wulst hinweg zwei Meeresungeheuer mit zweiteiligem, schlangenartigem Leib. Der Mast besteht aus einer Röh- re, die unten mit kleinen Löchern versehen ist, so dass bei Entfernung des Wimpels und mit Wein gefülltem Schiff der Mast als Trinkröhrchen verwendet werden kann. Den selben Zweck erfüllt auch das abnehmbare hohle Ruder. Mittels eines kleinen Hahnens kann die Röhre ge- öffnet und geschlossen werden. Zitiert aus Robert L. Wyss, Handwerkskunst in Gold und Siber, herausgegeben von der Burgerbibliothek 1996 Dass, wann es nichts zu schiffen gibt, man sich des fischens notwendig behelfen muss. -

Pennsylvania Folklife Vol. 26, No. 5 Leo Schelbert
Ursinus College Digital Commons @ Ursinus College Pennsylvania Folklife Magazine Pennsylvania Folklife Society Collection Summer 1977 Pennsylvania Folklife Vol. 26, No. 5 Leo Schelbert Sandra Luebking Richard H. Hulan Edith Von Zemenszky David A. Rausch Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ursinus.edu/pafolklifemag Part of the American Art and Architecture Commons, American Material Culture Commons, Christian Denominations and Sects Commons, Cultural History Commons, Ethnic Studies Commons, Fiber, Textile, and Weaving Arts Commons, Folklore Commons, Genealogy Commons, German Language and Literature Commons, Historic Preservation and Conservation Commons, History of Religion Commons, Linguistics Commons, and the Social and Cultural Anthropology Commons Click here to let us know how access to this document benefits oy u. Recommended Citation Schelbert, Leo; Luebking, Sandra; Hulan, Richard H.; Von Zemenszky, Edith; and Rausch, David A., "Pennsylvania Folklife Vol. 26, No. 5" (1977). Pennsylvania Folklife Magazine. 74. https://digitalcommons.ursinus.edu/pafolklifemag/74 This Book is brought to you for free and open access by the Pennsylvania Folklife Society Collection at Digital Commons @ Ursinus College. It has been accepted for inclusion in Pennsylvania Folklife Magazine by an authorized administrator of Digital Commons @ Ursinus College. For more information, please contact [email protected]. SUMMER 1977 ..---_Contributors to this Issue_----. DR. LEO SCHELBERT, Evanston, Illinois, is professor of history at the University of Illinois, Chicago Circle, Chicago, Illinois. His specialty is the emigration and ethnic history of the United States. Among his recent books is Einfilhrung in die schweizerische AuswanderungsReschichte der Neuzeil (Zurich: Verlag SUiubli, 1976). His article in this issue will be of great use to Pennsylvania genealogists seeking materials on the Swiss backgrounds and emigra tion routes of American Mennonite families . -

Jahrbuch Des Oberaargaus 2001
JAHRBUCH DES OBERAARGAUS 2001 Werner Neuhaus, Oschwand, ca. 1922, Öl auf Papier, auf Karton, 57 × 72 cm Sammlung Anliker, Emmenbrücke Jahrbuch des Oberaargaus 2001 44. Jahrgang Herausgeber Jahrbuch-Vereinigung Oberaargau mit Unterstützung von Kanton und Gemeinden Umschlagbild Hans Zaugg: Ungebrauchte Pflüge rosten. Um 1975 Ein aktualisiertes Sachverzeichnis sämtlicher Jahrbücher ist im Internet unter www.oberaargau.ch/jahrbuch zu finden oder kann bei der Geschäftsstelle zum Selbstkostenpreis bezogen werden. Geschäftsstelle Mina Anderegg, 3380 Wangen a. A. Erwin Lüthi, 3360 Herzogenbuchsee Druck und Gestaltung: Merkur Druck AG, Langenthal Inhaltsverzeichnis Vorwort . 7 (Martin Fischer, Herzogenbuchsee) Gotthelf im Briefwechsel. 9 (Pierre Cimaz, Paris) Franz Eggenschwiler 1930–2000 . 31 (Peter Killer, Olten) Werner Neuhaus 1897–1934 – Ein Schüler Cuno Amiets . 45 (Anna Schafroth, Bern) Die Region Oberaargau – Entstehung, Begriff und Umfang im Wandel der Zeit . 74 (Anne-Marie Dubler, Bern) Der kirchliche Oberaargau vom Mittelalter bis zur Gegenwart . 115 (Simon Kuert, Langenthal) Der Mutzgraben – Ein kleines Molasse-Tal an der Grenze Oberaargau/Emmental. 140 (Christine Aeberhard, Oschwand, Walter Ischi, Oschwand, und Valentin Binggeli, Bleienbach) Ernst Glanzmann, die Atombombe und die radioaktiven Abfälle. 175 (Gerhart Wagner, Stettlen) Luzerner Milizen in Wiedlisbach, Sommer 1870. 182 (Werner Lustenberger, Luzern) Die Deutsche Quartärvereinigung im nördlichen Napfvorland – Exkursion vom 4. September 2000. 192 (Samuel Wegmüller, Mattstetten) -

Redistributive Instruments in Swiss Land Use Policy: a Discussion Based on Local Examples of Implementation
Unicentre CH-1015 Lausanne http://serval.unil.ch RYear : 2017 Redistributive instruments in Swiss land use policy: A discussion based on local examples of implementation Viallon François-Xavier Viallon François-Xavier, 2017, Redistributive instruments in Swiss land use policy: A discussion based on local examples of implementation Originally published at : Thesis, University of Lausanne Posted at the University of Lausanne Open Archive http://serval.unil.ch Document URN : urn:nbn:ch:serval-BIB_E738FB9AFB2A9 Droits d’auteur L'Université de Lausanne attire expressément l'attention des utilisateurs sur le fait que tous les documents publiés dans l'Archive SERVAL sont protégés par le droit d'auteur, conformément à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). A ce titre, il est indispensable d'obtenir le consentement préalable de l'auteur et/ou de l’éditeur avant toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre ne relevant pas d'une utilisation à des fins personnelles au sens de la LDA (art. 19, al. 1 lettre a). A défaut, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par cette loi. Nous déclinons toute responsabilité en la matière. Copyright The University of Lausanne expressly draws the attention of users to the fact that all documents published in the SERVAL Archive are protected by copyright in accordance with federal law on copyright and similar rights (LDA). Accordingly it is indispensable to obtain prior consent from the author and/or publisher before any use of a work or part of a work for purposes other than personal use within the meaning of LDA (art. -

Die Unteraargauer Rebellion Gegen Das Berner Aufgebot Zur Franzosenabwehr 1798 : Mit Zum Teil 1986 Erstmals Editierten Quellen
Die Unteraargauer Rebellion gegen das Berner Aufgebot zur Franzosenabwehr 1798 : mit zum Teil 1986 erstmals editierten Quellen Autor(en): Pestalozzi, Martin Objekttyp: Article Zeitschrift: Aarauer Neujahrsblätter Band (Jahr): 72 (1998) PDF erstellt am: 24.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-559057 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Martin Pestalozzi Die Unteraargauer Rebellion gegen das Berner Aufgebot zur Franzosenabwehr 1798 Mit zum Teil 1986 erstmals edierten Quellen Einleitung 1798 haben Revolutionäre und gegensteu- schloss sich 1111 Frühjahr 1798 — wenn auch ernde Aarauer und Aargauer vieles schritt- zögernd -, sich und 1 lelvetien gegen allfäl- lieh festgehalten,jedoch auch wieder nicht lige Franzoseneinmärsche militärisch zu genug, um alle Schritte zu erkennen. -

Das Volksschulwesen Des Kantons Aargau in Den Ersten Hundert Jahren
Das Volksschulwesen des Kantons Aargau in den ersten hundert Jahren Autor(en): [s.n.] Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Beiträge zur Aargauergeschichte Band (Jahr): 10 (2001) PDF erstellt am: 10.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 1. Das Volksschulwesen des Kantons Aargau in den ersten hundert Jahren 1.1 Gesamteuropäische Grundlagen Das aargauische Bildungswesen heute und auch im neunzehnten Jahrhundert wäre nicht denkbar ohne die Institution einer «Volksschule». Darunter verstehen wir eine staatlich geleitete Schule, deren Besuch für alle Staatsbürger obligatorisch ist.1 Der Begriff der Volksschule ist eine Frucht der Aufklärung, ihre Wurzeln reichen allerdings weit vor die Aufklärung zurück.