Gemeinde Leutenbach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
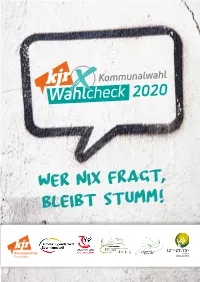
Wer NIX Fragt, Bleibt Stumm!
Kommunalwahl Wahlcheck 2020 WER NIX FRAGT, BLEIBT STUMM! Kreisjugendring Forchheim 2 Kommunalwahl Wahlcheck 2020 Die Landrats- und Bürgermeisterkandidat/-innen standen wieder im Mittelpunkt des „Wahlchecks zur Kommunalwahl 2020“, einer Aktion, die der Kreisjugend- ring Forchheim – vertreten durch den amtierenden Vorsitzenden Thomas Wil- fling – zusammen mit den Kommunalen Jugendpflegerinnen Ursula Albuschkat und Stefanie Schmitt initiiert hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit einem persönlichen Brief ein- geladen, an der Befragung teilzunehmen. Hierfür wurden unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Fragen gesammelt, die diese den Lokalpolitiker/-in- nen stellen wollten. Ebenfalls beteiligt waren die Delegierten der KJR-Vollver- sammlung als Vertreter/-innen der Vereine und Verbände. Zusammengekommen sind eine Vielzahl von Fragen, die Kinder und Jugendliche sowie Vereins- und Verbandsvertreter unseres Landkreises aktuell beschäftigen. Gemeinsam mit den Gemeindejugendpfleger/-innen der Städte und Gemeinden Ebermannstadt, Eggolsheim, Gräfenberg, Weißenohe, Hausen, Heroldsbach und Hallerndorf wurden acht Fragen ausgewählt, die stellvertretend für die vielen jungen Menschen im Landkreis Forchheim gestellt werden sollen. Bis Donnerstag, den 27. Februar 2020 bestand die Möglichkeit, die ausgefüll- ten Fragebögen an den KJR zurückzusenden. Die Ergebnisse aller Fragebögen wurden ungefiltert – also auch ohne Korrekturen – abgedruckt und sind seit dem 02. März 2020 unter www.kjr-forchheim.de der interessierten Öffentlich- keit zugänglich. Im Nachgang der Kommunalwahl 2020 möchten der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen mit den gewählten Bürgermeister/-innen ins Gespräch kommen. Hierzu sind Besuche vor Ort geplant, um gemeinsam das The- ma Kinder und Jugendliche sowie die Jugendarbeit vor Ort zu beleuchten. Der Kreisjugendring und die Kommunalen Jugendpflegerinnen bedanken sich für die Unterstützung und freuen sich auf interessante Gespräche mit den zukünfti- gen Bürgermeisterkandidat/-innen und Landrat. -

Egloffsteiner Kirchenbote
Egloffsteiner Kirchenbote Dezember 2019/ Januar 2020 S. 2-3 Andacht S. 5+9 Termine S. 10+11 Rückblicke S. 12+14 Gottesdienste S. 16 Dekanatssynode S. 18 Allianzgebetswoche Einladung S. 20+21 Rückblick Glaubenstag S. 22+23 Sammlungen/Kasualien Sie können uns auch Online lesen unter: www.egloffstein-evangelisch.de Nachgedacht Dez / Jan 19/20 Durch den Dezember begleitet uns als Monatsspruch folgender Vers: „Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott.“ (Jesaja 50,10). „Wer im Dunkeln lebt...“ also das klingt nicht nach einer normalen Nacht oder einem kurzen Stromausfall. Das dauert länger, das umfasst alle Lebensbereiche. Das ist heftig. Und dann geht der Vers ja noch weiter: „Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet“. Nicht nur, dass es an sich überall dunkel ist – es gibt nicht ein- mal die Möglichkeit, irgendwie zwischendrin Licht zu machen. Keine Kerze, kein Feuerzeug, nichts. Das ist heftig. Wie ging der Vers nochmal weiter? „Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott.“ Wow. Im Dunkeln leben, ohne die Möglichkeit auch nur kurz ein Licht zu ma- chen – und dann soll man Vertrauen haben? Wenn man doch nichts sieht? Wie soll das gehen? Der Monatsspruch sagt: „Vertraue auf den Namen des Herrn“. Wie ist denn der Name Gottes in der Bibel? Im Alten Testament lautet er „Jahwe“. Das kann man übersetzen mit „Ich bin der, der ich bin“ oder „Ich bin für euch da“. -

Regional Informativ Aktuell
regional informativ aktuell 29. Jahrgang 27. Januar bis 10. Februar 2021 Ausgabe 2 schwabachbogen.de Adlitz · Atzelsberg · Baad · Buckenhof · Dormitz · Ebersbach · Ermreuth · Großenbuch Hetzles · Honings · Kleinsendelbach · Marloffstein · Neunkirchen am Brand Rathsberg · Rödlas · Rosenbach · Schellenberg · Spardorf · Steinbach · Uttenreuth · Weiher 2 Notdienste und wichtige Rufnummern Wichtige Rufnummern Ärztetafel Polizei 110 Uttenreuth (0 91 31) Spardorf (0 91 31) Allgemeinmedizin/ chirurgisch-orthopädische Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt 112 Akupunktur Sportmedizin, Unfallchirurgie Dres. Überla/Junge Dres. Lang / Pauletta 5334499 Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach VG 09134 99690 Gemeinschaftspraxis 58181 D-Ärzte der Berufsgenossenschaft Neunkirchen am Brand VG 09134 7050 Anästhesie und ambulante Operationen Uttenreuth VG 09131 50690 K. Koschinsky 533353 Praxis für Ergotherapie Rehakrahl-Therapie 57272 Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131 760514 Augenärztin Praxis für Logopädie Polizeiinspektion Forchheim 09191 70900 Dr. M. Groh 533353 Elke Hoppe-Gürsch 9967669 Notruf bei Vergiftungen 0911 3982451 Dermatologie/Allergologie/ med. Kosmetik/Fußpflege Rehakrahl-Therapie 57272 Sozialstation u. Tagespflege Neunkirchen a. Br. 09134 1845 Dres. Bühler-Singer/Schuch Physiotherapie Caritas Pflegeheim Neunkirchen a. Br. 09134 99640 Gemeinschaftspraxis 53400 Rehakrahl-Therapie 57272 Hospizverein Landkreis Forchheim 09171 5730139 Ergotherapie HNO-Medizin/ Allergologie Diakoniestation Uttenreuth 09131 6301440 Ursula Sand 5330578 Dr. W. Wagner 507400 -

Öffnungszeiten Der Ausstellung: Samstag, 09.12.2017
Effeltrich - 2 - Nr. 24/17 Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag, 09.12.2017 15:00 - Eröffnung der Krippenausstellung durch das 15:15 - Jeki-Kinder Schule Effeltrich Christkind, mit Unterstützung des Musikvereins Bürgermeisterin Heimann und den Krippenfreun- 16:00 - Der Nikolaus kommt den, 18:30 - Ende der Ausstellung musikalische Umrahmung Musikverein Effeltrich Verkaufsstand Schule Effeltrich zugunsten Sternstunden 15:15 - Musikalische Darbietung der Kindergartenkinder im Außenbereich 15:30 - Der Nikolaus kommt Wunschzettelübergabe an das Christkind 18:30 - Ende der Ausstellung Verkaufsstand Elternbeirat Kindergarten im Außenbe- Wie jedes Jahr ist ein Verkaufsstand für Krippen, reich Figuren und Zubehör vorhanden. Wunschzettelübergabe an das Christkind Vor dem Rathaus wird ein kleiner Adventsmarkt statt- finden. Hier können sich die Besucher mit Bratwurst, Sonntag, 10.12.2017 Glühwein, Kaffee und Kuchen stärken. Auch dekora- 10:00 - Öffnung der Ausstellung tive Artikel, Schmuck, Spirituosen, Weine und Kräuter 15:00 - Jagdhornbläser Effeltrich werden angeboten. Der Eintritt ist frei. Wer jedoch 16:00 - Gesangsverein Effeltrich mit gemischtem Chor/ für einen sozialen Zweck etwas geben möchte, kann Kinder-und Jugendchor etwas in ein Spendenhäuschen einwerfen. 18:30 - Ende der Ausstellung Die Einnahmen aus den Spenden der Ausstellung Samstag, 16.12.2017 2016 wurden wie folgt verteilt: 10:00 - Öffnung der Ausstellung je € 500 für die Kirchenorgel Effeltrich und den Kin- 18:30 - Ende der Ausstellung dergarten Effeltrich Einzelführungen an diesem Tag nach Absprache möglich Sachspenden an die Grundschule und den Kindergar- ten Effeltrich Sonntag, 17.12.2017 10:00 - Öffnung der Ausstellung Wir, die „Krippenfreunde Effeltrich und Umgebung“, 15:00 - Begrüßung durch das Christkind u. Bürgermeis- freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen eine schöne terin Heimann und besinnliche Weihnachtszeit. -
On the Trail
EXPERIENCE HISTORY Discover the secrets of the Royal City ON THE TRAIL Every LITTLE CORNER charmingly Franconian. ON THE TRAIL OF KINGS. Forchheim, one of the oldest cities in Franconia, has preserved its medieval appearance with its many half-timbered houses and fortress. Archaeological excavations show that the Regnitz Valley, which surrounds Forchheim, was inhabited as long ago as prehistoric times. In the 7th century, the Franks established a small sett- lement here. Thanks to its transport-favourable location, it soon developed into an important centre of long-distance trade that even served as a royal court, particularly for the late Carolingian kings. « Embark on a voyage of discovery and enjoy a vivid experience of the history of Forchheim, a city steeped in tradition. SET OFF ON THE TRAIL: With our city map, you can discover the historical centre of Forchheim on your own. Take a stroll, or simply follow the attractions along the cobblestone lanes of splendid half-timbered houses. All the attractions can easily be reached on foot. EXPERIENCE MORE IN FORCHHEIM. Would you like to see another side of our city? Our tour guides will be happy to take you along! In addition to a guided, 90-minute tour, you can enjoy exciting theme tours such as a visit to the Forchheim fortifications, a Segway excursion or a look inside the local breweries. Of course, there is an exciting discovery tour for our little guests as well. You will find all the information about our guided tours at the Tourist Information Centre in the Kaiserpfalz Kapellenstraße 16 | 91301 Forchheim or online at www.forchheim-erleben.de All information supplied without guarantee. -

Das Trubachtal Entdecken!
Trubachtal-Wanderweg Streckenlänge 19 km Der Trubachtal-Wanderweg Höhenmeter xx hm Waldanteil Xx% Straße xx% Forstweg Xx% Pfad Xx% Kinderwagen nein Anfahrt nach Obertrubach / > Am Wasser entlang g > n i l Der 19 Kilometer lange, sehr abwechslungsreiche Hambur Hannover er B Das Trubachtal Kassel Bayreuth Wanderweg entlang der Trubach zählt zu den schöns- < D A7 Coburg o ten Wanderstrecken der Fränkischen Schweiz. Er führt rtmund an einem kleinen Mittelgebirgsfluss, der Trubach ent- Bamberg lang von Obertrubach über Egloffstein und viele kleine Ebermannstadt A9 entdecken! B 4 fränkische Dörfer bis nach Pretzfeld. Würzburg Forchheim 70 Pegnitz < Frankfu Egloffstein rt Das Wirken des Wassers ist auf B 470 Anschluß A3 A73 Ober- Schnaittach der gesamten Strecke allgegen- Erlangen trubach od. Plech wärtig. Da die Wegstrecke meist B2 direkt am Fluss liegt, begleitet das Wasser die Augen und Ohren auf < Stuttgart/ Ansbach Heilbronn A73 Nürnberg Amberg > Schritt und Tritt. Auf der gesamten A6 A6 g Wegstecke offenbart sich, dass die Trubach über Jahr- r A3 A7 B2 A9 f Regensburg > tausende das Landschaftsbild des Tals geprägt hat. Das r o eißenbu d s Trubachtal wurde schon früh von Menschen besiedelt, r / e < W m b und so gibt es auf dem Weg viele Ritteranwesen und l O U Mühlen, weitere Wahrzeichen des Tals, zu entdecken. < n Münche < Impressum Gemeinde Obertrubach Tel.: 09245 9880 Teichstraße 5 Fax: 09245 98820 D 91286 Obertrubach E-Mail: [email protected] Vorbei an Design und Umsetzung: Frankenjura.com Ritterburgen, Tel.: 09126 295044 Mühlen und Stromschnellen Eine Wanderung von Obertrubach über Egloffstein bis nach Pretzfeld SMG_AZ_80x25_Wanderflyer_Obertrubach_300714_ausgewaehlt.indd 1 04.08.2014 14:14:57 haupten, Hagenbach und Durch das Trubachtal Pretzfeld noch heute zum Teil von alten Adelsfamili- Die Wanderung beginnt an der Trubachquelle, am südlichen en bewohnt. -

Kreisgruppe Forchheim Infopost | Februar 2020
KREISGRUPPE FORCHHEIM IM BAYERISCHEN JAGDVERBAND E.V. INFOPOST | FEBRUAR 2020 KREISGRUPPE Neuer Jägerlehrgang 2020 (Prüfung Frühjahr 2021) FORCHHEIM Infoabend am 19.02.2020 um 19.30 h, Kursbeginn 04.März 2020 Ort: Hotel Schlossberg, Haidhof 5, 91322 Gräfenberg Anmeldung und Kontakt: Konrad Nebel 09197/495 oder e-mail: [email protected] Jahreshauptversammlung 2020, 1. März 2020, 15:00 Uhr In der Sportgaststätte Kersbach; nähere Informationen siehe Einladung. Tradition und Brauchtum Für Einsteiger und Interessierte zum Jagdhornblasen bitte Info an Gerhard Kaul, mobil 0172/9862759, e-mail [email protected] Jagdhornbläsergruppen unserer Kreisgruppe: • Jagdhornbläser Effeltrich, Kontakt: Josef Huppmann, mobil 0174-4099916, e-mail [email protected] • Bläsergruppe Störnhof, Kontakt: Hermann Kronas mobil 0175-4012003 • Jagdhornbläser Obertrubach u.U., Kontakt: Erich Fiedler mobil 0157-37035601 • Jagdhornbläsergruppe Weingartsteig, Kontakt: Hubertus Henglein, mobil 0173-5904430 • Bläsergruppe Ehrenbürg, Kontakt: Gerhard Kaul mobil 0172/9862759 Hundewesen Anmeldeversammlung zur Jagdhundeausbildung: 21. Februar um 19.30 Uhr Ort: Sportgaststätte Weingarts, Weingarts 180, 91358 Kunreuth Beginn Welpen/Dressurkurs: 26. März 18.00 Uhr, Hausen (Keimstraße 45) und in Gräfenberg, Egloffsteinerstraße 21: 29. März 09.00 Uhr Hinweis: Zugelassen zum Welpen-, Dressur und Brauchbarkeitskurs sind nur Jagdhunde mit anerkannten Papieren. Sie müs- sen auf der Ahnentafel den Sperlinghund oder F.C.I. und VDH im Zuchtbuch eines dem Jagdgebrauchshundeverband (JGHV) angeschlossene Zuchtverbandes oder Vereins eingetragen sein. Der Führer muss im Besitz eines gültigen Jagdscheines oder zum Jagdschein angemeldet sein. Mitzubringen bei der Anmeldung: gültiger Jagdschein, Orginal und Kopie der Ahnentafel, gültiger Impfpass des Hundes, Anmeldeformular (download unter www.jagd-forchheim.de) Kostenpunkt: 100,00 € für Mitglieder, 200,00 € für Nichtmitglieder der Kreisgruppe Brauchbarkeitsprüfung: 28./ 29.08.2020 Ansprechpartner: Claus-Dieter Schwager, Tel. -

Mitteilungsblatt Nr. 04 Vom 19.02.2016
Jahrgang 20 Freitag, den 19. Februar 2016 Nr. 4 Hinweis: Nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Jagdgenossen- schaft sind die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitglieds- Amtliche rechte verpflichtet, Veränderungen im Grundstückseigentum Bekanntmachungen unter Vorlage eines Grundbuchauszuges der Jagdgenossen- schaft nachzuweisen. gez.: Konrad (Jagdvorsteher) Jagdgenossenschaft Siegritz Einladung zur nichtöffentlichen Jagdversammlung am Mittwoch, 09.03.2016, 19:30 Uhr im Schützenhaus in Jagdgenossenschaft Neudorf Siegritz. Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung der Alle Jagdgenossen sind recht herzlich eingeladen. Tagesordnung: Jagdgenossen 1. Eröffnung Am Samstag, 05.03.2016 findet um 19:30 Uhr im Landgasthof 2. Protokoll Jagdversammlung 2015 Pennig in Neudorf eine nichtöffentliche Jagdversammlung statt. 3. Bericht Jagdvorsteher 4. Kassenbericht Tagesordnung: 5. Entlastung Vorstandschaft 1. Eröffnung und Begrüßung 6. Neuwahlen 2. Bericht des Jagdvorstehers 7. Wünsche u. Anträge 3. Kassenbericht 4. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft 5. Verwendung des Jagdpachterlöses 6. Bericht der Jagdpächter 7. Sonstiges, Wünsche und Anträge Helmut K r ä m e r Bei Eigentumsveränderungen sind diese zur Berichtigung des 1. Bürgermeister u. Jagdkatasters dem Jagdvorsteher mitzuteilen. kommissarischer Jagdvorsteher gez. Herbert Hänchen, Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Hohenpölz Jagdgenossenschaft Oberleinleiter Einladung zur ordentlichen Versammlung Einladung zur nichtöffentlichen Jagdversammlung der Jagdgenossen am Dienstag, 08.03.2016 um 20:00 Uhr im Gasthaus Ott am Samstag, 19.03.2016 um 20:00 Uhr im Bürgerhaus in Oberleinleiter. Hohenpölz. Tagesordnung: Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers 2. Bericht des Jagdvorstehers 2. Bericht des Kassenführers 3. Kassenbericht 3. Bericht der Rechnungsprüfer 4. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft 4. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 5. -

SB 07-20 Web
regional informativ aktuell 28. Jahrgang 1. bis 15. April 2020 Ausgabe 7 schwabachbogen.de Adlitz · Atzelsberg · Baad · Buckenhof · Dormitz · Ebersbach · Ermreuth · Großenbuch Hetzles · Honings · Kleinsendelbach · Marloffstein · Neunkirchen am Brand Rödlas · Rosenbach · Schellenberg · Spardorf · Steinbach · Uttenreuth · Weiher 2 Notdienste und wichtige Rufnummern Wichtige Rufnummern Ärztetafel Polizei 110Uttenreuth (0 91 31) Spardorf (0 91 31) Allgemeinmedizin/ chirurgisch-orthopädische Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt 112 Akupunktur Sportmedizin, Unfallchirurgie Dres. Überla/Junge Dres. Lang / Pauletta 5334499 Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach VG 09134 99690 Gemeinschaftspraxis 58181 Ergotherapie Neunkirchen am Brand VG 09134 7050 Anästhesie RehaKrahl 57272 Uttenreuth VG 09131 50690 K. Koschinsky 533353 HNO-Medizin/ Allergologie Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131 760514 Augenärztin Dr. W. Wagner 507400 Polizeiinspektion Forchheim 09191 70900 Dr. M. Groh 533353 Internist/Sportmedizin/ Akupunktur Notruf bei Vergiftungen 0911 3982451 Dermatologie/Allergologie/ med. Kosmetik/Fußpflege Dr. Müller/Dr. Seidel 533830 Sozialstation u. Tagespflege Neunkirchen a. Br. 09134 1845 Dres. Bühler-Singer/Schuch Praxis für Logopädie Caritas Pflegeheim Neunkirchen a. Br. 09134 99640 Gemeinschaftspraxis 53400 Elke Hoppe-Gürsch 9967669 Hospizverein Landkreis Forchheim 09171 5730139 Ergotherapie Physiotherapie Diakoniestation Uttenreuth 09131 6301440 Ursula Sand 5330578 RehaKrahl 57272 Hospizverein Eckental mit Umgebung 09126 2979880 Heilpraktiker Psychotherapie für Kinder, Martin Skoczynski 8147706 Jugendliche und Erwachsene Ärztetafel Homöopathie Dr. C. Wolfrom 533912 Dr. Freckmann-Nitschke 5300140 Radiologie Neunkirchen a. Br. (0 91 34) Buckenhof (0 91 31) Innere Medizin/Chirotherapie Privat und Selbstzahler Allgemeinmedizin Frauenärztin Hausärzte Dr. C. Göller 9965333 Dr. Metzler-Bertram/ Dr. Rita Bösl 501204 Dr. I. Gröger/Dr. Graemer 58511 Zahnmedizin Dr. Borchardt 993336 Zahnmedizin Krankengymnastik/ Dr. U. Schuck 52040 FA Dr. C. M. Pilz (MHBA) 601 Dr. C. -

SB 14 17 Web
regional informativ aktuell Interview mit unserer Kirchweihen Neu Kirschkönigin der Region Suchspiel Biene Seite 3 Seite 13, 15, 16, 23, Seite 36 25. Jahrgang 19.7. – 2.8.2017 Ausgabe 14 schwabachbogen.de Adlitz · Atzelsberg · Baad · Buckenhof · Dormitz · Ebersbach · Ermreuth · Großenbuch Hetzles · Honings · Kleinsendelbach · Marloffstein · Neunkirchen am Brand Rödlas · Rosenbach · Schellenberg · Spardorf · Steinbach · Uttenreuth · Weiher 2 Notdienste und wichtige Rufnummern Wichtige Rufnummern Ärztetafel Uttenreuth (0 91 31) Spardorf (0 91 31) Polizei 110 Allgemeinmedizin/ Internist/Sportmedizin/ Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt 112 Akupunktur Akupunktur Dres. Überla/Junge Dr. Müller/Dr. Seidel 533830 Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach 09134 99690 Gemeinschaftspraxis 58181 chirurgisch-orthopädische Sportmedizin, Unfallchirurgie Neunkirchen a. Br. am Brand VG 09134 7050 Anästhesie K. Koschinsky 533353 Dres. Lang / Pauletta 5334499 Uttenreuth VG 09131 50690 Augenärztin Zahnmedizin Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131 760514 Dr. M. Groh 533353 Dr. U. Schuck 52040 Polizeiinspektion Forchheim 09191 70900 Praxis für Logopädie Dermatologie/Allergologie/ Elke Hoppe-Gürsch 9967669 Notruf bei Vergiftungen 0911 3982451 med. Kosmetik/Fußpflege Sozialstation u. Tagespflege Neunkirchen a. Br. 09134 1845 Dres. Bühler-Singer/Schuch Caritas Pflegeheim Neunkirchen a. Br. 09134 99640 Gemeinschaftspraxis 53400 Kleinsendelbach (0 91 26) Hospizverein Landkreis Forchheim 09171 5730139 Ergotherapie Heilpraktiker Ursula Sand 5330578 Roland Schmitt 298920 Diakoniestation Uttenreuth 09131 6301440 Heilpraktiker Helmut Späth 2893796 Hospizverein Eckental mit Umgebung 09126 2979880 Martin Skoczynski 8147706 Krankengymnastik/Physio- therapie Homöopathie Ärztetafel Dr. Freckmann-Nitschke 5300140 Holger Paulke 2609470 Neunkirchen a. Br. (0 91 34) Buckenhof (0 91 31) Innere Medizin/Chirotherapie Privatpraxis für Ganzheitliche Massage Allgemeinmedizin Frauenärztin Hausärzte Edith Müller 2933199 FA Dr. C. M. Pilz (MHBA) 601 Dr. Rita Bösl 501204 Dr. I. -

Schönsten Wochen Des Jahres“ Liegen Vor Uns
47. Jahrgang www.neunkirchen-am-brand.de • 1.8.2019 Nr. 15 Schöne Ferien Das Schuljahr ist abgeschlossen und die „Schönsten Wochen des Jahres“ liegen vor uns. Einige werden sicherlich wegfahren und sich in der Ferne erholen. Aber auch zu Hause muss es nicht langweilig sein! Das Freibad bietet für „Jung und Alt“ ungetrübte Badefreuden. Unser Büchereiteam hält für alle Altersklassen spannende und unterhaltsame Literatur bereit. Die Durchführung des Ferienprogramms liegt in den Händen der Diakonie für Kinder und Jugend e. V., einem erfahrenen lokalen Partner in der Jugendarbeit. Die Ferienbetreuung übernehmen die Mitarbeiterinnen der OGTS. Allen die durch Ihren Einsatz mitwirken, unseren Kindern und Jugendlichen die Ferienzeit attraktiv zu gestalten sage ich auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Euch, liebe Kinder und Ihnen liebe Eltern eine abwechslungsreiche sonnige Ferienzeit, gute Erholung und einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 2019/2020. Viele Schulabgänger beginnen in der nächsten Zeit eine Ausbildung und damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen Aufgaben und Herausforderungen. Wer hierbei guten Willen zeigt, mitdenkt und engagiert ist, hat beste Chancen auf einen Erfolg versprechenden Einstieg. Allen „Azubis“ wünsche ich dabei viel Glück! Heinz Richter 1. Bürgermeister im Osten durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 477/9 4 Unterhalt Entwässerungs- 0.7000.5151 100.000,- € (nicht bebautes Privatgrundstück, Brache/ anlagen Neunk. Kirchweihfeste in unseren Ortsteilen Grünfläche), durch Teilflächen der Fl.-Nr. 5 Unterhalt Wasserleitungs- 0.8151.5159 50.000,- € 476 (Privatgrundstück mit Wohnbebauung), anlagen Rödlas vom 03.08. bis 04.08.19 und durch die Fl.-Nr. 475/4 (Privatgrundstück mit Gartenflächen, Gehölzbestand und Neben- 6 Neuer Friedhof 1.7511.9581 30.000,- € anlagen) und durch die Fl.-Nr. -

Regional Informativ Aktuell
regional informativ aktuell 29. Jahrgang 4. August bis 8. September 2021 Ausgabe 15 schwabachbogen.de Adlitz · Atzelsberg · Baad · Buckenhof · Dormitz · Ebersbach · Ermreuth · Großenbuch Hetzles · Honings · Kleinsendelbach · Marloffstein · Neunkirchen am Brand Rathsberg · Rödlas · Rosenbach · Schellenberg · Spardorf · Steinbach · Uttenreuth · Weiher 2 ALLES IST DRIN! Erlangen / Erlangen-Höchstadt: Die Bundestagskandidatin TINA PRIETZ über Ihre Ziele und Wünsche Notdienste und wichtige Rufnummern Hallo ich bin Tina Prietz, 28 Jahre alt und kandidiere Dafür braucht es eine Politik, die die Rahmen- als GRÜNE Direktkandidatin im Wahlkreis Erlangen / bedingungen so setzt, dass sich die Rücksichtnah- Wichtige Rufnummern Ärztetafel Erlangen-Höchstadt für den Bundestag. me auf Klima, Natur und auf den Menschen mit seinen Bedürfnissen lohnt. Eine Politik, die Bünd- Polizei 110 Uttenreuth (0 91 31) Spardorf (0 91 31) Der Einsatz für eine klimagerechte Welt bestimmt Allgemeinmedizin/ chirurgisch-orthopädische schon seit vielen Jahren mein Leben: von der nisse schmiedet auf der Grundlage gemeinsamer Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt 112 Akupunktur Sportmedizin, Unfallchirurgie Gründung des Jugendparlaments in Höchstadt, über Werte. Eine Politik, die offen ist für Neues und die Dres. Überla/Junge Dres. Lang / Pauletta 5334499 Bevölkerung direkt mit einbezieht. Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach VG 09134 99690 Gemeinschaftspraxis 58181 D-Ärzte der Berufsgenossenschaft die gemeinsame Organisation der ersten Fridays for Neunkirchen am Brand VG 09134 7050 Anästhesie und ambulante Operationen Future Demos in Erlangen und intensives Engage- Als Leiterin eines Erlanger Klimaschutzprojekts er- Uttenreuth VG 09131 50690 K. Koschinsky 533353 Praxis für Ergotherapie ment im Vorstand der Erlanger Grünen, bis hin zu fahre ich jeden Tag, was viele Menschen umtreibt, Rehakrahl-Therapie 57272 Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131 760514 Augenärztin Praxis für Logopädie meiner Stadtratsarbeit.