Russen XXL Gesamtwerk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN Fachgebiet Jagd Und Fischerei, Agrarwesen 2500 Baden, Schwartzstraße 50
BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN Fachgebiet Jagd und Fischerei, Agrarwesen 2500 Baden, Schwartzstraße 50 Beilagen E-Mail: [email protected] BNL2-J-08181/024 Fax: 02252/9025-22631 Bürgerservice: 02742/9005-9005 Internet: www.noe.gv.at - www.noe.gv.at/datenschutz Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) (0 22 52) 9025 Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum David Kaincz 22637 26. Mai 2020 Betrifft Grünvorlageverordnung 2020 Präambel Die Bezirksverwaltungsbehörde hat, wenn dies zur Überprüfung der verfügten Abschüsse erforderlich ist, mit Bescheid für einzelne oder mit Verordnung für mehrere oder sämtliche Jagdgebiete des Verwaltungsbezirkes die Jagdausübungsberechtigten zu verpflichten, in geeigneter Weise innerhalb einer bestimmten Frist den Abschuss von Wildstücken nach- zuweisen. Mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 24.04.2018, Zl. BNL2-J- 08181/021, wurde nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates die Grünvorlageverordnung 2018 erlassen. Zwischenzeitlich kam es zu personellen Änderungen der Grünbeschauorgane, die eine Abänderung und Neuerlassung der Grünvorlageverordnung notwendig machten. Der Bezirksjagdbeirat wurde dazu gehört. Verordnung § 1 Die Bezirkshauptmannschaft Baden ordnet an, dass der Abschuss von Rotwild in nach- stehenden Jagdgebieten entsprechend den Bestimmungen des § 2 dieser Verordnung nachzuweisen ist: GJ Alland, GJ Klein Mariazell, GJ Peilstein-Hafnerberg, EJ PVA Eigenjagd, EJ Urhaus Alland, EJ Holler, EJ Schwarzgraben, EJ Rehhof, EJ Gut Waldhof, EJ Heiligenkreuz, EJ Glashütten, EJ Kirschleiten, EJ Höherberg, -

The Long-Lasting Shadow of the Allied Occupation of Austria on Its Spatial Equilibrium
IZA DP No. 10095 The Long-lasting Shadow of the Allied Occupation of Austria on its Spatial Equilibrium Christoph Eder Martin Halla July 2016 DISCUSSION PAPER SERIES Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor The Long-lasting Shadow of the Allied Occupation of Austria on its Spatial Equilibrium Christoph Eder University of Innsbruck Martin Halla University of Innsbruck and IZA Discussion Paper No. 10095 July 2016 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 E-mail: [email protected] Any opinions expressed here are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but the institute itself takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research center and a place of communication between science, politics and business. IZA is an independent nonprofit organization supported by Deutsche Post Foundation. The center is associated with the University of Bonn and offers a stimulating research environment through its international network, workshops and conferences, data service, project support, research visits and doctoral program. IZA engages in (i) original and internationally competitive research in all fields of labor economics, (ii) development of policy concepts, and (iii) dissemination of research results and concepts to the interested public. IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. -

Republik Oesterreich
REPUBLIK ÖSTERREICH Organe der Bundesgesetzgebung. Wien, I/1, Parlamentsring 3, Tel. A19-500/9 Serie, A24-5-75. Dienststunden: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Nationalrat. Präsident: Leopold Kunschak. Zweiter Präsident: Johann Böhm. Dritter Präsident: Dr. Alfons Gorbach. Mitglieder. Cerny Theodor, Steinmetz- _ Scheff Otto, Dr., Rechtsanwalt; meister; Gmünd. ÖVP. Maria-Enzersdorf. ÖVP. (LB. = LirLksblock, Kommunistische Partei Österreichs. Dengler Josef, Arbeitersekretär; Scheibenreif Alois, Bauer; ÖVP. = Österreichische Volkspartei. — Wien. ÖVP. Reith 5 bei Neunkirchen. ÖVP. SPÖ. = Sozialistische Partei Österreichs. — VdU. = Verband der Unabhängigen.) Ehrenfried Anton, Beamter; Schneeberger Pius, Forstarbeiter; Hollabrunn. ÖVP. Wien. Burgenland. Eichinger Karl, Bauer; Wind— _ Seidl Georg, Bauer; Gaubitsch 76, passing 6. ÖVP. Post Unterstinkenbrunn. ÖVP Böhm Johann, Zweiter Präsident des Nationalrates; Wien. SPÖ. Figl Leopold, Dr. h. c., Ing., Singer Rudolf, Aufzugsmonteur; Bundeskanzler; Wien. ÖVP. St. Pölten. SPÖ. Frisch Anton, Hofrat, Landes— schulinspektor; Wien, ÖVP. Fischer Leopold, Weinbauer; Solar Lola, Fachlehrerin; Wien- Sooß, Post Baden bei Wien. ÖVP. Mödling. ÖVP. Nedwal Andreas, Landwirt; Gerersdorf bei Güssing. ÖVP. Floßmann Ferdinanda. Strasser Peter, Techniker; Wien. SPÖ. Privatangestellte; Wien. SPÖ. Nemecz Alexander, Dr., Rechts- Strommer Josef, Bauer; Mold 4, anwalt; Oberwarth 119 b. ÖVP. Frühwirth Michael, Textilarbeiter; Post Horn. Wien-Atzgersdorf. SPÖ. Proksch Anton, Leitender Sekretär Tschadck Otto, Dr., Bundes— des ÖGB.; Wien. SPÖ. Gasmlich Anton, Dr., Professor; Wien, VdU. minister für Justiz; Wien, SPÖ. Rosenberger Paul, Landwirt; Wallner Josef, Holzgroßhändler; DeutschJahrndorf 169. SPÖ. Gindler Anton, Bauer; Perndorf 13, Post Schweiggers. ÖVP. Amstetten, ÖVP. Strobl Franz, Ing., Landes- Widmayer Heinrich, Verwalter; forstdirektor; Wien. ÖVP. Gschweidl Rudolf, Lagerhalter; Puchberg am Schneeberg, Sier— Wien. -

Bezirkshauptmannschaft Baden Verordnung
BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN Fachgebiet Forstwesen 2500 Baden, Schwartzstraße 50 Beilagen E-Mail: [email protected] BNL1-A-0814/036 Fax: 02252/9025-22611 Bürgerservice: 02742/9005-9005 Internet: www.noe.gv.at - www.noe.gv.at/datenschutz Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) (0 22 52) 9025 Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum D.I. Wolfgang Pfalz 22629 03. Mai 2021 Betrifft Waldbrandverordnung 2021 Auf Grund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse und der damit einhergehenden Trockenheit sowie der damit verbundenen erhöhten Gefahr von Waldbränden ergeht gemäß § 41 Absatz 1 des Forstgesetzes 1975 nachstehende VERORDNUNG der Bezirkshauptmannschaft Baden, mit welcher forstpolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung von Waldbränden im Verwaltungsbezirk Baden erlassen werden. § 1 Im gesamten Verwaltungsbezirk Baden ist in den Wäldern sowie in Waldnähe jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer, sowie das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen wie z.B. Zündhölzer und Zigaretten, aber auch Glasflaschen und Glasscherben (Brennglaswirkung) im Waldbereich und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sowie das Rauchen verboten. § 2 Ausgenommen von diesem Verbot sind behördlich genehmigte Grillplätze, sofern nichts Anderes bestimmt wird. § 3 Das Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot stellt eine Verwaltungsübertretung nach § 174 Abs. 1 lit. a Ziff. 17 des Forstgesetzes dar und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 7.270,- oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft. § 4 Diese Verordnung wird an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Baden sowie an den Amtstafeln der Gemeinden des Verwaltungsbezirkes kundgemacht und tritt diese Verordnung an dem ihrer Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Baden folgenden Tag in Kraft. Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31.10.2021 außer Kraft. - 2 - Ergeht an: 52. -

Ab-Hof-Produkte Ebreichsdorf Fertig 2018 07 11
Ab-Hof-Produkte direkt vom Bauernhof Ebreichsdorf Name und Adresse Kontakt Produkte Öffnungszeiten Fehrer Ferdinand 0699/12037419 Erdäpfel, Kürbiskernöl, Leindotteröl, Leindottermehl Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr Untere Hauptstraße 2 0664/73865683 2443 Detusch-Brodersdorf ab Herbst 2018 Gratzer Friedrich 0664/7939558 Erdäpfel, Kernobst, Apfelsaft, Edelbrände nach telefonischer Vereinbarung Obere Hauptstraße 12 2443 Deutsch-Brodersdorf Soni`s Hofladen 0699/11721111 Krautsalat, Sauerkraut, Sauergemüse, Erdäpfel, Zwiebel, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Petschina Sonja Saisongemüse, Marmeladen, Sirup, Kräutersalze, … und 14 bis 18 Uhr Unterzeile 11 Dienstag und Samstag 8 bis 13 Uhr 2444 Seibersdorf Sonderer Erich 0699/10534505 Sauerkraut, Krautsalat, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr Oberzeile 7 [email protected] Kürbiskernöl, Frischkraut 2444 Seibersdorf Hofladen Famile Wildt Tel. & Fax: 02255/6440 Bauernbrot, Selchwaren, Würste, Blutwurst, Schmalz…. Dienstag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr, Marktplatz 11 0676/7036907 Sauerkraut, Sauergemüse, Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr 2444 Seibersdorf www.hofladen-wildt.at Obst und Gemüse nach Saison, Teigwaren, Eier, Honig, Fuchtaufstriche, Most, Schnaps, Likör,…. Sonderer Heinz "Krautexpress" 0676/3369077 Sauerkraut, Krautsalat, Rüben, Sarma, Sauergemüse, Montag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr Marktplatz 6 www.krautexpress.at Kürbiskernöl, Wir liefern Ihre Bestellung auch gerne an Sie aus! 2444 Seibersdorf [email protected] -

Raum Baden Zwischen 1933 Und März 1938. Fallbeispiel
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Raum Baden zwischen 1933 und März 1938. Fallbeispiel Baden und Traiskirchen (Möllersdorf)“ Verfasserin Veronika Oeller angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A190 313 299 Studienrichtung lt. Studienblatt: Lehramtsstudium UF Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung; UF Psychologie und Philosophie Betreuerin / Betreuer: Univ.-Doz. Fr. Dr. Irene Bandhauer-Schöffmann Danksagung Besonderen Dank an meine Eltern, für ihre Unterstützung, ihr Vertrauen und ihre Geduld. Ebenso bedanke ich mich bei meinen Freunden und Verwandten, die mich moralisch immer aufgebaut haben. Herzlichen Dank an Univ.- Doz. Fr. Dr. Irene Bandhauer-Schöffmann für ihr Engagement bei meiner Betreuung für die Diplomarbeit. Danke auch die Leiter und MitarbeiterInnen der verschiedenen Archive, die mir die Arbeit im Archiv erleichtert haben Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG .......................................................................................................................... 1 1.1 ÜBERBLICK ÜBER DIE POLITISCHE ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH WÄHREND DER 1930 ER JAHRE ...................................................................................................................................... 4 2 WIRTSCHAFT UND KRISE ...................................................................................................... 9 2.1 DER KURBETRIEB IN BADEN ............................................................................................ 11 2.2 -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens. -
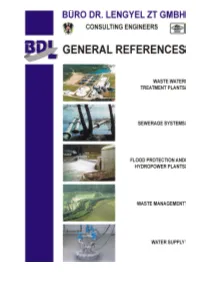
Brochure.Pdf
Municipal Wastewater Treatment Plants We design and supervise the construction of mechanical and biological wastewater treatment plants (WWTP), primarily with anaerobic sludge treatment, fulfilling the highly strict norms of Austrian environ- mental regulation. We also upgrade existing plants and are therefore able to equip our projects with state of the art technology. CITY / WWTP REGION / COUNTRY CAPACITY (P.E.) Linz Upper Austria 950.000 Graz Styria 400.000 Schwechat/AWV Lower Austria 300.000 Villach Carinthia 200.000 Großraum Bruck/L.-Neusiedl/See/AWV Lower Austria 135.000 Bezirk Jennersdorf/AWV Burgenland 90.000 Leoben/RHV Styria 90.000 Traunsee-Nord/RHV Upper Austria 106.000 Pinzgauer Saalachtal/RHV Salzburg 80.000 Neusiedler See-Westufer/RHV Burgenland 66.500 Lainsitz, AWV Lower Austria 50.000 Kapfenberg/Mürzverband Styria 49.000 WWTP Tehran South (Completion 2007) Iran 2.100.000 Jinan China 1.200.000 Krapkowice Poland 140.000 Celje Slovenia 85.000 Makedonski Brod Mazedonia 5.000 Industrial Wastewater Treatment Plants We design and supervise the construction of wastewater treatment plants for a variety of industries in Austria and other European countries. Anaerobic treatment is applied for wastewater with high COD loads. COMPANY REGION CAPACITY Jungbunzlauer AG, citric acid production Lower Austria 140,0 t COD/d Hollabrunn, potato processing Lower Austria 24,0 t COD/d Ybbstaler, fruit and vegetable processing Lower Austria 15,0 t COD/d Gösser Brauerei, brewery Styria 12,0 t COD/d W.Hamburger, paper mill Lower Austria 25,0 t COD/d SCA Hygiene Austria GmbH, paper mill Lower Austria 8,4 t COD/d Brigl&Bergmeister, paper mill Styria 3,5 t COD/d Lyocell Lenzing AG, cellulose fiber industry Burgenland 4,0 t COD/d Koehler, paper mill, Kehl/Rhein Germany 5,0 t COD/d Vevce, paper mill Slovenia 4,0 t COD/d Sewer Systems We plan and supervise the construction of entire Sewer Systems, including storm water treatment, throughout Austria and Europe. -

2004 W-Knirpse 1 133 Federle Alina 97 AUT Leobersdorf 1 01:47:00
GR Nr. Name JG Nat. Verein KR Zeit Leobersdorf - 2004 W-Knirpse 1 133 Federle Alina 97 AUT Leobersdorf 1 01:47:00 6 566 Lielacher Magdalena 97 AUT Bad Vöslau 2 01:56:00 9 800 Fridrich Jessica 98 AUT Leobersdorf 3 01:58:00 11 685 Weninger Katrin 97 AUT SU RLV Sparkasse Aspang 4 01:59:00 12 881 Bradler Vivian 97 AUT Leobersdorf 5 02:01:00 14 563 Neubauer Jenny 97 AUT Neunkirchen 6 02:03:00 16 826 Prandler Julia 97 AUT HSV Marathon Wr.Neustadt 7 02:05:00 18 833 Schabhüttl Patricia 97 AUT Leobersdorf 8 02:10:00 19 643 Stojkovic Nadine 98 AUT Kottingbrunn 9 02:11:00 20 624 Hofer Lara 97 AUT Kottingbrunn 10 02:11:00 21 639 Haas Jennifer 98 AUT Kottingbrunn 11 02:13:00 24 824 Pichler Julia 97 AUT Leobersdorf 12 02:16:00 25 444 Bichler Ilse 98 AUT Kindergarten Hausbergweg 13 02:18:00 26 429 Wagenhofer Teresa 97 AUT Baden 14 02:19:00 26 134 Federle Leonie 99 AUT Leobersdorf 14 02:19:00 32 897 Fransche Sabrina 97 AUT Sollenau 16 02:25:00 33 1409 Ungar Nadine 98 AUT LC Blatila 17 02:26:00 35 227 Schlager Katharina 98 AUT Leobersdorf 18 02:29:00 36 780 Meyer Corinna 97 AUT Leobersdorf 19 02:31:00 38 782 Holzer Nina 97 AUT Leobersdorf 20 02:32:00 39 834 Rosenberger Sophie 97 AUT Schönau/Triesting 21 02:33:00 40 1418 Onmaz Merve 0 AUT Wiener Neustadt 22 02:34:00 42 100 Novak Sophie 98 AUT Leobersdorf 23 02:40:00 43 825 Reifböck Sophie 97 AUT HSV Marathon Wr.Neustadt 24 02:42:00 45 445 Bichler Lea 0 AUT Kindergarten Hausbergweg 25 02:50:00 49 1408 Hirschler Lena 99 AUT Lichtenwörth 26 02:54:00 50 854 Brensberger Lena 99 AUT Leobersdorf 27 02:54:00 52 -

Gerhard Lagrange Was Born in Bad Vöslau, Lower Austria.He Began
Gerhard Lagrange was born in Bad Vöslau, Lower Austria.He began playing the piano at the age of 9, and at the age of 17 he already played the organ at the Bad Vöslau church and had composed his first Latin mass. In 1980 he was awarded with the title of music director. He composes pieces for orchestra an for choir. He is a member of the Austrian Music Council, district choir director with the ÖSB (Austrian choir singers association), has received numerous honours and distinctions, and has made studio recordings an record productions. Activities: -1967 - 1997 Lower Austria Tonkünstlerorchester: permanent guest conductor -slnce 1981 Wiener Hofburg Orchester: permanent guest conductor -1985 - 1989 Graz Opera House: guest conductor -1986 Raimundtheater, Vienna: guest conductor -1987 Stadtpfarrkirche Bad Vöslau: founder of the festive evening concerts -1990 Wiener Volksoper, Vienna: guest conductor -1992 Vienna Sinfonietta: conductor (within the context of Wiener Musiksommer, Klangbogen) -slnce 1996 Festivalchor "St. Jakob", Bad Vöslau: founder and musical director -1996 - 2006 Operettenbühne Wien: musical director and Luisenburg Festpiele, Wunsiedel (Germany): yearly guest performance with Operettenbühne Wien -1999 Arthur Krupp Symphony Orchestra, Berndorf: founder and musical director of the New Year ' s concert -since 2006 Wiener Residenz Orchester, Vienna: guest conductor -slnce 2006 Wiener Operettenensemble: musical director -slnce 2007 Oprettenfestspiele Bad Hall: musical director -Stadttheater Baden bei Wien: first conductor (first assignment) -Austrian Music Councel: member -Austrlan Choral Association (former Austrian Sinqers ' Association) district choir director -Honq Kong, Taipei, Singapore, Japan, Germany, Switzerland, Scandinavia: tours -Nethertands, Belgium, Hungary: New Year ' s concerts . -

Trumauer Gemeindenachrichten
Amtliche Mitteilungen der Marktgemeinde Trumau Nr. 331 / Juli 2020 An einen Haushalt - Zugestellt durch Österreichische Post Trumauer Gemeindenachrichten Fahrradstreifen Radroute „Trumau - Traiskirchen“ auf Autobahnbrücke kommt in die Gänge Mehr Öffis Mehr Grün Mehr Ärzte Starke Taktverdichtung bei Gepflegte Rabatte in Eigenregie Orthopäde Dr. Draskovits Busverkehr ab Ende August in der Mitmachgemeinde Trumau eröffnete Praxis in Trumau Inhaltsverzeichnis Bürgermeister Andreas Kollross Seite 3 Aus der Gemeinde Seite 4 bis 5 Gemeindeservice Seite 6 Gesundheit und Medizin Seite 7 Umwelt und Energie Seite 8 bis 9 Trumau wie es war und wurde Seite 10 Trumau gratuliert Seite 11 Wirtschaft Seite 12 Impressum: Medizinische Versorgung: Medieninhaber, Verleger, und für den Inhalt verantwortlich: Marktgemeinde Trumau, Gesundheitshotline: 1450 Kirchengasse 6, 2521 Trumau, www.trumau.at NÖ Ärztedienst: 141 Projektmanagement und Layout: Rettung: 144 artcom - kunst des kommunizierens, 2521 Trumau, Samariterbund: 02252 / 52 144 www.artcom-net.at www.notdienstplaner.at Linie des Blattes: Amtliches Informationsorgan der www.arztnoe.at Marktgemeinde Trumau www.apothekenindex.at Seite 2 - Trumauer Gemeindenachrichten Bürgermeister Andreas Kollross Liebe Trumauerinnen, liebe Trumauer, gerade noch mitten im Corona-LockDown be- finden wir uns nun schon wieder im Sommer. Ich hoffe, dass für viele dieser Sommer mit einem schönen Urlaub verbunden ist. Heuer ist es wahrscheinlich aus unterschied- lichsten Gründen weniger entscheidend wo dieser Urlaub stattfindet, sondern vielmehr was man daraus macht. Als Gemeinde sind wir bisher gesundheitlich sehr gut durch die Krise gekommen. Wir können nur gemeinsam hoffen, dass dieses auch in Zukunft so bleibt. Ich bedanke mich bei den vielen Menschen in unserer Gemeinde, die in Form von Nachbarschaftshilfe und weit darüber hinaus, sich um ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in den letzten Wochen geküm- mert haben. -

Partnerverzeichnis Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ
Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich Partnerverzeichnis green building cluster of lower austria partnerindex Johanna Mikl-Leitner Governor of Lower Austria Ladies and Gentlemen, since it was founded in 2001, the ecoplus Green Building Cluster of Lower Austria has established itself as a competent industry network for sustainable and energy-efficient construction in Lower Austria and has become an indispensable trendsetter for the entire industry. In terms of content, the focus is on climate- adaptive technologies, constructive efficiency and digitalisation in construction. The aim of the Cluster‘s work is to increase the innovation potential of the Lower Austrian construction sector and to make the companies fit for the challenges of the future. Our experience has shown that one of the best ways to tomorrow‘s success is to work together in inter-industry collaborative projects – such as those initiated and managed by the ecoplus Cluster of Lower Austria for around two decades. Thanks to this kind of cooperation, innovation projects can be implemented in a resource-saving way, with less risk and minimised development costs. Jochen Danninger Member of the Provincial Government of Lower Austria in charge of Economic Affairs, Tourism, Technology and Sport Ladies and Gentlemen, in line with the principle "Innovation through Cooperation", the Green Building Cluster of Lower Austria highlights future-oriented topics and trends and conntects companies with common interests and similar requirements in inter- company collaboration projects. This cooperation results in new perspectives, new experiences and new know-how for the companies. In this way, the Cluster is helping increase the added value of the companies, while strengthening Lower Austria as an industrial hub.