Geologischen Karte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Name Des Verbandes Benanntes Mitglied Straße PLZ Wohnort Erreichbarkeit E-Mail 0177/8664473
telefonische Name des Verbandes benanntes Mitglied Straße PLZ Wohnort Erreichbarkeit E-Mail 0177/8664473 Blindenbund Bezirksgruppe Lahn-Dill Dr. Mustapha Ouertani Johanneshof 20 A 35578 Wetzlar [email protected] 06441/2049346 Diakonie Lahn-Dill Wolfgang Muy Am Schmittenberg 12 35578 Wetzlar 06441/9013-122 [email protected] Gumbert-BreitscheidErdbach@t- VdK Kreisverband Dillkreis Alfred Gumbert Talblick 20 35767 Breitscheid 02777/6852 online.de Aktion für Behinderte Elke Würz Am Schützenhaus 1 35759 Driedorf 0170/5459933 [email protected] Förderverein für seelische Gesundheit e. Gabriele Panitz Ludwigstraße 14 35390 Gießen 0641/97576-11 panitz@ifd-gießen.de V. / Integrationsfachdienst verenakatharina.koelsch@drk- DRK Kreisverband Dillkreis e. V. Verena Kölsch 02771/303-28 dillenburg.de MS Selbsthilfegruppe Wetzlar "Aktiv mit Georg Pellinnis Westerwaldstraße 19 35580 Wetzlar 06441/212181 [email protected] Spaß" Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e. V. Sabine Kracht Windmühlenweg 5 35619 Braunfels 06442/9382113 [email protected] Ortsbund der Gehörlosen Wetzlar 1908 Joachim Nieth Hainstr. 8 35576 Wetzlar 06441/43117 (Fax) [email protected] e.V. Dt. Rheuma Liga Hessen e. V. Waltrud Luh Sonnenweg 16 35579 Wetzlar 06441/4466873 [email protected] Gehörlosen Ortsbund und Sportverein Hans Beilborn Postfach 1217 35745 Herborn Herborn e. V. Senioren- und Behindertenbeirat Stadt Ramona Höge Am Zwingel 2a 35683 Dillenburg 02771/265519 (Büro) [email protected] Dillenburg 06473/1717 CDU-Kreistagsfraktion Edgar Luh Am Lohrberg 1 35638 Leun [email protected] 0160/5710301 SPD-Kreistagsfraktion Rita Wagner-Jeuthe Langer Morgen 11 A 35582 Wetzlar 0641/28881 [email protected] FWG-Kreistagsfraktion Jörg Ludwig 06442/23241 [email protected] AFD-Kreistagsfraktion vakant DIE LINKE Kreistagsfraktion Tamina-Janine Veit Bündnis 90 /Grüne-Kreistagsfraktion Klaus Hugo Helgebachstr. -

Kommunale Steuern Im Lahn - Dill - Kreis Im Jahr 2020
Juli 2020 Kommunale Steuern im Lahn - Dill - Kreis im Jahr 2020 Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2019) Wettauf- Zweitwoh- Gewerbe- Grundsteuer Hundesteuer (in Euro) Pferde- Spielappa- Vergnügung- Kulturförder- Straßenbeiträge Defizitärer Haushalt Verabschie- Stadt/Gemeinde Für gefährliche wand- nungs- wiederkeh- steuer A B 1. Hund steuer rate-steuer steuer abgabe einmalig 2019 2020 dung Hunde steuer steuer rend Aßlar 375 365 380 60,00 300,00 nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja Bischoffen 360(+20) 345 365 50,00 500,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Braunfels 380 400 450 60,00 480,00 nein ja nein nein nein ja [10] nein ja nein nein ja Breitscheid 370(+10) 370(+30) 370(+30) 50,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Dietzhölztal 365 330 365 48,00 nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Dillenburg 366 460(-25) 460(-25) 60,00 700,00 nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein ja Driedorf 360 315 345 60,00 480,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Ehringshausen 380(+20) 420(+90) 420(+55) 50,00 500,00 nein ja nein nein nein nein nein nein nein ja ja Eschenburg 380 400 400 60,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Greifenstein 340 300 365 45,00 402,00 nein ja nein nein nein nein ja nein1 nein nein ja Haiger 355 365 365 54,00 600,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Herborn 366 352 365 72,00 600,00 nein ja nein nein nein2 nein nein ja nein ja ja Hohenahr 380 365 365 48,00 960,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Hüttenberg 357 440 500 60,00 600,00 nein nein nein nein nein nein ja nein ja nein ja Lahnau 357 332 365 45,00 450,00 nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja Leun 427 425 425 60,00 600,00 nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja Mittenaar 380 365 365 50,00 700,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Schöffengrund 365 350 520 60,00 450,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Siegbach 380 360 420 60,00 350,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein n.v. -

Lahn-Dill-Kreis 370 (+3) 369 (+8) 413 (+16) 56,00 548,00 0 Von 23 22 Von 23 2 Von 23 0 Von 23 0 Von 23 1 Von 23 18 Von 23 3 Von 23 2 Von 23 1 Von 23 23 Von 23
Bund der Steuerzahler Hessen e.V. September 2019 Kommunale Steuern im Lahn - Dill - Kreis im Jahr 2019 Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018) Wettauf- Zweitwoh- Gewerbe- Grundsteuer Hundesteuer (in Euro) Pferde- Spielappa- Vergnügung- Kulturförder- Straßenbeiträge Defizitärer Haushalt Verabschie- Stadt/Gemeinde Für gefährliche wand- nungs- wiederkeh- steuer A B 1. Hund steuer rate-steuer steuer abgabe einmalig 2018 2019 dung Hunde steuer steuer rend Aßlar 375 365 380 60,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Bischoffen 340 345 365 50,00 500,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Braunfels 380 400 450 60,00 480,00 nein ja nein nein nein ja [10] nein ja nein nein ja Breitscheid 360(+10) 340(+30) 340(+30) 50,00 300,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Dietzhölztal 365(+10) 330 365 48,00 nein nein ja nein nein nein nein ja nein ja nein ja Dillenburg 366 485(-10) 485(-10) 60,00 700,00 nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein ja Driedorf 360 315 345 60,00 480,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Ehringshausen 360 330 365 50,00 500,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Eschenburg 380 400 400 60,00 300(+300) nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Greifenstein 340 300 365 45,00 402,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Haiger 355 365(+65) 365(+65) 54,00 600,00 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja Herborn 366 352 365 72,00 600,00 nein ja nein nein nein nein nein ja nein nein ja Hohenahr 380 365 365 48,00 960,00 nein ja nein nein -

Aus Dem Inhalt 25
Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Greifenstein Aus dem Inhalt 25. Jahrgang Donnerstag, den 27. Februar 2020 Nummer 9 LINUS WITTICH Medien KG online lesen: www.wittich.de www.greifenstein.de Greifensteiner Nachrichten –2– Nr. 9/2020 AmtlicheBekanntmachungen Sitzung desBau-, Planungs- 2. Wahl einerstellvertretendenSchriftführerin 3. Durchführungsvertrag zumvorhabenbezogenen Bebauungs- undVerkehrsausschusses plan „Auf demHamelhaus“, OT Holzhausen Einladung 4. VorhabenbezogenerBebauungsplan„Aufdem Hamelhaus“, Zu deram Gemarkung Holzhausen,Flur1,Flurstück 6/1 Mittwoch, dem04.03.2020,18:00 Uhr hier:Satzungsbeschluss nach §10BauGB im Dorfgemeinschaftshaus, OT Beilstein, HerbornerStraße38, 5. Sachstandsberichte stattfindendenSitzung desBau-, Planungs- undVerkehrsaus- 6. Verschiedenes schusses wird hiermitherzlicheingeladen. DieSitzung istöffentlich, soweit nichtdurch Beschlussfür einzel- Tagesordnung: ne Tagesordnungspunkte dieÖffentlichkeitausgeschlossen ist. 1. Wahl einer Schriftführerin gez. Steffen Droß -Vorsitzender - Ausdem Rathauswirdberichtet Telefonverzeichnis derGemeindeverwaltung Greifenstein Hauptanschluss-Zentrale:(02779) 91 24 -0 Telefax:(02779) 91 24 -40 Zentrale E-Mail-Adresse:[email protected] Mitarbeiter/in Funktion Dw. E-Mail-Adressen Bürgermeisterin Sander,Marion Bürgermeisterin 12 [email protected] Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen Rudolph, Kerstin FachbereichsleiterinFinanzen, Haushaltsplanung,Jahresabschluss 25 [email protected] Weber, Carina Personalleitung, Finanzen 11 [email protected] -
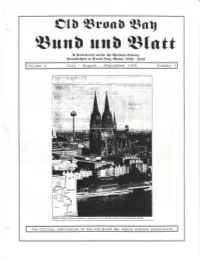
Ltttt
>Olb ~ruttb ~ttlJ ~unb unb ~ltttt ill l'letu~letter ttbout t~e 6Serman <tolonlJ ~~tttbli~ljeb ttt !8rottb !8ttlJ, rolttine 1742 - 1753 !volume 4 July - August - September 1995 Number 31 The Official Publication of the Old Br'oad Bay Family History Association ... Subscription Notice Please look at your mailing label. If you have a -95 after your name, your subscription is now due. If you have a -96 after your name, your subscription is paid up until Jan 1996. Subscriptions to Bund und Blatt Subscription . .$15 per year OBBFHA membership. .$ 5 per year Contributions in General Thank you for all who have paid their subscriptions and those who additionally sent extra contributions. Because of you, I will be able to meet expenses this year. That is great! I would again appeal to those who have an interest in these Broad Bay German ancestors. Send a contribution of what you can afford, that is a good way to express your interest and willingness to help in this project:.. Bund und Blatt Reprinted! 6 Page Table of Contents --- - --Every'-Name Index 63 Page Index! Several researchers have expressed interest in obtaining back issues of Bund und Blatt. Certain issues have been reprinted several times and as I needed to reprint several issues this last time, I decided to "do it right" and include a Table of Contents and an Every Name Index. The Entire Series from 1992 through 1994 was renumbered from 1 through 234 and I included several fliers that I had left off other reprints and a 63 page Index was made and included. -

Mietwertübersicht Für Wohnraum
Amt für Bodenmanagement Marburg Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse 1) Mietwertübersicht für Wohnraum für die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf (ohne die Städte Gießen und Marburg) und für den Lahn-Dill-Kreis mit der Stadt Wetzlar Stand 2010 1) Gutachterausschuss für den Bereich des Lahn-Dill-Kreises mit Ausnahme der Stadt Wetzlar und Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Wetzlar - Geschäftsstelle: Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg - Impressum Herausgeber: Amt für Bodenmanagement Marburg Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg Verantwortlich: Gerhard Lips, Leiter des Amtes für Bodenmanagement Marburg Bearbeitung: Peter Moos, Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf (ohne die Städte Gießen und Marburg), für den Lahn-Dill-Kreis und für die Stadt Wetzlar Kontakte: Amt für Bodenmanagement Marburg Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg Herr Moos Fon 06421 616 - 331 Fax 06421 616 - 373 Mail: [email protected] Frau Schneider Fon 06421 616 - 123 Fax 06421 616 - 373 Mail: [email protected] Internet: www.hvbg.hessen.de Amt für Bodenmanagement Marburg Seite 2 von 18 - Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse - Inhaltsverzeichnis Nr. Abschnitt Seite 1 Vorbemerkungen...............................................................................................4 1.1 Anlass und Zielsetzung .......................................................................................4 1.2 Überblick über die erfassten Wohnungsmieten...................................................4 -

Liste Kreistagswahl Für HP
Name Beruf / Stand Ort 1 Wolfgang Schuster Landrat Driedorf 2 Kristin Krause Studentin Braunfels 3 Stephan Aurand Kreisbeigeordneter Dietzhölztal 4 Beatrix Egler Rechtsanwältin Wetzlar 5 Dr. David Nikolai Rauber Verwaltungsdirektor Ehringshausen 6 Mechthild Schäfer Kaufm. Angestellte i.R. Dillenburg 7 Stephan Grüger Landtagsabgeordneter Driedorf 8 Rita Johanna Wagner-Jeuthe Schulleiterin Wetzlar 9 Jan Moritz Böcher Student Lahnau 10 Cirsten Kunz Projektmanagerin Aßlar 11 Murat Polat Disponent Aßlar 12 Christel Hensgen Hausfrau Dillenburg 13 Joscha Wagner Student Breitscheid 14 Sabrina Zeaiter Wissenschaftliche Mitarbeiterin Wetzlar 15 Armin Bangert Kaufm. Angestellter Hohenahr 16 Ingrid Schmidt Rentnerin Waldsolms 17 Heinz Lemler Industriefachwirt Haiger 18 Regina Beimborn Dipl. Sozialpädagogin Eschenburg 19 Dieter Hagner Rektor Solms 20 Karin Ute Betz Kaufm. Angestellte Driedorf 21 Holger Hartert Verwaltungsangestellter Wetzlar 22 Cornelia Glade-Wolter Dipl. Sozialpädagogin Herborn 23 Hans Benner Bürgermeister Herborn 24 Andrea Grimmer Sozialpädagogin Wetzlar 25 Rainer Apfelstedt Rentner Aßlar 26 Anke Hartmann Oberstudienrätin Schöffengrund 27 Stefan Scholl Angestellter Dietzhölztal 28 Michelle Breustedt Studentin Hüttenberg 29 Daniel Hofmann Soziologe Hüttenberg 30 Anja Fay Krankenschwester Lahnau 31 Gunter Ratz Dipl. Pädagoge Wetzlar 32 Ute Speier Hausfrau Waldsolms 33 Jan Niklas Henrich Student Greifenstein 34 Marie Kristin Gabert Zahnärztin Siegbach 35 Hubert Zöller Bankkaufmann Mittenaar 36 Marlene Vanderlinde Sachbearbeiterin Ehringshausen 37 Wilhelm Werner Verwaltungsbeamter Dillenburg 38 Anne Naumann Sachbearbeiterin Aßlar 39 Steffen Straßheim Stundent Leun 40 Renate Fuhr Rentnerin Braunfels 41 Dr. Mustapha Ouertani Sozialwissenschaftler Wetzlar 42 Bärbel Rumpf-Cloos Dipl. Sozialpädagogin Hohenahr 43 Thomas Seibel Ausbilder Dillenburg 44 Katrin Zammert Kauffrau für Bürokommunikation Driedorf 45 Paul Wilhelm Janssen Pensionär Herborn 46 Tina Breidenich Lehrerin Waldsolms 47 Sebastian Koch Dipl. -

Vldwinformiert
Gemeinde Dietzhölztal Haltestelle Bürgermeiteramt Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH VLDW informiert... 12.11.2020 Ewersbach Bürgermeisteramt Thema: Barrierefreier Umbau von Haltestellen im Lahn-Dill-Kreis Gemeinde Eschenburg Haltestelle Markt Barrierefreier Haltestellenumbau abgeschlossen! Mit Fördermitteln des Landes Hessen wurden im Lahn-Dill-Kreis insgesamt 15 Haltepositionen barrierefrei umgebaut. Beteiligt am Projekt waren im Lahn-Dill-Kreis 12 Kommunen (Aßlar, Breitscheid, Dietzhölztal, Dillenburg, Driedorf, Eschenburg, Herborn, Hüttenberg, Mittenaar, Schöffengrund, Solms und Waldsolms). Das Gesamtvolumen der Bauvorhaben betrug für den Lahn-Dill-Kreis ca. 1,6 Millionen EURO. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH koordinierte die Abwicklung mit den Kommunen, hatte die Förderanträge 2017 eingereicht und den Förderbescheid im Eibelshausen Markt September 2018 erhalten. Mittlerweile sind alle Haltestellen fertig gestellt. Es folgt im Statement Bürgermeister Roland Lay Gemeinde Breitscheid: Anschluss noch die restliche Abwickung der Maßnahmen mit dem Fördermittelgeber Hessen Mobil, indem der Verwendungsnachweis gestellt wird, sowie die Abrechnung Mit dem Haltestellenumbau im Zentrum von Breitscheid hat man die Sicherheit für mit den beteiligten Kommunen für den Anteil der verbliebenen nicht förderfähigen die Fußgänger, Fahrgäste und Schüler der Fritz-Philippi-Schule erhöht und Kosten. wesentliche Gefahrenstellen beseitigt. Wir danken allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit. Die ausführende Firma hat hier sehr gute Arbeit geleistet. Der Umbau erfolgte nach den Vorgaben der Förderrichtlinien von Hessen Mobil. Je Gemeinde Breitscheid Haltestelle Rathaus nach den Standortgegebenheiten wurden 18 cm Hochborde oder der neue Kasseler Sonderbord plus mit 20 cm verbaut. Grundsätzlich wurde an allen Standorten neue Haltestellenschilder und Abfallbehälter vorgesehen und, sofern noch keine Wartehalle vorhanden war, diese ergänzt oder alte Beton-Wartehallen wie im Falle von Driedorf ausgetauscht. -

Germans Settling North America : Going Dutch – Gone American
Gellinek Going Dutch – Gone American Christian Gellinek Going Dutch – Gone American Germans Settling North America Aschendorff Münster Printed with the kind support of Carl-Toepfer-Stiftung, Hamburg, Germany © 2003 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Überset- zung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf foto- mechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des § 54, Abs. 2, UrhG, werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen. Druck: Druckhaus Aschendorff, Münster, 2003 Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier ∞ ISBN 3-402-05182-6 This Book is dedicated to my teacher of Comparative Anthropology at Yale Law School from 1961 to 1963 F. S. C. Northrop (1893–1992) Sterling Professor of Philosophy and Law, author of the benchmark for comparative philosophy, Philosophical Anthropology and Practical Politics This Book has two mottoes which bifurcate as the topic =s divining rod The first motto is by GERTRUDE STEIN [1874–1946], a Pennsylvania-born woman of letters, raised in California, and expatriate resident of Europe after 1903: AIn the United States there is more space where nobody is than where anybody is. That is what makes America what it is.@1 The second motto has to do with the German immigration. It is borrowed from a book by THEODOR FONTANE [1819–1898], a Brandenburg-born writer, and a critic of Prussia. An old German woman, whose grandchildren have emigrated to Anmerica is speaking in her dialect of Low German: [ADröwen in Amirika. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Flyer Denkmal 1A.Indd
Weitere Informationen Untere Denkmalschutzbehörde • Landesamt für Denkmalpflege Hessen Susanne Milch www.denkmalpflege-hessen.de 06441 407-1707 Fax: 06441 407-1065 Denk E-Mail: [email protected] • Kreditanstalt für Wiederaufbau Zuständig für die Städte/Gemeinden Dietzhölztal, Mal www.kfw.de Haiger, Eschenburg, Dillenburg, Siegbach, Herborn (nur • Liste der anerkannten Energieberater für Denkmale Stadtteile), Breitscheid, Driedorf, Bischoffen, Mittenaar, www.energie-effizienz-experten.de Hohenahr, Lahnau, Greifenstein, Leun, Ehringshausen, an Dein Denkmal • Datenbank „Denkmalpflege im Handwerk“ Braunfels. www.hwk-wiesbaden.de Harald Losacker • Verband der Restauratoren 06441 407-1706 Fax: 06441 407-1065 www.restauratoren.de E-Mail: [email protected] • Verband der Restauratoren im Zimmererhandwerk Zuständig für die Städte/Gemeinden Herborn (nur www.restauratoren-verband.de Kernstadt), Sinn, Aßlar, Solms, Hüttenberg, Waldsolms, Schöffengrund. • Propstei Johannesberg www.propstei-johannesberg.de Für den Bereich der Stadt Wetzlar ist die Denkmalschutzbehörde der Stadt Wetzlar zuständig. • Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen www.akh.de • Denkmalakademie www.denkmalakademie.de • Deutsche Stiftung Denkmalschutz www.denkmalschutz.de • Schlösser, Baudenkmäler und Gärten in Hessen www.schloesser.hessen.de • Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz www.dnk.de Impressum Herausgeber: Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises Abteilung Bauen und Wohnen, Untere Denkmalschutzbehörde Karl-Kellner-Ring 51 | 35576 Wetzlar -

Gewerberaum - Mietwertübersicht
Gutachterausschüsse für Grundstück swerte und sonstige Wertermittlungen Gewerberaum - Mietwertübersicht für die Bereiche Lahn-Dill-Kreis, Altkreis Biedenkopf, Wettenberg und Biebertal Stand 2012 Impressum Herausgeber: Amt für Bodenmanagement Marburg Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg - Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse - Verantwortlich: Gerhard Lips, Vorsitzender der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen für die Bereiche - des Lahn-Dill-Kreises mit Ausnahme der Stadt Wetzlar, - der Stadt Wetzlar, - des Landkreises-Marburg-Biedenkopf mit Ausnahme der Stadt Marburg Lothar Dude-Georg, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen für den Bereich des Landkreises Gießen mit Ausnahme der Stadt Gießen Beteiligte Gutachter: Robert Puth, Immobilienökonom (ebs), MRICS, Wetzlar Gerhard Schlier REV, ö.b.u.v.Sachverständiger, Wetzlar Projektpartner: Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill Redaktion: Peter Moos, Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für die Bereiche Lahn-Dill-Kreis, Stadt Wetzlar, Landkreis Marburg-Biedenkopf (ohne Stadt Marburg) und Landkreis Gießen (ohne Stadt Gießen) Kontakte: Peter Moos, Amt für Bodenmanagement Marburg Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg Fon 06421 616 - 331 Fax 06421 616 - 373 Mail: [email protected] Heidrun Langner, Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill Recht | Fair Play Friedenstraße 2, 35578 Wetzlar Fon 06441 9448 - 1710 oder 02771 842 - 1710 Fax 06441 9448 - 2710 oder 02771 842