Amerika Erobert Hitlers Wunderwaffen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PEENEMUENDE, NATIONAL SOCIALISM, and the V-2 MISSILE, 1924-1945 Michael
ABSTRACT Title of Dissertation: ENGINEERING CONSENT: PEENEMUENDE, NATIONAL SOCIALISM, AND THE V-2 MISSILE, 1924-1945 Michael Brian Petersen, Doctor of Philosophy, 2005 Dissertation Directed By: Professor Jeffrey Herf Departmen t of History This dissertation is the story of the German scientists and engineers who developed, tested, and produced the V-2 missile, the world’s first liquid -fueled ballistic missile. It examines the social, political, and cultural roots of the prog ram in the Weimar Republic, the professional world of the Peenemünde missile base, and the results of the specialists’ decision to use concentration camp slave labor to produce the missile. Previous studies of this subject have been the domain of either of sensationalistic journalists or the unabashed admirers of the German missile pioneers. Only rarely have historians ventured into this area of inquiry, fruitfully examining the history of the German missile program from the top down while noting its admi nistrative battles and technical development. However, this work has been done at the expense of a detailed examination of the mid and lower -level employees who formed the backbone of the research and production effort. This work addresses that shortcomi ng by investigating the daily lives of these employees and the social, cultural, and political environment in which they existed. It focuses on the key questions of dedication, motivation, and criminality in the Nazi regime by asking “How did Nazi authori ties in charge of the missile program enlist the support of their employees in their effort?” “How did their work translate into political consent for the regime?” “How did these employees come to view slave labor as a viable option for completing their work?” This study is informed by traditions in European intellectual and social history while borrowing from different methods of sociology and anthropology. -

Die Region Gedenkt Der Grenzöffnung Vor 25 Jahren Drei Landkreise Feiern Gemeinsam in Lehesten - Würdigung Der Wichtigen Rolle Der Kirche Lehesten (AB/Mo)
Gemeinsames Amts- und Mitteilungsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg 14/14 Amtsblatt 21. JAHRGANG 12. November 2 01 4 Die Feengrotten (im Bild) und das Schillerhaus standen auf In der KZ-Gedenkstätte Laura (im Bild) und auf dem Altva - dem touristischen Besuchsprogramm der Tier-Saarburger Dele - terturm stand das Erinnern an die gemeinsame deutsche Ge - gation am Wochenende. Foto: pl schichte im Mittelpunkt. Foto:pl Die Region gedenkt der Grenzöffnung vor 25 Jahren Drei Landkreise feiern gemeinsam in Lehesten - Würdigung der wichtigen Rolle der Kirche _Lehesten (AB/mo). Das bedeu - 25 Jahre nach dem Fall der Ber - „Dass die Grenzöffnung mit Got - leben, sind in den vergangenen tendste Ereignis der jüngeren liner Mauer erinnern auch im tesdiensten gefeiert wird, erinnert 25 Jahren enge Freundschaften deutschen Geschichte, das Ende Landkreis zahlreiche Veranstal - uns an die wichtige Rolle der mit den Thüringern entstanden. der deutschen Teilung, erreichte tungen und Initiativen an den Kirche in dem Prozess. Ludwigs - Mit der Vorstellung der neu ge - die Region am unmittelbarsten Beginn des Wiedervereinigungs - stadts Pfarrer Albrecht Bischoff stalteten KZ-Gedenkstätte Laura heute vor 25 Jahren: Am 12. No - prozesses. Dabei steht in diesem nennt es zurecht das „Geschenk und des Altvaterturms bei Le - vember 1989 war der Grenzüber - Jahr die Region um Lehesten im der Grenzöffnung“, betont Land - hesten, der von Vertriebenen als gang zwischen Probstzella und Mittelpunkt. Am 9. November rat Marko Wolfram. Zeichen zur Erinnerung und der Ludwigsstadt am Falkenstein als hatten die Christen des Kirchen - Treffen der Landkreise Versöhnung erbaut worden war, erster Übergang der Region ge - kreises Rudolstadt-Saalfeld und Lehesten war am 9. -
Auf Den Spuren Des Blauen Goldes
Auf den Spuren des blauen Goldes Entdeckungen am Schieferpfad Schieferpfad am Grünen Band lich hochinteressante Region Liebe Besucher des ThüringischFränkischen und Wanderer, Schiefergebirges können Sie bei einer Wanderung auf dem Schieferpfad kennen lernen. der Schieferpfad führt Sie durch Naturparkgebiete, die Der Schieferpfad ist als großer vom Schiefergestein und dem Rundweg von ca. 60 km ange damit verbundenen Schiefer legt. Wo Sie Ihre Wanderung bergbau geprägt sind. Eines beginnen, können Sie selbst der Zentren der Schiefer verständlich frei entscheiden. gewinnung war das Gebiet schaft vernarben, aber man Besonders ans Herz legen zwischen Probstzella, darf nicht vergessen, dass möchten wir Ihnen die vier Lehesten, Ludwigsstadt und der Schieferbergbau für viele kleinen Rundwege um die Gräfenthal. Hier wurde seit Menschen in dieser Gegend Orte Probstzella, Lehesten, Jahrhunderten hochwertiger auch einen, sicherlich eher Ludwigsstadt und Gräfenthal. Dach, Wand und Tafel bescheidenen, Broterwerb be Diese in zwei bis vier Stun schiefer abgebaut. Während deutete. Diese erdgeschicht den gut zu bewältigenden die Schieferbrüche langsam Wanderungen verschaffen von der Natur zurück erobert Ihnen einen ersten Einblick werden, sind die Städte in die Schönheiten unserer „Schiefermann“ an der Gedenkstätte Laura und Dörfer mit ihren blau Landschaft. schwarzen Schieferdächern Für den hungrigen und müden und fassaden immer noch Wanderer stehen in den Orten ein prägendes Element ländliche Gasthäuser und dieser charakteristi Übernachtungsmöglichkeiten -

Amtsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Nr. 10 Freitag, den 9. Oktober 2020 31. Jahrgang Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge - 2 - Nr. 10/2020 Amtlicher Teil Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Allgemeine Verwaltung: Standesamt: Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr Probstzella: Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 11.00 Uhr Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr Einwohnermeldeämter Probstzella: Erweiterte Öffnungszeiten Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr im Einwohnermeldeamt und im Standesamt Donnerstag kein Sprechtag Obere Gasse 1, 07330 Probstzella Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr Samstags-Sprechstunde Lehesten: Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Ein- Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr wohnermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr Tel. 036735/461112 (Einwohnermeldeamt) Gräfenthal: Tel. 036735/461140 (Standesamt) Montag 14.00 - 16.00 Uhr Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeamten Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr Rathaus Gräfenthal Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Rathaus Lehesten Donnerstag 09:30 bis 11:30 Uhr können jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwal- tungsgemeinschaft nutzen. Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Lehesten unter: 036653/264531 Impressum Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: Markt 8, 07330 Probstzella, Telefon 036735/4610, Fax 036735/ 46155 LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau E-Mail: [email protected] Gesamtherstellung und kostenlose Verteilung: Verantwortlich für den amtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau VG Schiefergebirge [email protected], www.wittich.de, Tel. -
Angebote Der Naturführer Ab 2010 S Eg Rw E T N R U E R Üh Rf U T a M N E T D I M
Angebote der Naturführer ab 2010 s eg rw e t n r u e r üh rf u t a m N e t d i M 1 Zum Geleit Die Naturführer unseres Naturparks “Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale” sind nach deutschlandweit einheitlichen Standards ausgebildet worden. Sie arbeiten ehrenamtlich und Ihnen die Besonderheiten unserer Heimat näher und verstehen sich als „Botschafter unserer Region“. Die dargestellten Angebote richten sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, an alle: große und kleine Menschen, Wandergruppen, Schulausflügler, usw. Gewandert wird nicht zum „Kilometermachen“, sondern es werden Auge und Verstand geschärft für das, was wir sonst nicht (mehr) wahrnehmen. Die Strecken sind zwischen 3 und 20 km lang und unterschiedlich schwer. Angebote für Menschen mit Einschränkungen fragen Sie bitte direkt bei den Naturführern nach. Viele Naturführer bieten auch individuelle Planungen an. Für Ihre Angebote erwarten die Naturführer lediglich eine Aufwandsentschädigung. Die meisten Naturführer sind im Verein Naturpark- zentrum „Obere Saale - Sormitz“ organisiert. Das Naturparkzentrum arbeitet eng mit der Naturparkverwaltung zusammen und ist auf Projekte in den Bereichen Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz spezialisiert. Auch die Herausgabe dieser kleinen Broschüre wurde neben der is Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt durch das n Naturparkzentrum wesentlich unterstützt. h ic t i Gemeinsam wünschen wir allen Naturfreunden viel rze le e e Freude beim Entdecken und Wandern! v ts l m G Ihre Naturparkverwaltung ha u n I Z 2 1 Inhaltsverzeichnis Zum -

The Germans and the Development of Rocket Engines in the USSR
Olaf H. Przybilski JBIS, Vol. 55, pp.404-427, 2002 The Germans and the Development of Rocket Engines in the USSR OLAF H. PRZYBILSKI Technical University Dresden, Institute for Aerospace Engineering, D-01062 Dresden, F. R. Germany. Previous analyses of post-World War II developments of German rocket engines in Russia were mainly based on information published by Soviet scientists and design engineers in obscure specialist journals, which were the only sources giving the technical parameters of these engines. No detailed drawings and few photographs were published. A more accurate picture of the genesis of post-war Soviet rocket propulsion can now be painted. The author was granted unprecedented access to the archives of Moscow enterprises and research facilities. This material is supplemented by that from new Russian publications in the nineties and personal interviews with the German rocket experts who were taken to the USSR. For the first time it became clear that the raketnyje dvigateli (rocket engines) of even today's Soyuz launcher are based on the basic developments of German experts. Keywords: German rocket engines, German rocket experts, Soviet rocket genesis 1. From the A4 Basket Head Chamber Model 39 to the RD-100 As soon as the Red Army occupied Thuringia in engine group were Dr. Karl Zinner (inventor of the July 1945, the resurrection of the extremely expen- shower-head injector); engineers Hans Lindenberg sive Aggregat 4/Vergeltungswaffe 2 engine began. (Papa Lindenberg; died in 1947 in the United States), The background is generally known: after a long and Konrad K. Dannenberg. They were sent to test series, a reliable 1.5-tonne thrust liquid rocket Peenemuende and were constantly present at test engine combustion chamber was produced by Dr.- stand V in Kummersdorf [3 and 4]. -

Peenemunde Interviews Project: Karl Heimburg 11/9/1989
Heimburg, Karl. November 9, 1989. Interviewer: Michael Neufeld. Auspices: DSH. Length: 4.25 hrs.i 81 pp. Use restriction: Open. Heimburg discusses his birthplace and early education. Discusses engineering education at the TH Darmstadt; university requirement and importance of practical experience in german engineering education; deficiencies in practical experience of american engineers. Manufacturing of Redstones in Huntsville and industry objections. Opposed to Hitler. Leaves for job in Japan after getting in trouble with authorities (1936-37); travels through soviet Union; experience in Japan: departure from Japan, June 1941. Interlude at stuttgart and Karlsruhe before drafted; assignment to the Versuchskommando Nord at Peenemunde. Hired by Ludwig Roth for Project Office; Roth's personality and management style. Involved with A-9 (A-4b);- first launch and failure. Wasserfall: origins of and assignment to: work on test stand and floating test stand (Schwimmweste). Discusses von Braun; initial impression: advocates underestimating costs to sell projects; forced to wear SS uniform; arrest with Grottrup and Reidel II. Discusses Zanssen's disapproval of regime and removal. Saved central records to use as bargaining chip; evacuated by Americans. TAPE 1, SIDE 1 1-3 Birthplace and early education 3 Engineering education at the TH Darmstadt 3-5 Importance of the practical experience in German engineering education in contrast to American; manufacturing of Redstones in Huntsville and industry objections 5-6 University requirements for experience; -

V5 Katalog Kreativer Landurlaub.Indd
Kreativer Landurlaub in Thüringen Thüringen steht nicht nur für die weltbekann- Alle beteiligten Partner erfüllen eigens für te Thüringer Bratwurst, für das Land der den „Kreativen Landurlaub in Thüringen“ ent- Dichter und Denker oder für den erlebens- wickelte Standards, die vom Service, über die werten Thüringer Wald. Thüringen ist viel Unterkunft bis zum Kreativangebot eine hohe mehr als das. Es ist eine facettenreiche Kul- Qualität für den Gast gewährleisten. turlandschaft mit vielen kleinen, aber feinen Ateliers, traditionsreichen Werkstätten und Die Partner des „Kreativen Manufakturen, deren Entdeckung lohnt. Landurlaubs in Thüringen“ bieten Ihnen: Künstler, Kunsthandwerker und kreative Köpfe haben sich mit Partnern von gast- Kreative Mitmachangebote für Groß freundlichen Bauern- und Ferienhöfen, urigen und Klein, Anfänger und Fortgeschrittene Gasthöfen und familiären Landhotels zusam- Fachlich kompetente Kurs- bzw. mengeschlossen, um Kreativität, Freude am WorkshopleiterInnen künstlerischen Schaffen und Entspannung Kurze Wege: Angebote in unmittelbarer in individuellen Angeboten zu kombinieren. Nähe oder max. 30 Autominuten entfernt Kurse, Workshops, Einzelunterricht und Wan- Behagliche Unterkünfte derungen werden an vielen landschaftlich mit ländlichem Charme und architektonisch reizvollen Orten angebo- Familiäres Urlaubserlebnis und enger ten, ob auf dem Lande, in der urwüchsigen Kontakt zu den Gastgebern Thüringer Natur oder inmitten idyllischer Städtchen. Informationen & Angebote unter: www.kreativer-landurlaub.de Gläserne Christbaumkugeln haben vor mehr ger Kunsthandwerker gern weiter. Sie zeigen, als 100 Jahren ihren Ursprung in Thüringen. wie Christbaumschmuck und Figuren aus Filz Tausendfach schillern Kugeln und Formen in mit wenigen Handgriffen entstehen oder wie Hunderten von Farben in den Werkstätten der Schritt für Schritt aus einem einfachen Holz- Region. Mit „magischen Formeln“ gründete stück charaktervolle Puppenköpfe lebendig Gotthelf Greiner die erste Thüringer Porzel- werden. -
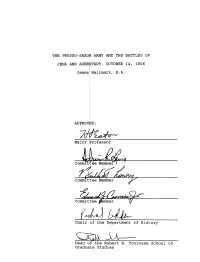
The Prusso-Saxon Army and the Battles of Jena and Auerst&Dt
THE PRUSSO-SAXON ARMY AND THE BATTLES OF JENA AND AUER TADT, OCTOBER 14, 1806 James Hallmark, B.A. APPROVE ED: Major Professor Committee Member Committee Member Committeeeer Chair of the Department of Hist Ory Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies 3?79 / THE PRUSSO-SAXON ARMY AND THE BATTLES OF JENA AND AUERSTADT, OCTOBER 14, 1806 THESIS Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By James Hallmark, B.A. Denton, Texas December, 1995 Hallmark, James, The Prusso-Saxon Army and the Battles of Jena and Auerst&dt. October 14. 1806. Master of Arts (History), December, 1995, 259 pp., 93 illustrations, 32 maps, bibliography, 87 titles. The twin battles of Jena and Auerstadt were fought on October 14, 1806 between the Prusso-Saxon forces under King Frederick William III of Prussia and the French forces under Emperor Napoleon I of France. Since these famous battles, many military historians have been quick to claim that the Prusso-Saxon Army of 1806 used tactics that were too outdated and soldiers that were quite incapable of effectively taking on the French. But the Prusso-Saxon Army of 1806 has been greatly misrepresented by these historians, and a recent body of respected scholarship has indicated that the Prusso-Saxon soldiers of 1806 fought well enough and that their tactics were not so outdated. The fact that the Prusso-Saxon Army lost the campaign of 1806 is not disputed, but a fair assessment of the army is due. -

Animals in Space: from Research Rockets to the Space Shuttle (Springer Praxis)
Animals in Space From Research Rockets to the Space Shuttle Colin Burgess and Chris Dubbs Animals in Space From Research Rockets to the Space Shuttle Published in association with PPraxisraxis PPublishiublishingng Chichester, UK Mr Colin Burgess, BIS Bonnet Bay New South Wales Australia Mr Chris Dubbs Edinboro Pennsylvania USA SPRINGER±PRAXIS BOOKS IN SPACE EXPLORATION SUBJECT ADVISORY EDITOR: John Mason, M.Sc., B.Sc., Ph.D. ISBN 10: 0-387-36053-0 Springer Berlin Heidelberg New York Springer is part of Springer-Science + Business Media (springer.com) Library of Congress Control Number: 2006937358 Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, this publication may only be reproduced, stored or transmitted, in any form or by any means, with the prior permission in writing of the publishers, or in the case of reprographic reproduction in accordance with the terms of licences issued by the Copyright Licensing Agency. Enquiries concerning reproduction outside those terms should be sent to the publishers. # Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 2007 Printed in Germany The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a speci®c statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. Cover design: Jim Wilkie Project management: Originator Publishing Services, Gt Yarmouth, Norfolk, UK Printed on acid-free paper Contents Authors' preface ....................................... xvii Acknowledgements...................................... xxiii Foreword............................................ xxv List of ®gures ........................................ xxxi List of abbreviations and acronyms ...........................xxxvii Prologue ........................................... -

Lehesten -Marktgölitz
AMTSBLATT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT PROBSTZELLA -LEHESTEN -MARKTGÖLITZ Nr. 10 Freitag, 31. August 2012 23. Jahrgang AMTLICHER TEIL Verwaltungsgemeinschaft Probstzella Informationen Bekanntmachungen des Bürgermeisters Erweiterte Öffnungszeiten Liebe Bürgerinnen und Bürger im Einwohnermeldeamt und im Standesamt Der August mit wenigen heißen Tagen ist vorüber. Am in Probstzella 22. September um 16.49 MESZ beginnt der Herbst. Obere Gasse 1, 07330 Probstzella Mit etwas Glück endet unser großes Thema des Jahres – die Vollsperrung in Gabe Gottes – am 29. September. Nachdem der Samstags-Sprechstunde Abriss der alten Brücke geglückt ist, scheint der planmäßigen Wiedereröffnung nichts mehr im Wege zu stehen. Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Einwohner- meldeamt sowie im Standesamt bitte unter Über den Sommer haben wir Klarheit über die diesjährigen Finanzen der Gemeinde gewonnen. Unser Haushalt ist ein echter Telefon: 03 67 35/4 61 24 Einwohnermeldeamt Sparhaushalt. Es werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Telefon: 03 67 35/4 61 25 Standesamt Schön ist, dass wir zum einen – Dank der Förderung des Landkreises – die Bedingungen für die Sportler auf der Kegelbahn in Zopten verbessern können. Und zum anderen – Dank der Unterstützung der Sparkasse und des Thüringer Justizministers Dr. Poppenhäger – die Beleuchtung in der Turnhalle Unterloquitz erneuern konnten. Besonders die Tischtennisspieler der SG Marktgölitz werden sich darüber freuen – wurde doch in der letzten Saison so mancher Ball von der Dunkelheit verschlungen. Die Straßenbaumaßnahmen im Grauweg, in der Lehestener Die nächste Ausgabe des Straße, am Schwarzebach in Zopten, in Arnsbach und in AMTSBLATTES Unterloquitz liegen alle auf Eis. Die Fördermittelstellen haben der VG Probstzella-Lehesten-Marktgölitz keine der Maßnahmen bewilligt. erscheint am 5. Oktober 2012. -
Challenge to Apollo: the Soviet Union and the Space Race, 1945-1974 1 by Asif A
CHALLENGE TO APOLLO: THE SOVIET UNION AND THE SPACE RACE, 1945- 1974 NASA SP-2000-4408 CHALLENGE TO APOLLO: THE SOVIET UNION AND THE SP_CE R;_cE, ! 945- 1974 by gsif _. Siddiqi National Aeronautics and Space Administration NASA History Division Office of Policy and Plans Washington, DC 2000 Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data Siddiqi, Asif A,, 1966- Challenge to Apollo: the Soviet Union and the space race, 1945-1974 1 by Asif A. Siddiqi p. cm.--(The NASA history series) NASA SP ; 2000-4408 Includes bibliographical references and index. I. Astronautics--Soviet Union--History. 2. Space race--History. I, Title. II. Series. III. NASA SP : 4408. TL789.8S65 $47 2000 629,4'0947-dc21 00-03868400031047 To my mother and my father, who taught me the value o[ knowledge History is always written wrong, and so always needs to be rewritten. --_eorge Santayana You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. --Rabindranath Tagore ¢ CHALLENGE TO APOLLO .......... TABLE OF CONTENTS Acknowledgments ................................................... vii Preface ............................................................ ix Glossary .......................................................... xiii Chapter One: Presage .................................................. I Chapter Two: First Steps................................................ 23 Chapter Three: Stalin and the Rocket ....................................... 69 Chapter Four: Sputnik ................................................ II 9 Chapter Five: Designing