Richtig Ballwerfen Lernen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
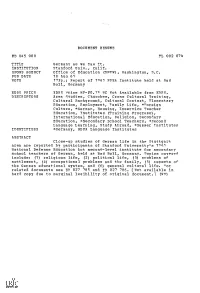
Germany As We Saw It
DOCUMENT RESUME ED 045 000 FL 002 074 TITLE Germany as We Saw It. INSTITUTION Stanford Univ., Calif. SPONS AGENCY Office of Education (DFFW), Washington, D.C. PUB DATE 18 Aug 61 NOTE 173p.: Report of 1061 NDEA Institute held at Bad Boll, Germany EDRS PRICE EDRS "Price MF-$0.7c HC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Area Studies, Churches, Cross Cultural Training, Cultural Background, Cultural Context, Elementary Education, Employment, Family Life, *Foreign Culture, *German, Housing, Inservice Teacher Education, Institutes (Training Programs), International Education, Religion, Secondary Education, *Secondary School Teachers, *Second Language Learning, Study Abroad, *Summer Institutes IDENTIFIERS *Germany, NDEA Language Institutes ABSTRACT Close-up studies of German life in the Stuttgart area are reported by participants of Stanford University's 1051 National Defense Education Act second-level institute for secondary school teachers of German, held at Bad Boll, Germany. Topics covered include: (1) religious life, (2) political life,(3) problems of settlement, (4) occupational problems and the family,(5) aspects of the German educational system, and (6)general cultural life. 17.or related documents see ED 027 785 and ED 027 786. [Not available in hard copy due to marginal legibility of original document.) (WR) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT.POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION POSITION OR POLICY. -report presented4the'partic.ipants n--the1961 Stanford -NDEA Institule '. eld...at -Bad. Boll,. Germany.. TABLE OF CONTENTS A. Religious Life in Airttemberg p. -

Exercise for Acute Respiratory Infections
Bond University Research Repository Exercise for acute respiratory infections Grande, Antonio José; Keogh, Justin; Hoffmann, Tammy C; Del Mar, Chris B; Peccin, Maria S Published in: Cochrane Database of Systematic Reviews DOI: 10.1002/14651858.CD010596 Licence: Other Link to output in Bond University research repository. Recommended citation(APA): Grande, A. J., Keogh, J., Hoffmann, T. C., Del Mar, C. B., & Peccin, M. S. (2013). Exercise for acute respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(6), 1-6. [CD010596]. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010596 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. For more information, or if you believe that this document breaches copyright, please contact the Bond University research repository coordinator. Download date: 27 Sep 2021 Cochrane Database of Systematic Reviews Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections (Review) Grande AJ, Keogh J, Hoffmann TC, Beller EM, Del Mar CB Grande AJ, Keogh J, Hoffmann TC, Beller EM, Del Mar CB. Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010596. DOI: 10.1002/14651858.CD010596.pub2. www.cochranelibrary.com Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections (Review) Copyright © 2015 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. -

Teaching Games for Understanding (Tgfu) - Beschreibung Und Analyse Eines Sportspieldidaktischen Vermittlungskonzeptes”
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Teaching Games for Understanding (TGfU) - Beschreibung und Analyse eines sportspieldidaktischen Vermittlungskonzeptes” Verfasser Markus Haubenberger angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, im Mai 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 190 482 344 Studienrichtung lt. Studienblatt: Lehramt Bewegung und Sport / Englisch Betreuer: Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Kolb Vorwort Während meines Lehramtsstudiums Bewegung & Sport und Englisch an der Universität Wien hatte ich die Chance, ein breit gefächertes Spektrum der Trainer – bzw. Betreuertätigkeit kennenzulernen. Ob Fußballtraining mit den „Minis“, die mit sechs Jahren erste taktische Konzepte verstehen lernen, Fußballtraining mit Schülern der Oberstufe, die taktische Vorgaben schon bedingt umsetzen oder Beachvolleyballkurse, bei denen in kurzer Zeit sichtbare Erfolge gewünscht werden - immer wieder beschäftigte mich dieselbe Frage, wie ich Sportspiele am effektivsten vermitteln kann, um den Kindern möglichst viele Erfolgserlebnisse zu bieten und ihnen Freude am Sport und dem Spiel zu gewähren. Sowohl bei den zahlreichen Hospitationen von Sportunterricht an verschiedenen Schulen, als auch bei den Sportvereinen meiner Heimat (ASK Ybbs, LAZ Wieselburg, FC Sarling) stelle ich fast immer fest, dass die Vermittlung der Technik der dominierende Teil der Trainingseinheiten ist und dadurch sehr häufig sehr wenig bis gar keine Spielzeit verbleibt. Auch im Sportunterricht, den ich im Gymnasium erteilt bekommen habe, wurde überwiegend technikorientiert unterrichtet. Ähnliches Bild in heimatlichen Fußballvereinen beginnend mit der U-8. Rückblickend kann ich sagen, dass vor allem ungeschicktere Kinder die Lust am Spiel verloren haben und oft die Turnstunde geschwänzt haben. Auch jene Burschen, die damals nicht so geschickt mit dem Fußball umgehen konnten, haben schon lange mit dem Fußballspielen aufgehört, weil sie sehr schnell die Freude am Spiel verloren hatten. -

Regelkunde 1
BASEBALL & SOFTBALL REGELKUNDE 1. DAS SPIELFELD In einem Baseballspiel stehen sich zwei Mannschaften zu je neun Spielern gegenüber. Gespielt wird auf einem Feld, das etwa einem Viertelkreis entspricht und eine Kantenlänge von ca. 100 Metern hat. Ähnlich dem Brennball befindet sich das verteidigende Team im Spielfeld und besetzt den Raum. Die Angreifer befinden sich außerhalb des eigentlichen Feldes und kommen nacheinander an den Schlag. Das Spielfeld nennt sich Fair Territory. Es unterteilt sich in das Infield, das die Bases umgibt und somit den inneren Bereich darstellt, und das Outfield, das den Rest des Spielfeldes bis zu einem hinteren Begrenzungszaun bildet. Das Spielfeld ist komplett eingezäunt. Den Bereich zwischen dem Fair Territory und dem seitlichen Begrenzungszaun nennt man Foul Territory. Bälle, die in diesen Bereich kommen, können zwar auch gespielt werden, grundsätzlich findet das Baseballspiel aber im Fair Territory statt. 4. HIT AND RUN! DAS SPIEL DER OFFENSIVE Ziel der Angreifer ist es, durch gute Schläge (Hits) die drei Bases im Infield zu umrunden und beim Überqueren der Home Plate einen Punkt (Run) zu erzielen. Nach einem Schlag wird der Batter zum Läufer (Runner) und versucht, so viele Bases wie möglich zu erlaufen. Je nach Qualität des Hits kann er eins, zwei oder drei Bases erlaufen und ist dort sicher (safe). Schafft er sogar alle vier Bases auf einmal zu umlaufen, nennt man dies einen Home Run. 5. OUT! DAS SPIEL DER DEFENSIVE Ziel der Defensive ist es, drei Angreifer aus (out) zu machen, um selbst das Schlagrecht zu erlangen und somit die Möglichkeit, Punkte zu erzielen. Hierzu haben die Verteidiger vier Möglichkeiten: \ Das Strike Out: Wie unter 3. -

Teachers' Notes
1 THE WORLD OF PLAY : TEACHERS’ NOTES This student’s Book has been designed for students of 4th ESO. But it may be used and adapted for other groups, too; for example it may be of some use for the design and preparation of a ‘Crèdit Variable’ or even an ‘Optativa de Batxillerat’. DURATION OF THE MODULE The module’s duration is of approximately 20 hours, distributed in 5 lessons of 4 hours each. The first 4 lessons are made up of : • THEMATIC INTRODUCTION: 8 hours • PRACTICAL GAME PLAYING: 8 hours • CREATIVE GAME DESIGN (assessment): 4 hours or more. The Thematic Introductions can be taught in the classroom, and can be used not only in PE lessons but also in English Language Lessons (this will be our option). CONTENTS The contents are based on P.E. but the topics covered in each unit do also include other aspects related to subjects such as Ethics, Philosophy, Geography and History. The contents are not part of the compulsory PE syllabus; they are a free interpretation of it. They are just a proposal for teachers and an invitation to take and reuse them in any way. Of course, the thematic introduction may be reduced to a much more PE-like format. AIMS The formal aims of the module are the following: • To make the English language the vehicle of the teaching and learning process. • To introduce them to the concept of play as an important aspect of life and culture. • To use games as a ‘catalyser’ not only for physical and social skills but also for thinking skills and as a source of knowledge. -

Schlagball Im Training Und Im Schulunterricht
Manfred Schimmler Schlagball im Training und im Schulunterricht Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .................................................................................................. 5 1.1. Was ist so besonders am Schlagball .................................................. 5 1.2. Geschichte des Schlagballs und verwandter Sportarten .................... 6 1.3. Zweck und Aufbau dieses Buches..................................................... 8 2. Die Regeln und einige Bemerkungen zur Taktik ..................................... 11 2.1. Der Spielgedanke und die Regeln: Ein informeller Einstieg ........... 11 2.2. Grundsätzliches zur Taktik des Schlagballspiels ............................. 12 3. Fangen und Werfen ................................................................................. 15 3.1. Die Wurfbewegung ......................................................................... 15 3.2. Die Fangbewegung ......................................................................... 16 3.2.1. Übungen zum Fangen und Werfen ......................................... 17 3.3. Fangen im Stress ............................................................................. 18 3.3.1. Übungen zum Fangen im Stress .............................................. 18 3.4. Fangen im Lauf ............................................................................... 21 3.4.1. Übungen zum Fangen im Lauf ................................................ 21 3.5. Fangen mit einer Hand (Fangpunkt) .............................................. -

From the Ball Throw to the Javelin Throw
The Basics: From the Ball Throw to the Javelin Throw by AFI ZOOM Video meeting Uwe Hohn May 1st 2020 AFI head coach javelin throw Klaus Bartonietz coach javelin throw throwing movements overhead throws basic movement patter of overhead throws we can find in different sport cricket, baseball volleyball badminton tennis handball soccer (throw-in) javelin throw golf ball 46g Vortex (Nerf) tennis ball 56-59g baseball 142-149g throwing balls 150-200g cricket ball 160g softball 178-190g „Schlagball“ 80g Wurfball 150g Finnflier Vortex rocket 130, 240g 450g 1.78m Turbo jav 300g, 400g (65-70cm), 500g (115cm), 600, 700g (180cm ) bamboo-sticks turbo jav Toddler Steps of development we can see children throw ball first with both arms (age 2) and later with one arm from: Meinel, K. (1960). Bewegungslehre, Sportverlag Berlin with the age 4-5 overhead throw of small ball, stones throwing a ball overhead is the first step towards the javelin throw important: as early as possible to understand by teacher/coach and student/young athlete the differences between the movements - by bowling a ball in cricket and - by throwing a ball overhead for distance or targets from DLV (eds.) 2011 Jugend-Leichtathletik. Philippika Sportverlag, Muenster. throw of the vortex rocket (about 12 years old) basic patter of the throw developed already at an acceptable level for this age - further improvements are required (leg work, arm movement) by changing to the javelin, the main focused has to become the control of the implement DR U12 56,15 m Tom Teršek létnica rojstva 2007 ŽALEC 2017 video: R. -

A History of the Presentation of American Football in England and Germany
FROM VIOLENCE TO PARTY: A HISTORY OF THE PRESENTATION OF AMERICAN FOOTBALL IN ENGLAND AND GERMANY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Lars Dzikus, M.A. * * * * * The Ohio State University 2005 Dissertation Committee: Approved by Professor Melvin L. Adelman, Adviser Professor Sarah K. Fields Adviser Professor William J. Morgan College of Education ABSTRACT While scholars have widely discussed the cultural, economic, and political influence of the United States on Europe in general and Germany in particular, the realm of sports has received surprisingly little attention. This study ties in with the scholarly debate about Americanization and / or globalization that started in the first half the 1990s. It examines the presentation of American football in England from the 1890s through World War II as well as in Germany following the war to the present day. The study discusses what non-Americans wrote about football and what their countrymen and –women read about it. The study draws on English and German newspapers and magazines, particularly the London Times and the Frankfurter Allgemeine Zeitung. It also examines the role American military, radio, television, and movies played in the diffusion of American football. In the case of Germany, the researcher draws on extensive qualitative interviews with several of the “founding fathers” of American football in Germany as well as his own experiences in the sport. The work demonstrates that American football arrived in Germany on a field that had been prepared by a three-hundred-year process of imagining Amerika. -

Bond University Research Repository Exercise Versus No Exercise for The
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Bond University Research Portal Bond University Research Repository Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections Grande, Antonio J ose; Keogh, Justin; Hoffmann, Tammy C.; Beller, Elaine M.; Del Mar, Chris B. Published in: Cochrane Database of Systematic Reviews DOI: 10.1002/14651858.CD010596.pub2 Published: 16/06/2015 Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in Bond University research repository. Recommended citation(APA): Grande, A. J. O., Keogh, J., Hoffmann, T. C., Beller, E. M., & Del Mar, C. B. (2015). Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(6), [CD010596]. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010596.pub2 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. For more information, or if you believe that this document breaches copyright, please contact the Bond University research repository coordinator. Download date: 09 Oct 2020 Cochrane Database of Systematic Reviews Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections (Review) Grande AJ, Keogh J, Hoffmann TC, Beller EM, Del Mar CB Grande AJ, Keogh J, Hoffmann TC, Beller EM, Del Mar CB. Exercise versus no exercise for the occurrence, severity and duration of acute respiratory infections. -
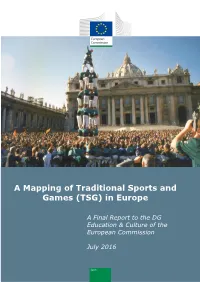
Study Template
A Mapping of Traditional Sports and Games (TSG) in Europe A Final Report to the DG Education & Culture of the European Commission July 2016 EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Directorate C — Youth & Sport Unit C.3 — Sport policy and programme Contact: [email protected] European Commission B-1049 Brussels 2 EUROPEAN COMMISSION A Mapping of Traditional Sports and Games (TSG) in Europe Final Report to the DG Education & Culture of the European Commission written by Directorate-General for Education and Culture July 2016 SPORT EN Disclaimer This document has been prepared for the European Commission; however, it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 ISBN 978-92-79-61997-7 doi: 10.2766/00810 © European Union, 2016 Picture “Quatre de vuit in Vatican City” by castellersvilafranca - Own work, licensed under CC BY-SA 3.0, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. European Commission B-1049 Brussels 4 Table of Contents 1.0 Introduction & methodology ............................. 6 1.1 Objectives ............................................................................................. 6 1.2 Background information .......................................................................... 6 1.3 Methodology ........................................................................................ -

(2016). Exercise Prior to Influenza Vaccination for Limiting Influenza Incidence and Its Related Complications in Adults
Foster, C. , Grande, A. J., Reid, H., Thomas, E., & Nunan, D. (2016). Exercise prior to influenza vaccination for limiting influenza incidence and its related complications in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015, [CD011857.pub2]. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011857.pub2 Publisher's PDF, also known as Version of record License (if available): Other Link to published version (if available): 10.1002/14651858.CD011857.pub2 Link to publication record in Explore Bristol Research PDF-document This is the final published version of the article (version of record). It first appeared online via Wiley at https://doi.org/10.1002/14651858.CD011857.pub2 . Please refer to any applicable terms of use of the publisher. University of Bristol - Explore Bristol Research General rights This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available: http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/ Cochrane Database of Systematic Reviews Exercise prior to influenza vaccination for limiting influenza incidence and its related complications in adults (Review) Grande AJ, Reid H, Thomas EE, Nunan D, Foster C Grande AJ, Reid H, Thomas EE, Nunan D, Foster C. Exercise prior to influenza vaccination for limiting influenza incidence and its related complications in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011857. DOI: 10.1002/14651858.CD011857.pub2. www.cochranelibrary.com Exercise prior to influenza vaccination for limiting influenza incidence and its related complications in adults (Review) Copyright © 2016 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. -

Sportschau Essen 2011
SPORTSCHAU ESSEN ....................... ................ .. .............. ...... .................................... .................................... .................................... .................................... ......................... ......................... .......... ............. .. ...... ....... ................. ............................... ................ .............. Essener Sportbund (Hg.) SPORTSCHAU ESSEN 2011 Texte / Koordination: Robert Gerlings Redaktion und Produktion: Achim Nöllenheidt ■ IMPRESSUM 1. Auflage November 2011 Fotos: Texte: Satz und Gestaltung: WAZ FotoPool: Robert Gerlings, Christian Schwarz, Jan Schimmel- Achim Nöllenheidt Michael Gohl, Walter Buchholz, Kerstin Kokoska, pfennig, Benedikt Burgmer, Björn Soennichsen, Cover-Design: Volker Pecher, Essen Svenja Hanusch, Ulrich von Born, Hans-Werner Rieck, Dietmar Mauer, Achim Faust, Rolf Hantel, Christoph Druck: Drukkerij Wilco B.V. / NL Kerstin Bögeholz, Udo Kreikenbohm, Andreas Winkel, Ute Freise, Hubert Wildschütz, Dieter Meier, © Klartext Verlag, Essen 2011 Mangen, Oliver Schinkewitz, Mathias Schumacher, Markus Kleine-Beck, Walter Brühl, Elli Schulz, Thomas Alle Rechte vorbehalten Remo Bodo Tietz, Udo Milbret, Oliver Müller, Lelgemann, Winfried Stöckmann. ISBN 978-3-8375-0692-1 Alexandra Umbach, Christoph Wojtyczka, Joachim www.klartext-verlag.de Kleine-Büning, Arnold Rennemeyer, Uwe Möller, Dennis Straßmeier, Detlev Seyb, Reiner Worm, Monika Kirsch, Ulrich Bangert. außerdem: Dieter Meier, Ute Freise, Hubert Wildschütz, Guido Schiefer