Historia Scribere 07 (2015)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sabine Schuchter Ist Herrin Der Imster Geschichte Im Ballhaus Seite 32 Foto: U
Ausgabe 12. 2014 • 1. Juli 2014 Tischlerei Praxmarer GmbH A-6444 Längenfeld - Huben Tel. 05253 / 5519 www.praxmarer.com Sabine Schuchter ist Herrin der Imster Geschichte im Ballhaus Seite 32 Foto: U. Millinger U. Foto: Unternehmen des Monats auf Seiten 26 + 27 Freude über neuen Spielplatz und Pavillon Ein Festtag für den Ort und das ganze 1 Sichtlich erfreut über den neuen kapelle Schattwald gaben zum Bürgermeister der Standortge- Tannheimertal war die Eröffnung und Spielplatz zeigten sich Bundesrätin ersten Mal im neuen „Pavillon“ ein meinde, Herbert Durst. Segnung des Natur- und Wasserspiel- Sonja Ledl-Rossmann und Gün- Konzert für die zahlreich erschie- 6 Pfarrer Boguslaw Duda und Pas - platzes für die Kleinsten. Mit großem ther Salcher, Geschäftsführer der nene Bevölkerung aus dem Ort und toralassistent Diakon Gerhard Aufwand und viel Gespür wurde ein Er- Regionalentwicklung Außerfern. dem ganzen Tal. Hartmann segneten die neue An- lebniszentrum nach neuesten Erkennt- 2 In guter Nachbarschaft zur Ge- 4 „Bluatschink“ Toni Knittel mit Gat- lage. nissen geschaffen. Die Bevölkerung meinde Schattwald freuten sich die tin Margit sorgten dann für Unter- 7 Um die sportliche Betätigung der nahm regen Anteil, besichtigte die An- Bürgermeisterkollegen Markus haltung und Spaß für die Kleinsten. Kinder braucht sich Sprengelarzt lage und feierte kräftig. Gleichzeitig Eberle (Tannheim) und Werner 5 Verantwortlich für den Bau waren Erwin Pfefferkorn keine Sorgen wurde der neue Eingangsbereich zu Gehring (Zöblen) über die neue Er- Christoph Leuschen und Andrea mehr zu machen. Das freute seinen Schule und Kindergarten als Konzert- rungenschaft. Schreiber (Seeger Landschafts- Bürgermeister Martin Schädle aus bühne erfolgreich getestet. 3 Die 50 Musiker der Bürgermusik- bau). -

Bezirksfeuerwehrkommando Imst Unterdorf 7 | Karrösten | 6463 Karrösten Email: [email protected] | Mobil: +43 (699) 12555118
Bezirksfeuerwehrkommando Imst Unterdorf 7 | Karrösten | 6463 Karrösten EMail: [email protected] | Mobil: +43 (699) 12555118 vorläufige Ergebnisliste (Stand: 23.06.2018 16:26) 46 Bezirks-Nassleistungsbewerb Bezirk Imst 22.06.2018 - 23.06.2018 BFKDO Imst Rang Gruppenname Instanz AFKDO Nr. Löschangriff Fehler Vorgab Altersp Gesamt Bezirk A - ohne Alterspunkte / BNLB Bezirk 1 Huben im Ötztal 3 Huben im Ötztal Hinteres Ötztal 34 51,73 0 500,00 0,00 448,27 2 Sölden 3 Sölden Hinteres Ötztal 10 55,14 0 500,00 0,00 444,86 3 Längenfeld 1 Längenfeld Hinteres Ötztal 66 46,00 10 500,00 0,00 444,00 4 Tarrenz 2 Tarrenz Imst / Gurgltal 64 51,13 5 500,00 0,00 443,87 5 St. Leonhard 2 St. Leonhard Pitztal 43 56,23 0 500,00 0,00 443,77 6 Tarrenz 3 Tarrenz Imst / Gurgltal 65 59,70 0 500,00 0,00 440,30 7 Niederthai 3 Niederthai Vorderes Ötztal 74 45,21 20 500,00 0,00 434,79 8 Huben im Ötztal 1 Huben im Ötztal Hinteres Ötztal 32 56,87 10 500,00 0,00 433,13 9 Oetz Oetz Vorderes Ötztal 18 60,13 10 500,00 0,00 429,87 10 Längenfeld 2 Längenfeld Hinteres Ötztal 49 63,79 10 500,00 0,00 426,21 11 Längenfeld 3 Längenfeld Hinteres Ötztal 50 69,61 5 500,00 0,00 425,39 12 Arzl im Pitztal 2 Arzl im Pitztal Pitztal 51 76,80 0 500,00 0,00 423,20 13 Mieming 1 Mieming Inntal / Mieminger Plateau 55 72,26 5 500,00 0,00 422,74 14 Huben im Ötztal 2 Huben im Ötztal Hinteres Ötztal 33 52,61 25 500,00 0,00 422,39 15 Leins Leins Pitztal 53 72,72 10 500,00 0,00 417,28 16 Plangeroß Plangeroß Pitztal 8 70,78 15 500,00 0,00 414,22 17 Ochsengarten Ochsengarten Vorderes Ötztal 23 -

Sport, Natur & Kultur
Sport, Natur & Kultur Winteredition 10 Orte 20 Skifahren 57 Pferdekutschenfahrt 11 Imst 24 Skigebiet Imst 58 Klettern 12 Imsterberg 28 Skischule 62 Glenthof 13 Karres 29 Nachtskilauf 14 Karrösten 30 Skigebiete um Imst 66 Wohin 15 Mils bei Imst 32 Kinderskiwochen 68 Therme 16 Nassereith 34 Familypark 70 Hallenbäder 17 Roppen 36 Hütten & Almen 72 Ausflüge 18 Schönwies 38 Skitouren 19 Tarrenz 78 Kultur 42 Aktiv 82 Museen 46 Langlaufen 88 Advent 48 Rodeln 90 Fasnacht 50 Alpine Coaster 96 Ostern 52 Winterwandern 98 SOS-Kinderdorf 54 Schneeschuhwandern 100 Persönlichkeiten 56 Eislaufen / Eisstock 106 Dialekt Infobüros +43 5412 6910 0 Imst · Johannesplatz 4 [email protected] Nassereith · Postplatz 28 www.imst.at Trofana Tyrol · Mils bei Imst Fernpass Nassereith Innsbruck J A12 INNTAL GURGLTAL Tarrenz Haiming Hoch-Imst A12 Ötztal Bahnhof Karrösten Karres Roppen Mils bei Imst Kühtai Arzl im Pitztal Sautens Ötz Imsterberg Schönwies L ÖTZTAL L Landeck A12 Wenns PITZTAL Jerzens L L 6 FERIENREGION IMST FERIENREGION IMST 7 Jeden Tag erleben Erleben Sie Ihr buntes Nennen Sie es Winterurlaub, Auszeit Winterwunder in der oder Abenteuer. Imst ist all das in einem. Ferienregion Imst und Die Winter sind reich an Schnee und genießen Sie die Vielfalt Möglichkeiten. Sie vereinen die Klassiker an Erlebniswelten. des Wintersports mit der zeitgemäßen Interpretation von Erholung und Entspannung. Im Wald und am Berg, auf Skiern und mit Schnee- schuhen, drinnen und draußen bietet die Region die ganze Palette der Wintervielfalt. Skifahrern und Genießern liegt der Winter in seiner ganzen Pracht zu Füßen. Verschneite Pisten laden dazu ein, die weiße Win- terlandschaft in den Skigebieten aktiv zu erkunden. -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich
1 von 4 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2006 Ausgegeben am 17. Juli 2006 Teil II 262. Verordnung: Belastete Gebiete (Luft) zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 [CELEX-Nr.: 31985L0337, 32003L0035] 262. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über belastete Gebiete (Luft) zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 Auf Grund des § 3 Abs. 8 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2005, wird verordnet: § 1. Gebiete, in denen die Immissionsgrenzwerte des Immissionsschutzgesetzes – Luft, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2006, wiederholt oder auf längere Zeit überschritten werden und Luftschadstoffe, für die dort entsprechende Überschreitungen gemessen wurden, sind in den Bundesländern: 1. Burgenland: das gesamte Landesgebiet (PM10), 2. Kärnten: a) im Stadtgebiet von Klagenfurt die Katastralgemeinden Ehrenthal, Klagenfurt, St. Martin bei Klagenfurt, St. Peter bei Ebenthal, St. Ruprecht bei Klagenfurt, Waidmannsdorf und Wel- zenegg sowie der südliche Teil der Katastralgemeinde Marolla, der im Süden, Osten und Wes- ten von den Katastralgemeindegrenzen und im Norden von der Josef-Sablatnig-Straße be- grenzt wird (PM10), b) die Stadt- und Gemeindegebiete von Frantschach-St. Gertraud, St. Andrä, St. Georgen im Lavanttal, St. Paul im Lavanttal und Wolfsberg, soweit sie eine Seehöhe von 800 m nicht überschreiten (PM10), c) das Gebiet der Katastralgemeinde -

Biotopverbund & Wildtierkorridor Via Claudia Augusta
Biotopverbund & Wildtierkorridor Via Claudia Augusta Ein Projekt der Tiroler Umweltanwaltschaft in Kooperation mit: WWF Österreich Tiroler Schutzgebiete Naturpark Kaunergrat Landschaftsplanungsregion Gurgltal Schutzgebiet Ehrwalder Becken und Wasenmöser Naturpark Tiroler Lech Endbericht August 2012 verfasst von Viktoria Ennemoser Inhalt I. Zusammenfassung ....................................................................................... 3 II. Einleitung und Problemstellung ................................................................... 4 III. Ziele ............................................................................................................. 5 IV. Projektgebiet ............................................................................................... 6 V. Methodik ..................................................................................................... 9 A. Konzept und Erhebung der Leitarten .......................................................................................... 9 B. Erhebung von Barrieren, Lebensraumdefiziten und Maßnahmen ........................................... 11 1. Leitgruppe Amphibien ........................................................................................................... 11 2. Leitart Biber (Castor fiber) ..................................................................................................... 12 3. Leitgruppe Fische / Leitart Koppe (Cottus gobio) .................................................................. 13 4. Leitart Feldgrille -

Demographische Daten Tirol 2016
DEMOGRAPHISCHE DATEN TIROL 2016 Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Landesstatistik Tirol Innsbruck, August 2017 Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Bearbeitung: Dr. Christian Dobler Redaktion: Mag. Manfred Kaiser Adresse: Landhaus 2 Heiliggeiststraße 7-9 6020 Innsbruck Telefon: +43 512 508 / 3603 Telefax: +43 512 508 / 743605 e-mail: [email protected] http://www.tirol.gv.at/statistik Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Quellenangabe gestattet. Das Bundesland Tirol im Jahr 2016 Vorwort Die von der Landesstatistik herausgegebene Publikation „Demographische Daten Tirol 2016“ stellt Zahlen und Daten aus allen gesellschaftlich bedeutenden Bereichen vor. Sie präsentiert damit eine aktuelle und aussagekräftige Analyse und – in weiterer Folge – eine objektive Grundlage für künftige Maßnahmen und gesellschaftspolitische Weichenstellungen. Die vorliegende Veröffentlichung informiert über eine Vielzahl konkreter Themen. Die Datenerhebung erfasst Aktuelles zum Bevölkerungsstand, zu Geburten, Sterbefällen, zu Einbürgerungen und Migration, Eheschließungen und weiteren Bereichen, die für die künftige Entwicklung unseres Bundeslandes von Bedeutung sind. - So lebten am 31.12.2016 746.153 Personen in Tirol. Verglichen mit dem Vorjahr hat die Bevölkerungszahl in Tirol um 7.014 Personen (+0,9 %) zugenommen. Die Bevölkerungszunahme war zwar geringer als im Vorjahr, erreichte aber den zweithöchsten Wert seit Anfang der 1990er Jahre. Ein hoher Wanderungsgewinn sowie eine positive Geburtenbilanz waren für die überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme verantwortlich. - Der allgemein zu beobachtende Trend einer älter werdenden Gesellschaft macht auch vor unserem Bundesland nicht halt. Die Tiroler Bevölkerung weist einerseits eine niedrige Geburtenziffer auf, andererseits aber auch eine steigende Lebenserwartung. Beides führt dazu, dass in rund 20 Jahren bereits jede/r vierte TirolerIn 65 Jahre oder älter sein wird. -

Waldbetreuungsgebiete Im Bezirk Imst Bezirk Waldbetreuungsgebiet
Waldbetreuungsgebiete im Bezirk Imst Bezirk Waldbetreuungsgebiet GEM_NR GEM_NAME KG_NR KG_NAME Grundstück-Nummer Anmerkungen Imst Arzl im Pitztal 201 Arzl im Pitztal 80001 Arzl im Pitztal alle alle Gst. der KG Haiming, die nördlich und nordwestlich der nördlichen siehe WBG Haiming- Imst Haiming-Inntal 202 Haiming 80101 Haiming Grundstückslinie des Gst.-Nr. 5342/15 liegen Ochsengarten alle Gst. der KG Haiming, die in Ochsengarten liegen. Diese umfassen die siehe WBG Haiming- Imst Haiming-Ochsengarten 202 Haiming 80101 Haiming Wälder der Agrargemeinschaft Ochsengarten in EZ 262 und alle Privatwälder Inntal in Ochsengarten Imst Imst-Oberstadt 203 Imst 80002 Imst alle östlich des Pigerbaches und nördlich des Malchbaches Imst Imst-Unterstadt 203 Imst 80002 Imst südlich des Malchbaches 204 Imsterberg 80003 Imsterberg alle Imst Imsterberg/Mils 210 Mils bei Imst 80007 Mils alle Imst Jerzens 205 Jerzens 80004 Jerzens alle mit Ausnahme der Gst. im Bereich Steinhof oberhalb des Weilers Kienberg siehe WBG Wenns Imst Karres 206 Karres 80005 Karres alle Imst Karrösten 207 Karrösten 80006 Karrösten alle alle Grundstücke südlich des Hauerbaches, ausgenommen die Gst-Nr. 11999 siehe WBG Imst Längenfeld-Süd 208 Längenfeld 80102 Längenfeld und 12000 und alle Gst. südlich des Fischbaches, ausgenommen das Längenfeld-Nord Waldgebiet östlich der Waldlehnrinne (östlich des Gst-Nr. 9726/14) alle Grundstücke nördlich des Hauerbaches sowie die beiden südlich des Hauerbaches gelegenen Gst-Nr. 11999 und 12000; weiters alle Gst. nördlich siehe WBG Imst Längenfeld-Nord 208 Längenfeld 80102 Längenfeld des Fischbaches und zusätzlich südlich des Fischbaches das Waldgebiet Längenfeld-Nord östlich der Waldlehnrinne (östlich des Gst-Nr. 9726/14) Imst Mieming 209 Mieming 80103 Mieming alle 211 Mötz 80113 Mötz alle 221 Stams 80111 Stams alle Imst Mötz/Stams Mötzer Lärchwald bestehend aus Gst-Nr. -

Muttekopfgebiet Und Latschenhütte Hahntennjoch Starkenbach 5
7 7 8 9 10 1 1 1 2 3 4 5 2 3 11 4 9 6 5 6 7 5 Latschenstein Sportklettern KÜBELWÄNDE ZUSTIEG: ab Untermarkter Alm / 20 min., bergauf in der Ferienregion Imst Muttekopfgebiet Teufelskralle BACHSEITE GUGGERKÖPFLE Muttekopfhütte ABSICHERUNG: «««« (OSTSEITE) OSTWAND 8 5 und Latschenhütte 1 Gugger- 2 17 12 sattele Schafskopf AUSRICHTUNG: Ost, Süd, Nord, West 10 8 Teufelskralle 7 3 Muttekopfhütte 1 ROUTENLÄNGE: 10–20 m Ideale Bedingungen und genug 8 2 5 12 4 zum FAMILIENFREUNDLICH: Ja 5 zu tun für erfahrene Sportkletterer. 5 17 4 8 6 10 12 7 1 Muttekopf FLACHE SEITE 8 2 15 13 9 WINTERKLETTERGEBIET: Nein (SÜDSEITE) 12 10 7 17 18 11 11 4 17 Das Muttekopfgebiet steht als Synonym für alpi- 10 10 12 5 16 9 9 a 7 9 14 8 13 6 6 ne Kletterhighlights. Wer sein ganz persönliches 7 13 3 4 5 6 6 14 MITTLERER 6 2 12 1 2 7 4 5 7 8 6 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5 11 4 5 2 9 1 6 7 8 9 10 2 3 1 2 3 BLAUER KOPF 1 Outdoor-Erlebnis sucht, findet es hier. Schon in 1 RAMMSTEIN 16 8 EISENHUT 15 7 den 60ern wurde an den Felsen Klettergeschichte 8 14 WEGSEITE 1 7 9 11 7 3 10 12 13 geschrieben, seither versorgen die Klettergärten ihre 2 6 13 (WESTSEITE) 3 6 2 Guggersattele 4 5 12 Bachseite (Ostseite) 5 1 KLETTERGARTEN 11 7 8 9 Besucher mit allem, was sie für ihr eigenes Abenteuer 24 9 10 UNTERER 5 4 FÖLSEFESCHT 8 BLAUER KOPF 10 FELSWURM 6 6 7 1 Nr. -
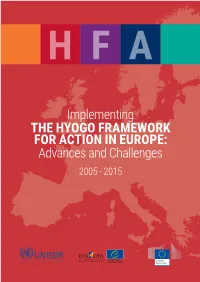
Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A
H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 Table of Contents 1. HFA Expected Outcomes..............................................................................................................9 2. Main Achievements of the HFA..................................................................................................10 2.1. Strategic Goal Area 1..........................................................................................................................................10 2.2. Strategic Goal Area 2..........................................................................................................................................15 2.3. Strategic Goal Area 3..........................................................................................................................................19 3. Drivers of Progress........................................................................................................................21 3.1. Multi-Hazard Approach......................................................................................................................................22 3.2. Gender Approach...............................................................................................................................................24 3.3. Capacities Approach...........................................................................................................................................25 -

Das Imster Bergl – Botschafter Aus Der Eiszeit
Das Imster Bergl – … was da kreucht Botschafter aus der Eiszeit und fleucht Mitten in der Stadt, gleich hinter einem Christogramm aus dem der Johanneskirche, da sieht man 5. Jahrhundert!), und weiter nörd- eine geologisch außergewöhnliche lich die Pestkapelle, die an eine der Formation – das Bergl. Als Kalva- großen Katastrophen der frühen rienberg religiöser Mittelpunkt Neuzeit gemahnt, an den Schwar- der österlichen Karwoche, wenn zen Tod! betende Gläubige die Stationen Manche Wohnräume der an das des Kreuzwegs aufsuchen; von Bergl angebauten Häuser wurden originellen Sagen umwoben; ein sogar in das Konglomerat hinein- reizender Fleck Natur. getrieben, zwei rauschende Bäche Das Alter des Bergls wird auf grenzen sie ein, und hier beginnt Durchquert man die Rosengarten- hingegen sind wärmebegünstigt 26.000 Jahre ermittelt, es ist also die reizvolle Wanderung durch die schlucht, lassen sich im Zeitraffer und Ahorn, Linde, Esche und vor dem Höchststand der letzten Rosengartenschlucht. Millionen Jahre Erdgeschichte Wolliger Schneeball sind hier zu Eiszeit (Würm) entstanden! Es ist schon ein bemerkenswertes nachvollziehen. Auf 1,5 Kilometern finden. Derzeit wird der westlich Oben auf der Anhöhe steht die Fleckchen Heimat, das man sich und über einen Höhenunterschied liegende „Steffelwald“ als Misch- Laurentiuskirche, eines der bei einem gemütlichen Spazier- von 200 Metern hat der Schinder- wald aufgeforstet – eine weitere ältesten Kirchlein Tirols (mit gang erschließen kann. bach die Schlucht geformt. Bereicherung dieses einmaligen Kleinods. Die geschützte Land- Die Rosengartenschlucht durch- schaft – ökologisch in natürlichem schneidet Riffkalk, der in der Gleichgewicht – ist Lebensraum Trias – vor mehr als 230 Millionen für eine Vielzahl von Tieren und Jahren – abgelagert wurde. Trotz zugleich Naherholungsgebiet. In des reichlich kristallklaren Wassers der Schlucht schaffen es nur gut (Güteklasse 1) ist die Rosengarten- angepasste Spezialisten, wie z. -

Interkommunale Zusammenarbeit in Tirol
Interkommunale Zusammenarbeit in Tirol Strukturen und Möglichkeiten – eine Praxisanalyse Peter Bußjäger, Georg Keuschnigg, Stephanie Baur Juni 2016 Geleitwort von Landesrat Johannes Tratter Die Studie des Instituts für Föderalismus über den Stand der interkommunalen Zusammen- arbeit in Tirol sowie über Kooperationsmodelle im deutschsprachigen Raum weist für unser Bundesland ein beachtliches Niveau aus. Im Durchschnitt verfügt jede Gemeinde über 27 Kooperationsschnittstellen, inklusive aller Pflichtsprengel wurden 946 Gemeindekoopera- tionen gezählt. Dieses Ausmaß der Zusammenarbeit bedeutet aber nicht, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die steigende Komplexität vieler Verwaltungsmaterien, die Fülle an neuen Aufgaben – als Beispiel sei nur das e-Government genannt –, die demografische Ent- wicklung und immer enger werdende finanzielle Spielräume lassen den Druck vor allem auf die Klein- und Kleinstgemeinden steigen. Dazu kommen eine hohe Mobilität der Bevölkerung mit geänderten Funktionsräumen und die Erwartungshaltung, dass überall ein vergleichbares Niveau der öffentlichen Dienstleistungen angeboten wird. Der Blick auf Lösungsmodelle im deutschsprachigen Raum zeigt, dass überall nach neuen Wegen gesucht wird, es aber kein Generalrezept gibt. Die Analyse macht vor allem deutlich, dass Fusionen kein Allheilmittel sind, sondern vielmehr nach Aufgabengebieten unter- schiedliche Ansätze zu verfolgen sind. Während raumbezogene Leistungen durch ein engeres Zusammenrücken besser bewältigt werden können, empfehlen sich für andere Aufgaben -

Stück Viiia - Sondernummer
Verordnungsblatt Jahrgang 2019 Innsbruck, 14. August 2019 Stück VIIIa - Sondernummer GZ BD-1464/75-2019 44. VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL VOM 14. AUGUST 2019 ÜBER DIE FESTSETZUNG DER SCHULSPRENGEL FÜR DIE ÖFFENTLICHEN ALLGEMEINBILDENDEN PFLICHTSCHULEN IN TIROL (PFLICHTSCHULSPRENGELVERORDNUNG) Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, 43 Abs. 1, 56 Abs. 1 und 69 Abs. 1 des Tiroler Schulorganisationsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 84/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 144/2018, wird nach Anhören der gesetzlichen Schulerhalter verordnet: § 1 (1) Für die öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen in Tirol werden die in der Anlage umschriebenen Schulsprengel festgesetzt. (2) Die in der Anlage als Schulsprengel bezeichneten Gebiete sind Pflichtsprengel, soweit in dieser nichts anderes bestimmt ist. § 2 Diese Verordnung tritt mit 1. September 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015 über die Festsetzung der Schulsprengel für die öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen in Tirol (Pflichtschulsprengelverordnung), LGBl. Nr. 77/2015, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 97/2018, außer Kraft. Der Bildungsdirektor: Dr. Paul Gappmaier Anlage: A. Bildungsregion Tirol Mitte (Politische Bezirke Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt und Schwaz) I. Politischer Bezirk Innsbruck-Land 1. Volksschulen: Volksschule Schulsprengel Absam das Gemeindegebiet von Absam Aldrans das Gemeindegebiet von Aldrans; der Stapfhof der Gemeinde Ampass Ampass das Gemeindegebiet von Ampass (ohne den Stapfhof) Axams das Gemeindegebiet