PDF-Dokument
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
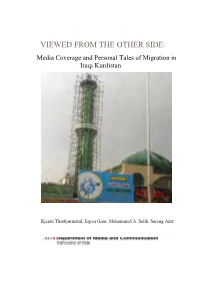
VIEWED from the OTHER SIDE: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan
VIEWED FROM THE OTHER SIDE: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan Kjersti Thorbjørnsrud, Espen Gran, Mohammed A. Salih, Sareng Aziz Viewed from the other Side: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan Kjersti Thorbjørnsrud, Espen Gran, Mohammed A. Salih and Sareng Aziz IMK Report 2012 Department of Media and Communication Faculty of Humanities University of Oslo Viewed from the other side: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan Contents Acknowledgements ............................................................................................................ III Abbreviations..................................................................................................................... IV Executive summary ............................................................................................................. V The coverage of migration in Iraqi Kurdistan ....................................................................VI Why certain frames and stories dominate in the news – findings from elite interviews .... VII The main motivations of migration in Iraqi Kurdistan .......................................................IX The experiences of those who have returned from Europe – expectations and disappointments ................................................................................................................IX Knowledge and evaluation of European immigration and return policies ............................ X Main conclusions .............................................................................................................. -

Gericht Entscheidungsdatum Geschäftszahl Spruch Text
08.11.2019 Gericht BVwG Entscheidungsdatum 08.11.2019 Geschäftszahl I415 2224340-1 Spruch I415 2224340-1/5E IM NAMEN DER REPUBLIK! Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Hannes LÄSSER über die Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, Staatsangehörigkeit Irak, gesetzlich vertreten durch die Mutter XXXX, geb. XXXX, diese vertreten durch Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH und Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH als Mitglieder der ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe und den MigrantInnenverein St. Marx, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.09.2019, Zl. XXXX, zu Recht erkannt: A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. Text ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: I. Verfahrensgang: Die Eltern des minderjährigen Beschwerdeführers und zwei minderjährige Brüder und die minderjährige Schwester des Beschwerdeführers stellten am 31.12.2015 nach ihrer schlepperunterstützten unrechtmäßigen Einreise in das Bundesgebiet vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf internationalen Schutz. Die Genannten sind Staatsangehörige des Irak und gehören der kurdischen Volksgruppe an. Im Rahmen der niederschriftlichen Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Polizeiinspektion XXXX am Tag der Antragstellung legte der Vater des Beschwerdeführers dar, den Namen XXXX zu führen. Er sei am XXXX1985 in XXXX geboren, Angehöriger der kurdischen Volksgruppe und bekenne sich zum Islam. Zuletzt habe er in Erbil gelebt und als Hilfsarbeiter gearbeitet. Im Hinblick auf den Reiseweg brachte der Vater des Beschwerdeführers zusammengefasst vor, den Irak am 10.12.2015 mit der Mutter des Beschwerdeführers und den gemeinsamen Kindern legal von Erbil ausgehend auf dem Landweg in die Türkei verlassen zu haben. -

Iraq 2017 Human Rights Report
IRAQ 2017 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Iraq is a constitutional parliamentary republic. The outcome of the 2014 parliamentary elections generally met international standards of free and fair elections and led to the peaceful transition of power from former prime minister Nuri al-Maliki to Prime Minister Haider al-Abadi. Civilian authorities were not always able to exercise control of all security forces, particularly certain units of the Popular Mobilization Forces (PMF) that were aligned with Iran. Violence continued throughout the year, largely fueled by the actions of the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Government forces successfully fought to liberate territory taken earlier by ISIS, including Mosul, while ISIS sought to demonstrate its viability through targeted attacks. Armed clashes between ISIS and government forces caused civilian deaths and hardship. By year’s end Iraqi Security Forces (ISF) had liberated all territory from ISIS, drastically reducing ISIS’s ability to commit abuses and atrocities. The most significant human rights issues included allegations of unlawful killings by some members of the ISF, particularly some elements of the PMF; disappearance and extortion by PMF elements; torture; harsh and life-threatening conditions in detention and prison facilities; arbitrary arrest and detention; arbitrary interference with privacy; criminalization of libel and other limits on freedom of expression, including press freedoms; violence against journalists; widespread official corruption; greatly reduced penalties for so-called “honor killings”; coerced or forced abortions imposed by ISIS on its victims; legal restrictions on freedom of movement of women; and trafficking in persons. Militant groups killed LGBTI persons. There were also limitations on worker rights, including restrictions on formation of independent unions. -

Foreign Satellite & Satellite Systems Europe Africa & Middle East Asia
Foreign Satellite & Satellite Systems Europe Africa & Middle East Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia & Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Herzegonia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Egypt, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ethiopia, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Macedonia, Libya, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Moldova, Montenegro, The Netherlands, Norway, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Uganda, Western Sahara, Zambia. Armenia, Ukraine, United Kingdom. Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen. Asia & Pacific North & South America Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, China, Hong Kong, India, Japan, Kazakhstan, Honduras, Jamaica, Mexico, Puerto Rico, United Kyrgyzstan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, States of America. Argentina, Bolivia, Brazil, Nepal, Pakistan, Phillipines, South Korea, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Uruguay, Venezuela. Uzbekistan, Vietnam. Australia, French Polynesia, New Zealand. EUROPE Albania Austria Belarus Belgium Bosnia & Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic France Germany Gibraltar Greece Hungary Iceland Ireland Italy -

Iraqi Kurds Go to the Polls: Is Change Possible? | the Washington Institute
MENU Policy Analysis / PolicyWatch 1556 Iraqi Kurds Go to the Polls: Is Change Possible? by J. Scott Carpenter, Ahmed Ali Jul 23, 2009 ABOUT THE AUTHORS J. Scott Carpenter J. Scott Carpenter is an adjunct fellow at the Washington Institute for Near East Policy. Ahmed Ali Ahmed Ali is a program officer at the National Endowment for Democracy. Brief Analysis n July 25, Iraqi Kurds go to the polls to vote in a joint parliamentary and presidential election. Although a O heated competition in January produced massive change at the provincial level throughout the rest of Iraq, the electoral system produced by the incumbent Iraqi Kurdistan parliament prevents such sweeping changes in the north. Both the current coalition governing the Kurdish Regional Government (KRG) and the current KRG president, Masoud Barzani, will most likely be reelected. Despite the lack of change, the postelection period will create an opportunity for Baghdad, Washington, and the KRG to resolve outstanding issues that cause increased tension between Arabs and Kurds. Resolution can occur only if all parties take advantage of new political openings, however narrow. Impact of the Electoral Law The KRG's 2009 amended election law combines the three provinces of Iraqi Kurdistan into a single district and presents a closed-list system that requires voters to select only lists, not candidates. This electoral system maximizes support for well-organized, well-disciplined parties; additionally, it prevents independent groups from gaining significant electoral ground, since would-be challengers to the establishment have to field candidates across the entire Kurdish region, even if they are only strong in certain areas. -

6. Kurdistan Region of Iraq (KRI)
Country Policy and Information Note Iraq: Political opinion in the Kurdistan Region of Iraq (KRI) Version 1.0 August 2017 Preface This note provides country of origin information (COI) and policy guidance to Home Office decision makers on handling particular types of protection and human rights claims. This includes whether claims are likely to justify the granting of asylum, humanitarian protection or discretionary leave and whether – in the event of a claim being refused – it is likely to be certifiable as ‘clearly unfounded’ under s94 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. Decision makers must consider claims on an individual basis, taking into account the case specific facts and all relevant evidence, including: the policy guidance contained with this note; the available COI; any applicable caselaw; and the Home Office casework guidance in relation to relevant policies. Country Information COI in this note has been researched in accordance with principles set out in the Common EU [European Union] Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI) and the European Asylum Support Office’s research guidelines, Country of Origin Information report methodology, namely taking into account its relevance, reliability, accuracy, objectivity, currency, transparency and traceability. All information is carefully selected from generally reliable, publicly accessible sources or is information that can be made publicly available. Full publication details of supporting documentation are provided in footnotes. Multiple sourcing is normally used to ensure that the information is accurate, balanced and corroborated, and that a comprehensive and up-to-date picture at the time of publication is provided. Information is compared and contrasted, whenever possible, to provide a range of views and opinions. -
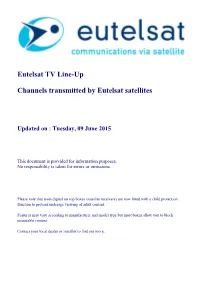
Linup Report
Eutelsat TV Line-Up Channels transmitted by Eutelsat satellites Updated on : Tuesday, 09 June 2015 This document is provided for information purposes. No responsibility is taken for errors or omissions. Please note that most digital set top boxes (satellite receivers) are now fitted with a child protection function to prevent underage viewing of adult content. Features may vary according to manufacturer and model type but most boxes allow you to block unsuitable content. Contact your local dealer or installer to find out more. Freq Beam Analo Diff Fec Symb Acces Lang g ol Rate EUTELSAT 117 WEST A 3.720 V C Edusat package DVB-S 3/4 27.000 C Telesecundaria TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C TV Docencia TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C ILCE Canal 13 TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C UnAD TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C ILCE Canal 15 TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Canal 22 Nacional TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Telebachillerato TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C ILCE Canal 18 TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Tele México TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C TV Universidad TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Red de las Artes TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Aprende TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Canal del Congreso TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Especiales TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C Transmisiones Especiales 27 TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish C TV UNAM TV DVB-S 3/4 27.000 Spanish 3.744 V C INE TV TV DVB-S2 3/4 2.665 Spanish 3.748 V C Radio Centro radio DVB-S 7/8 2.100 Spanish 3.768 V C Inti Network TV DVB-S2 3/4 4.800 Spanish 3.772 V C Gama TV TV DVB-S 3/4 3.515 BISS Spanish 3.786 V -

The Impact of New Technology on the News Production Process in the Newsroom
The impact of new technology on the news production process in the newsroom By Abdulsamad Zangana A DISSERTATION Submitted to The University of Liverpool In partial fulfilment of the requirements for the degree of DoCtor of Philosophy 2017 Abstract The change brought about by new teChnology in the television newsroom has beCome a key aspeCt of the development of the television industry in Iraqi- Kurdistan; since the newsroom has begun to adopt a new automated system, it has particularly shaped journalists’ practice and the method of news production within their workplace network. This change has led to the Creation of a new form of journalistic practice, particularly with regard to multi-skills, multi- media and multi-tasks within the newsroom network. Hence, these teChnologiCal Changes have provided the news practitioner with more opportunities to obtain a detailed understanding of their practiCes, interactions and actions. This researCh projeCt provides an ethnographiC aCCount of newsroom Culture and journalists’ practice using automation and non-automation systems (see, chapter two distinction) in two Kurdish news Channels in Iraqi-Kurdistan. It draws upon in-depth interviews with journalists; non-participant observation and ColleCted doCumentation related to the research questions. The current research project is based upon two models: One is Community of Practice (COP)(see chapter 3), developed by Etienne Wenger (1998) and Jean Lave (1991). The COP approach provides a focus on subjects related to the workplace Culture, mutual engagement, identity of the members, shared history of learning, exchange of information, experience and shared knowledge. The other is the Actor-Network Theory (ANT) (Bruno Latour, 1992. -

A Study of the Implementation of the Constitution and the Quality of Governance in Kurdistan
A Study of the Implementation of the Constitution and the Quality of Governance in Kurdistan Salih Fatah A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Liverpool John Moores University for the degree of Doctor of Philosophy June 2016 i Declaration/Statements Declaration This work has not previously been accepted in substance for any degree and is not being concurrently submitted in candidature for any degree. Salih Fatah Signed: Date: 06/ 06 /2016 Statements The thesis is the result of my own investigations, except where otherwise stated. Other sources are acknowledged by footnotes giving explicit references. A bibliography is included. I hereby give consent for my thesis, if accepted, to be available for photocopying and for inter-library loan, and for the title and summary to be made available to outside organisations. Salih Fatah Signed: Date: 06/ 06 /2016 ii iii Abstract As the first study focusing on the implementation of the constitutions and quality of government (QoG) in Kurdistan from a practical point of view, this thesis examines the question why the Kurdistan Regional Government (KRG) fails to deliver the constitutions in a way that strengthens its democracy and produces a good QoG. From analyses of the data gleaned from 41 semi-structured interviews the thesis identifies the main factors that affect the implementation of the constitutions and QoG with particular reference to the 2005 Iraqi constitution and the Kurdistan draft constitution of 2009. The study also outlines the reform process in the Kurdistan Region and explains how a system of political checks and balances in a democratic society can improve QoG and democracy. -

Imagined Kurds
IMAGINED KURDS: MEDIA AND CONSTRUCTION OF KURDISH NATIONAL IDENTITY IN IRAQ A Thesis submitted to the faculty of San Francisco State University In partial fulfillment of the requirements for / \ 5 the Degree 3C Master of Arts In International Relations by Miles Theodore Popplewell San Francisco, California Fall 2017 Copyright by Miles Theodore Popplewell 2017 CERTIFICATION OF APPROVAL I certify that I have read Imagined Kurds by Miles Theodore Popplewell, and that in my opinion this work meets the criteria for approving a thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Arts in International Relations at San Francisco State University. Assistant Professor Amy Skonieczny, Ph.D. Associate Professor IMAGINED KURDS Miles Theodore Popplewell San Francisco, California 2017 This thesis is intended to answer the question of the rise and proliferation of Kurdish nationalism in Iraq by examining the construction of Kurdish national identity through the development and functioning of a mass media system in Iraqi Kurdistan. Following a modernist approach to the development and existence of Kurdish nationalism, this thesis is largely inspired by the work of Benedict Anderson, whose theory of nations as 'imagined communities' has significantly influenced the study of nationalism. Kurdish nationalism in Iraq, it will be argued, largely depended upon the development of a mass media culture through which political elites of Iraqi Kurdistan would utilize imagery, language, and narratives to develop a sense of national cohesion amongst their audiences. This thesis explores the various aspects of national construction through mass media in the Kurdistan Region of Iraq, in mediums such as literature, the internet, radio, and television. -

Reporting on Minorities Across Iraq INARABIC & KURDISHPRESS
Reporting on Minorities across Iraq INARABIC & KURDISHPRESS APRIL 2016 By the Institute of Regional and International Studies (IRIS) at the American University of Iraq, Sulaimani (AUIS) ACKNOWLEDGEMENTS This report was developed out of the collaboration of multiple actors and institutions. This report has been produced by the Institute of Regional and International Studies (IRIS) at the American University of Iraq, Sulaimani (AUIS) in They are listed below: partnership with Free Press Unlimited (FPU) and Author: Sarah Mathieu-Comtois, Institute of PAX for Peace. Regional and International Studies (IRIS) at the American University of Iraq, SulaImani (AUIS) Researchers: Amal Hussein Alwan, Haval Mustafa Muhamad, Muhammed Ahmed, and Aws Mohammed Taha Research facilitation and editing: Christine van This report has been produced with the financial den Toorn and Zeina Najjar, Institute of Regional assistance of the European Union. The contents and International Studies (IRIS) at the American of this report are the sole responsibility of the University of Iraq, Sulaimani (AUIS) authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the We would also like to make a special note of European Union. The report has been produced acknowledgement to Saad Salloum, Iraqi as part of a program entitled ‘We Are All Citizens’ academic and journalist specializing in Iraqi in Iraq. minorities and human rights and author of Minorities in Iraq (2013). TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY I RECOMMENDATIONS II INTRODUCTION 1 METHODOLOGY -

ATN Arabic TV Channels ATN Germany 5000 HD
ATN Arabic TV channels ATN Germany 5000 HD - Over 1200 Channels 1 Aljazeera 31 MBC Spor 2 61 CBC Drama 91 Hi TV 121 Afak tv 2 Alarabiya 32 MBC Spor 3 62 Al-Nahar Drama + 92 Aljadeed 122 Dijla Tv 3 Alarabiya Hadath 33 MBC Spor 4 63 Time Comedy 93 Mtv Lebanon 123 Al Shahid Classic 4 BBC Arabic 34 Fox Movies 64 Cairo TV 94 Al Aan TV 124 Aliraqiya News 5 Al-Mayadeen 35 Zee Aflam 65 Sout Al-Shaab 95 ANB 125 Al Iraqiya Tv 6 Al Alam - WNN 36 New Tv Music 66 Nile Cinema 96 NBN 126 Aliraqiya 2 7 Russia Alyaum 37 Cima 67 Nile Comedy 97 Top News 127 AlIraqiya Sport 8 STAR ACADEMY 38 Pro Action 68 Nile Drama 98 Citruss TV 128 Altaghier 24/24 9 Al-hurra Iraq 39 Al-Dafra tv HD 69 Nile Life 99 Syria News 129 Al-Fayha 10 Al-Hurra 40 Star Cinema 1 70 Nile Family 100 Syria 130 Forat 11 Al Hurra Iraq 2 41 ART AFLAM 1 71 Nile Culture 101 Syria Drama 131 Press Tv 12 CNBC Arabia 42 ART AFLAM 2 72 Nile News 102 Talaqe Syria 132 Waar Tv 13 Sky News Arabia 43 ART Cinema 73 Nile Sport 103 Addounia Tv 133 Waar Tv Sport 14 France24 Arabic 44 ART Hekayat 1 74 Alhayat 1 104 Sama Syria 134 Waar HD 15 Aljazeera Doc 45 ART Hekayat 2 75 Alhayat 2 105 Noor Alsham 135 Beladi Tv 16 National Geographic 46 Rotana Cinema 76 Alhayat Cinema 106 Payam 136 Hadara TV HD 17 AlIraqiya Doc 47 Rotana Masriya 77 Modern Sport 107 Alsharqiya 137 Music Remas 18 Royal Secret 48 Rotana Clip 78 Dream 1 108 Alsharqiya News 138 Dubai Tv 19 ATN QURAN Tajwid 49 Rotana Khaligi 79 ONTV 109 Al Ezz 139 Dubai One 20 ATN Quran Eng 50 Rotana Music 80 Masria Esc 1 110 Alrafiden 140 Abu Dhabi 21 AlQuran