Naturparktrail „Schwalenberger Wald“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

This Informations Is from the Internet Pages of the Federal of Transport, Building and Urban Affairs
This informations is from the internet pages of the Federal of Transport, Building and Urban Affairs. Please read the disclaimer at http://www.bmvbs.de/artikel,- 939488/Website-publication.htm. – 124 – State: North Rhine-Westphalia First priority projects Con- Ser- FG inv. struc- Length Re- ial Road Title costs from FTIP no. tion (km) marks no. 2003 (€ m) type Ongoing and definitely planned projects 1 A 1 Lgr. NI/NW–AK Lotte/Osnabrück 46BB 4.5 24.6 2 A 1 AK Lotte/Osnabrück–AS Lengerich/Tecklenburg 46BB 11.1 33.7 NW5003 A 3 A 1 AS Lengerich/Tecklenburg–DEK-Brücke 46BB 11.6 23.2 NW5003 A 4 A 1 DEK Brücke–AS Münster/N 46BB 16.4 38.2 NW5003 A 5 A 1 AK Münster/S (2. Baustufe) 66BB 0.0 11.9 6 A 1 AS Münster/N–AK Münster/S (Baustufe 1.2) 46KB 9.9 30.2 A 7 A 1 T+R-Anlage Lichtendorf–AK Westhofen 46BB 6.4 11.0 8 A 1 AK Westhofen–AS Hagen/N 46BB 5.6 85.1 9 A 1 AS Gevelsberg–AS Wuppertal/Langerfeld 46BB 10.3 10.7 10 A 1 AS WU/Langerfeld–Blombachtal 46KB 5.5 94.2 11 A 1 AS Wuppertal/Ronsdorf–AS Remscheid 46KB 5.1 5.3 12 A 1 AS Remscheid–T+R-Anlage Remscheid 46BB 2.9 33.9 13 A 1 T+R-Anlage Remscheid–AS Wermelskirchen 46KB 4.3 48.6 14 A 1 AK Leverkusen–AK Köln/N 46BB 10.0 14.0 15 A 1 AK Köln/N–DB-Strecke Köln–Aachen 46BB 7.3 81.5 16 A 2 Bereich AK Kamen 46BB 2.6 35.7 17 A 2 AK Kamen–O AK Kamen 46BB 3.3 13.9 A 18 A 2 O AK Kamen–AS Hamm 46BB 5.9 28.8 19 A 2 AS Hamm–T+R-Anlage Hamm/Rhynern 46BB 4.0 23.9 A 20 A 2 Hamm–AS Hamm/Uentrop 46BB 8.1 28.8 A 21 A 2 W AS Hamm/Uentrop–O AS Hamm/Uentrop 46BB 3.4 2.3 22 A 2 AS Hamm/Uentrop–AS Beckum 46BB 6.5 26.7 A -

Erfolgreiche Gesellenprüflinge 2021
ERFOLGREICHE GESELLENPRÜFLINGE 2021 INNUNG BERUF VORNAME NAME ORT BETRIEB Bäcker- und Konditoren-Innung Lippe Bäcker/-in Birte Astler Detmold bpr backwaren gmbH Sophie Gronemeier Lemgo Vollkorn- und Bio-Bäckerei Meffert GmbH Sojib Matubber Lage Udo Fellmer Alexandra Justine Möhle Extertal Bäckerei-Konditorei Dreimann GmbH & Co.KG Vivien Wolf Lemgo Pyka GmbH & Co. KG Mahmoud Alhour Hörnum Jan Mellies Fachpraktiker/-in im Lebensmittelverkauf FR: Bäckerei Jasmin Polat Detmold Nestor Bildungsinstitut GmbH Lisa Marie Schwarz Lage Nestor Bildungsinstitut GmbH Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk FR: Bäckerei Marie Christin Bachner Extertal Oliver Güttge Elis Marie Danowez Lemgo Oliver Güttge Jennifer Erdmann Lage Bäckerei & Conditorei Hensel GmbH Mirijaha Erdmann Extertal Thomas Fröbrich Viktoria-Jasmin Gross Lage Brinkmann's Backstube GmbH & Co. KG Gjeneta Krasniq Blomberg Bäckerei Engel GmbH & Co. KG Isabel Meinhold Lage Ulf Thierling Evelyn Rein Detmold Bäckerei Engel GmbH & Co. KG Mireille Shireen Scheibe Lage Karlchen´s OWL Vertriebsgesellschaft mbH Bau-Innung Lippe Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Christian Fahnenschmidt Schloß Holte-Stukenbrock Lücke & Hübner Fliesen Bau GmbH Tarik Hadzic Horn-Bad Meinberg Fliesen Rebbe OHG Dejan Radic Lage Niko Radic Hochbaufachwerker/-in Jordan Luca Spors Lage Nestor Bildungsinstitut GmbH Maurer/-in Bennet Bachler Bielefeld Kronshage Baugesellschaft mbH Luis Noah Balzereit Schloß Holte-Stukenbrock E. Weege Hochbau GmbH Dijwar Güngör Horn-Bad Meinberg Sven Koch Jesper Christian Hansen Blomberg Jürgen Mengedoht Tim Klippenstein Barntrup Klippenstein & Kryker GmbH & Co. KG Eric Klippenstein Barntrup Klippenstein & Kryker GmbH & Co. KG Ali Mussawi Bad Salzuflen Baubetrieb Andreas Kramp GmbH & Co. KG Alexander Nickel Bad Salzuflen Alexander Schulz Maksym Osypenko Horn-Bad Meinberg Sven Koch André Pitt Lemgo Bauunternehmen Brennert GmbH & Co. -

Fahrtziele Und Preise Lippe Mit Dem Westfalentarif
Kreuz und quer durch Westfalen- Fahrtziele und Preise Lippe mit dem WestfalenTarif. mit Start Schieder-Schwalenberg Osnabrück Schieder-Schwalenberg 1LI Lage (Lippe) über Blomberg 4T Bielefeld Altenbeken 4T Lemgo Münster 4T Schieder über Blomberg (nicht über Altenbeken) Augustdorf 4T Schwalenberg Hamm Paderborn über Altenbeken 6T Leopoldshöhe 4T über Blomberg (nicht über Altenbeken) Dortmund Bad Oeynhausen 6T Löhne 6T Bad Pyrmont* 3T Lügde 2T Bad Salzuflen 4T Minden 7T Siegen über Altenbeken 6T über Paderborn 10W Barntrup 4T Münster 10W Bielefeld über Blomberg 6T Oerlinghausen Einfach Ticket kaufen, einsteigen und los geht’s! Das über Paderborn 8W 4T über Blomberg (nicht über Altenbeken) Tolle dabei: Sie fahren mit nur einem Ticket – und Blomberg 3T Osnabrück nicht über Steinheim 10W das gilt für Bus, Bahn (RE/RB) und StadtBahn. Der Bünde/Westf. 7T Fahrpreis ist abhängig von Ihrem Start- und Ziel ort. Paderborn 5W Suchen Sie Ihr Ziel in der links stehenden Tabelle, Detmold 4T Porta Westfalica 7T merken Sie sich Ihre Preisstufe (z. B. 3T) und wählen über Altenbeken Sie das gewünschte Ticket in der Preistabelle. Ihr 5T Rheda-Wiedenbrück (nicht über PB) 7T Ziel oder Ihr Ticket ist nicht dabei? In der Fahrplan- Dortmund 10W Schlangen 4T auskunft unter www.TeutoOWL.de/fahrplanauskunft Dörentrup 4T Schloß Holte-Stukenbrock 6T werden Sie fündig. Enger (nicht über Paderborn) 7T über Paderborn 7W Extertal 4T Siegen 10W Erklärung zur Tabelle Gütersloh 7T Steinhagen (nicht über Paderborn) 7T „Tickets und Preise“ über Paderborn 9W Steinheim 3T 1 Nehmen Sie ganztägig bis zu 3 Kinder (6-14 Jahre) oder Fahr- räder auf Ihrem Ticket mit. -

Barntrup Fahrtziele Und Preise Erklärung Zur
Kreuz und quer durch Westfalen- Fahrtziele und Preise Lippe mit dem WestfalenTarif. mit Start Barntrup Osnabrück Barntrup KLI Lemgo 3T Bielefeld Barntrup 1LI Leopoldshöhe 4T Münster Barntrup Löhne 6T Hamm Paderborn Altenbeken 6T Lügde 4T Dortmund Augustdorf 4T Marienmünster 6W Bad Oeynhausen 6T Minden 7T Bad Pyrmont* 3T Münster 11W Siegen Bad Salzuflen 4T Nieheim über Steinheim 6W Bielefeld 6T Oerlinghausen 4T Blomberg 2T Osnabrück 11W Einfach Ticket kaufen, einsteigen und los geht’s! Das Tolle dabei: Sie fahren mit nur einem Ticket – und Brilon über Paderborn 10W Paderborn 7W das gilt für Bus, Bahn (RE/RB) und StadtBahn. Der Bünde/Westf. 6T Porta Westfalica 6T Fahrpreis ist abhängig von Ihrem Start- und Ziel ort. Suchen Sie Ihr Ziel in der links stehenden Tabelle, Cammer* 7T Rahden 7T merken Sie sich Ihre Preisstufe (z. B. 3T) und wählen Coesfeld 11W Rheda-Wiedenbrück 7T Sie das gewünschte Ticket in der Preistabelle. Ihr Ziel oder Ihr Ticket ist nicht dabei? In der Fahrplan- Detmold 4T Rinteln** über Extertal 4T auskunft unter www.TeutoOWL.de/fahrplanauskunft Dörentrup 3T Schieder-Schwalenberg 4T werden Sie fündig. Dortmund 11W Schlangen 4T Extertal 3T Schloß Holte-Stukenbrock 6T Erklärung zur Tabelle Gütersloh 6T Steinheim 4T „Tickets und Preise“ 1 Nehmen Sie ganztägig bis zu 3 Kinder (6-14 Jahre) oder Fahrräder Halle/Westf. 6T Vlotho 6T auf Ihrem Ticket mit. Max. 1 Fahrrad pro Person. 2 Montags bis freitags ab 9 Uhr gültig; sams-, sonn- und feiertags ganztägig gültig. Hamm/Westf. 11W Willebadessen 9W 3 Ihr Ticket gilt für bis zu 5 Personen. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. -

"Wir in Lippe" Als
Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen! Rufen Sie uns an: Telefon 05231 911-155 16265201_800118 Eine Verlagsbeilage der Lippischen Landes-Zeitung 37212001_800118 &GVOQNF „Jazz four $CF 5CN\WHNGP Das Pickertschreiben des Ver- .ØIFG Beim Vergleichsschießen sind auf Einla- Fun“ in Jerxen-Orbke eins für Informationsverarbeitung lockt viele Teil- dung der Schützenbruderschaft St. Kilian ist gut angekommen. nehmer an. 22 Teams dabei gewesen. 5GKVG 5GKVG 5GKVG M<I<@E ;<I NF:?< 91.(5 91%*' F_eVchVXd Sportliche Lipper: Die Mon- DTYÛ_V 6Z_deZ^^f_X RfW URd 7Vde tagsturnerinnen des FC Z^ ?R^V_ UVd Augustdorf halten sich seit KiX[`k`fe1 Der Gospelchor Stapelage ist mit seinen „Songs for Christmas“ bei drei Konzerten 40 Jahren fit, das Frauen- in Lippe zu erleben. Die Leitung liegt wieder in den bewährten Händen von Prof. Rainer Weber DZ_eVc\]RRd Fußballteam der SG Alver- dissen/Extertal freut sich Blomberg (sb). 1965 hatte er nicht nur über die Herbst- seinenerstenAuftrittinderNel- meisterschaft, sondern auch kenstadt,derheiligeBischofSint über neue Trikots – und die Nicolaas. In Begleitung seiner ZwartenPietenbesuchteerfort- Cheerleader des TSV Bö- an jedes Jahr die Kinder der in singfeld verbuchen ebenso Blomberg stationierten nieder- schöne Erfolge wie die Kara- ländischen Soldaten. Später teka des Dojo-Vereins aus dann, als die Soldaten Mitte der Bad Salzuflen. Das und viele 90er Jahre Deutschland verlie- weitere Berichte lesen Sie, ßen, drohte eine lieb gewonne- liebe Leser, auf insgesamt neTraditionzusterben–bissich 1997 der Heimatverein Sint Ni- zwölf Seiten dieser Ausgabe colaas gründete. von „Wir in Lippe“. Viel Rund die Hälfte der 60 Mit- Vergnügen dabei. glieder – in Blomberg gebliebe- ne Niederländer und ihre deut- .KRRKUEJG )TØ»G schen Freunde – kümmert sich heute aktiv darum, dass Sint Ni- +JT 9QNH 5EJGT\GT colaas nach wie vor am Samstag vor dem ersten Advent in einer Pferdekutsche, flankiert von zahlreichen Zwarten Pieten, in DeZ^^f_Xdg`]]+ Die Weihnachtskonzerte mit dem Frauenchor „Inspiration“ und dem Männerchor „Voices of Confidence“ haben Tradition. -

RE 82 FAHRPLAN 2020 / 2021 Ticketkauf & Tarifhinweise Ankunft
MONTAG - FREITAG Zug-Nummer 79340 79342 79344 79346 79348 79350 79352 79354 79356 79358 79360 79362 79364 79366 79368 RB 73 RB 73 RB 73 RB 73 Ankunft und Anschlüsse Bielefeld Hbf ab 06:30 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:15 22:15 23:15 00:15 Bielefeld Ost | | | | | | | | | | | | | | 21:19 22:19 23:19 00:19 über Oldentrup | | | | | | | | | | | | | | 21:22 22:22 23:22 00:22 Bielefeld Hbf :49 :36 aus Minden RE 70 Herford Ubbedissen | | | | | | | | | | | | | | 21:27 22:27 23:27 00:27 :32 aus Hamm RB 69 (siehe Bielefeld Ost Oerlinghausen an 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:29 22:29 23:29 00:29 Kasten Oerlinghausen ab 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 21:32 22:32 23:32 00:32 Oldentrup rechts Helpup unten) | | | | | | | | | | | | | | 21:36 22:36 23:36 00:36 Ubbedissen Ehlenbruch | | | | | | | | | | | | | | 21:39 22:39 23:39 00:39 Oerlinghausen :59 Lage (Lippe) an 07:05 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 21:44 22:44 23:44 00:44 Zug-Nummer 79340 79342 79344 79346 79348 79350 79352 79354 79356 79358 79360 79362 79364 79366 79368 RB 72 RB 72 RB 72 79370 Helpup Lage (Lippe) ab 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 21:52 22:52 23:55 00:50 Ehlenbruch Detmold an 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 21:58 22:58 00:01 00:56 Detmold ab 07:20 09:20 -
Detmold A-Z 03.2017 ES Web.Pdf
Informationen von A-Z Detmold A-Z Kulturstadt im Teutoburger Wald Allgemeine Informationen Inhaltsverzeichnis ■ Allgemeine Informationen 2 – 5 ■ Detmold – Kulturstadt im Teutoburger Wald 6 – 7 ■ Geschichte – Zahlen und Persönlichkeiten 8 – 9 ■ Historische Altstadt 10 ■ Einkaufen und Gastronomie 11 – 13 ■ Wandern und Radfahren 14 – 15 ■ Stadtführungen und Lipperundfahrten 16 – 19 ■ Sehenswürdigkeiten 20 – 23 ■ Übersichtsplan Detmold 24 – 25 ■ Detmold von A-Z 26 – 41 ■ Touristische Einrichtungen in den Ortsteilen 42 – 43 ■ Ausflüge in die Region 44 – 46 Herausgeber: LTM GmbH, 32756 Detmold Gestaltung und Konzept: k-konzept, Agentur für Werbung Text: Iris Köllner ✝ / Vanessa Rubart Fotos: Tourist Information, Weymann, W. Peters (SchiederSee), Lippisches Landesmuseum, KulturTeam der Stadt Detmold Druck: K2 - Druck Keine Haftung bei Irrtümern und Fehlern. Stand 03/17; Änderungen möglich 2 Allgemeine Informationen Der Service der Tourist Information: • Information und Beratung über Urlaub und Tagungen • Zimmervermittlung und -buchung • Buchung von Pauschalangeboten • Gastgeberverzeichnis und andere Prospekte • Gruppenprogramme: Information, Beratung und Buchung • Stadtführungen und Lipperundfahrten • Wander- und Radwanderkarten, Literatur • Information über Veranstaltungen und Kartenvorverkauf • Souvenirshop Wir sind für Sie da: April – Oktober: Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr Sa 10.00 – 14.00 Uhr November – März: Mo – Fr 10.00 – 17.00 Uhr Adventssamstage 10.00 – 14.00 Uhr Hier finden Sie uns: Rathaus am Markt, Marktplatz/Ecke Lange Straße (Stadtzentrum); dort ist auch der Eingang. Von den Parkplätzen am Rande der historischen Altstadt und vom Bahnhof aus weisen Schilder den Weg. Vom P1/Lustgarten (Ausgang Richtung Rosental/Stadtzentrum) ist der Weg am einfachsten. Die nächste Bushaltestelle heißt „Rosental“. Unsere Anschrift: Tourist Information Lippe & Detmold Rathaus am Markt, 32756 Detmold Tel. -

Local Sustainability Compass Analysis of Sustainability Benefi Ts in Municipal Action and Projects
Local Sustainability Compass Analysis of Sustainability Benefi ts in Municipal Action and Projects A Case Study from Kreis Lippe Local Sustainability Compass ––– Analysis of Sustainability Benefits in Municipal Action and Projects A case study from Kreis Lippe This paper was presented by the Kreis Lippe and the University of Applied Sciences Bielefeld on the 2014 EGPA Annual Conference of the European Group of Public Administration – EGPA, held in Speyer, Germany, from 9th to 12th September 2014. www.egpa-conference-2014.org Cover graphic Karin Mohring Printed Kreis Lippe Bielefeld, Detmold, October 2014 Local Sustainability Compass – Analysis of Sustainability Benefits in Municipal Action and Projects Local Sustainability Compass – Analysis of Sustainability Benefits in Municipal Action and Projects Landrat Friedel Heuwinkel, level of management, there are the municipalities Detmold, Germany which have the closest contact with the population, (www.kreis-lippe.de/politik/landrat) which in terms of today’s influencers means that, in turn, they have the greatest impact on the possibilities Rechtsanwalt Hans-Georg Kluge, of the next generation. However, the goals of Agenda Berlin, Germany 21 were missed in many places because the actors (www.kluge-anwaltskanzlei.de) could not agree on how sustainable development was to be assessed and on what criteria the concept of Dr. Norbert Röttgen, MdB, sustainability should be based. It lacked a binding Berlin, Germany guiding principle, with the result that Agenda 21 (www.norbert-roettgen.de) lacked political traction and was unable to develop any real relevance in everyday life. Prof. Dr. Volker Wittberg, Bielefeld, Germany This work will be the first attempt to develop a (www.fh-mittelstand.de/csg) politically-legitimate set of criteria for sustainable development, as it has been discussed in the Lippe Thomas Wolf-Hegerbekermeier, district, with a method for assessing these criteria. -
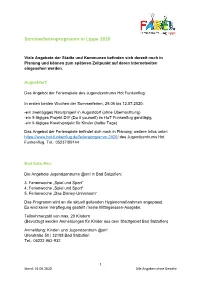
Sommerferienprogramm in Lippe 2020
Sommerferienprogramm in Lippe 2020 Viele Angebote der Städte und Kommunen befinden sich derzeit noch in Planung und können zum späteren Zeitpunkt auf deren Internetseiten eingesehen werden. Augustdorf: Das Angebot der Ferienspiele des Jugendzentrums Hot Funkenflug: In ersten beiden Wochen der Sommerferien, 29.06 bis 12.07.2020: -ein zweitägiges Naturprojekt in Augustdorf (ohne Übernachtung) -ein 5-tägiges Projekt DIY (Do it yourself) im HoT Funkenflug ganztägig, -ein 5-tägiges Kreativprojekt für Kinder (halbe Tage) Das Angebot der Ferienspiele befindet sich noch in Planung, weitere Infos unter: https://www.hot-funkenflug.de/ferienprogramm-2020/ des Jugendzentrums Hot Funkenflug, Tel.: 05237/89144 Bad Salzuflen: Die Angebote Jugendzentrums @on! in Bad Salzuflen: 3. Ferienwoche „Spiel und Sport“ 4. Ferienwoche „Spiel und Sport“ 5. Ferienwoche „Das Disney-Universum“ Das Programm wird an die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen angepasst. Es wird keine Verpflegung gestellt / keine Mittagsessen-Ausgabe. Teilnehmerzahl von max. 20 Kindern (Bevorzugt werden Anmeldungen für Kinder aus dem Stadtgebiet Bad Salzuflen) Anmeldung: Kinder- und Jugendzentrum @on! Uferstraße 50 | 32108 Bad Salzuflen Tel.: 05222 952-932 1 Stand: 01.06.2020 Alle Angaben ohne Gewähr Barntrup: Die Ferienspiele in Barntrup befinden sich noch in Planung. Weitere Infos voraus-sichtlich ab dem 15.06.2020 unter: http://www.kommev.org/index.php/aktuelles oder telefonisch Komm e.V., Kellerstr. 2, 32683 Barntrup, Tel.: 05263/3900 Blomberg: Die Ferienspiele des Jugendzentrums Blomberg -

RE 82 FAHRPLAN 2019 / 2020 Ticketkauf & Tarifhinweise Ankunft
MONTAG - FREITAG Zug-Nummer 79340 79342 79344 79346 79348 79350 79352 79354 79356 79358 79360 79362 79364 79366 79368 RB 73 RB 73 RB 73 79370 Ankunft und Anschlüsse Bielefeld Hbf ab 06:30 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:15 22:15 23:15 00:15 Bielefeld Ost | | | | | | | | | | | | | | 21:19 22:19 23:19 00:19 Oldentrup über | | | | | | | | | | | | | | 21:22 22:22 23:22 00:22 Bielefeld Hbf :49 :36 aus Minden RE 70 :32 aus Hamm RB 69 Ubbedissen Herford | | | | | | | | | | | | | | 21:27 22:27 23:27 00:27 Bielefeld Ost Oerlinghausen an (siehe 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:29 22:29 23:29 00:29 Oerlinghausen ab Kasten 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 21:32 22:32 23:32 00:32 Oldentrup Helpup rechts) | | | | | | | | | | | | | | 21:36 22:36 23:36 00:36 Ubbedissen Ehlenbruch | | | | | | | | | | | | | | 21:39 22:39 23:39 00:39 Oerlinghausen :59 Lage (Lippe) an 07:05 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 21:44 22:44 23:44 00:44 Zug-Nummer 79340 79342 79344 79346 79348 79350 79352 79354 79356 79358 79360 79362 79364 79366 79368 RB 72 RB 72 RB 72 79370 Helpup Lage (Lippe) ab 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 21:52 22:52 23:55 00:50 Ehlenbruch Detmold an 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 21:58 22:58 00:01 00:56 Detmold ab 07:20 09:20 10:20 -

Auf Qualitätswanderwegen Durch Lippe
Wanderplaner Tagestouren Auspacken und Anpacken. Entschleunigung und gleichzeitig Aktion in der herrlichen lichtmuseum gegen Pfand einen Rucksack ausleihen, Natur schließen sich bei dieser Wanderung nicht aus! in dem sich kleine Überraschungen für Zwischendurch Mit dem aktiven Rucksack geht es zurück in die Stein- befinden. Materialien zum Bau eines Steinzeitmessers, zeit. Es wird eine Reise, die uns zu den Anfängen der ein Würfelspiel aus Schafsfußknochen oder Utensilien Zivilisation führt. Und wie könnte besser gelernt werden, zum Getreidemahlen. Hier wird auf spielerische Art die als durch erleben und gemeinsames Tun. Diese Tour ist alte Zeit wieder erlebbar gemacht. abwechselnd, spannend und zugleich lehrreich. So wird Vergangenes wieder zum Leben erweckt und spielerisch vermittelt, wie unsere Vorfahren damals ge- Oerlinghausen ist reich gesegnet mit archäologischen lebt und gearbeitet haben. Fundstellen. Ausgerüstet mit einem Archäologieruck- Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre sackAuf geht es Qualitätswanderwegenauf eine Tour, die für jede Familie gut zu bewältigen ist und auf der Kinder durch anregende Mitmachaktionen bei Laune gehalten werden. Jede Gruppedurch und Familie Lippe kann sich im Archäologischen - Land Frei- des Hermann die Route online Natur aktiv erleben im Teutoburger Wald www.teutonavigator.de Startadresse: 450 300 Donoperteich 1, 32760 Detmold 150 0 Parkplatz „Donoper Teich“ Parkplatz „Forstfrieden“ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Parkplatz „Parkplatz Waldfriedhof“ Länge 18.9 km 308 m Dauer 4:45 h 125 m 1 Inhaltsverzeichnis Ein perfekter Wandertag – Ein perfekter Wandertag – Direkt informieren und buchen: auf kurzen Qualitätswanderwegen durch das Land des Hermann! durch das Land des Hermann! S. 3 Tourist-Information Lippe & Detmold Qualitätswanderregion Lippe – Lippe Tourismus & Marketing GmbH Land des Hermann Rathaus am Markt, 32756 Detmold - traumtour S. -

Teil Iia - Zone 1: Ordnen Sie Nur Die 10 Markierten Ortsteile Der Jeweiligen Stadt/Gemeinde Zu !
Teil IIa - Zone 1: Ordnen Sie nur die 10 markierten Ortsteile der jeweiligen Stadt/Gemeinde zu ! Auswahl Name des Ortsteils Bad Salzuflen Lage Leopoldshöhe Oerlinghausen Wüsten Lipperreihe Asemissen Heiden Werl-Aspe Menkhausen Heßloh Retzen Greste Kachtenhausen Nienhagen Lockhausen Wellenbruch Ohrsen Schuckenbaum Wülfer-Bexten Wistinghausen Helpup Bechterdissen maximal erreichbare Punktzahl 10 richtige Antworten abzüglich falsche Antworten Endergebnis Mindestpunktzahl 7 Teil IIb - Zone 1: Beschreiben Sie auf den beigefügten Blättern nur die 10 markierten Fahrtstrecken ! Hinweis: Es ist die kürzeste Verbindung zwischen Abfahrtsort und Zielort zu beschreiben. Dabei sind innerhalb der Städte die zu befahrenden Straßen der Reihe nach zu nennen. Die Strecke zwischen Stadtteilen oder Städten ist durch die Nennung der Straße und gegebenenfalls der Ortsteile (z.B. „auf der B 239 durch Y bis X fahren“) ausreichend beschrieben. Beispiellösung: Abfahrtsort: Detmold, Kaufland Zielort: Leopoldshöhe-Asemissen, Bahnhof Lösung: Detmold-Kaufland, Nordring bis Lagesche Straße, rechts auf die B 239 Richtung Lage bis Ellernkrug, links in die Pivitsheider Straße, am Kohlpott rechts in die Bielefelder Straße in Richtung Augustdorf, in Pivitsheide V.L rechts in den Hellweg, L 945 bis Lage-Kachtenhausen, an der Ampel links auf die B 66 Richtung Bielefeld, auf der B 66 durch Helpup bis Asemissen, an der Ampel rechts in die Hauptstraße, links in die Bahnhofstraße, geschafft ! Bewertung: Pro Fahrtstrecke sind maximal 5 Punkte erreichbar. Abzüge werden für Umwege,