Völkische Verbindungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Völkische Verbindungen. Wien, 2009
Völkische Verbindungen Beiträge zum deutschnationalen Korporationsunwesen in Österreich Impressum (ERAUSGEBERIN (OCHSCH~LER)NNENSCHAFT AN DER 5NIVERSITiT 7IEN 3PITALGASSE (OF 7IEN \ 'RAFIKEN /LIVIA +AISER \ ,AYOUT 4ANJA *ENNI \ ,EKTORAT +ARIN ,EDERER \ $RUCKEREI 0AUL 'ERIN 7IEN \ *UNI \ )3". 4 Vorwort )NHALTSVERZEICHNIS 'RUPPE AuA!: Auf allen Ebenen, mit allen Mitteln. Der Versuch einleitender Worte 6ERKLiRUNGEN ¯ 'ESCHICHTE UND -YTHEN DER VyLKISCHEN +ORPORATIONEN (ERIBERT 3CHIEDEL Korporierte Legenden. Zur burschenschaftlichen Geschichtsumschreibung 6ERSTRICKUNGEN ¯ +ORPORIERTE IN 7IRTSCHAFT 'ESELLSCHAFT UND 0OLITIK -ATTHIAS ,UNZNIG Von Treue und Verrat, Bannflüchen und Vernichtungsstößen Das Verhältnis von FPÖ und völkischen Verbindungen: Eine Wagneriade 'RUPPE AuA!: Braune Burschen Die Geschichte des österreichischen Rechtsextremismus und Neonazismus ist nicht zuletzt auch eine Geschichte der völkischen Korporationen. 'LORIA 'LITTER Ein Burschi kommt selten allein ... Deutschnationale Männerbünde als Karriereschmiede 6EREINDEUTIGUNG ¯ +ORPORATION UND 'ESCHLECHT (ERIBERT 3CHIEDEL 3OPHIE 7OLLNER Phobie und Germanomanie Funktionen des Männerbundes -ARIA 'REKOVA: Refusing to be a Männerbund Zum Verhältnis des Männerbundbegriffs zu linksradikaler Kritik und Praxis ,EELA 3TEIN „... der couleurstudentischen Tradition verpflichtet, ... nach den Bedürfnissen einer Damenverbindung gestaltet“ Teutsche Mädels in Österreich 6ERMiCHTNISSE ¯ 6yLKISCHES 6ERBINDUNGSWESEN UND 5NIVERSITiT +LAUS )LLMAYER $ANIEL 3CHUKOVITS &LORIAN -

Art Et Politique En Autriche
Art et politique en Autriche : l’impact des oeuvres d’Alfred Hrdlicka, de Friedenreich Hundertwasser, de Günter Brus et de Valie Export sur l’Autriche de la Seconde République Sylvie Freytag To cite this version: Sylvie Freytag. Art et politique en Autriche : l’impact des oeuvres d’Alfred Hrdlicka, de Friedenreich Hundertwasser, de Günter Brus et de Valie Export sur l’Autriche de la Seconde République. Art et histoire de l’art. Université de Strasbourg, 2017. Français. NNT : 2017STRAC007. tel-01697229 HAL Id: tel-01697229 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01697229 Submitted on 31 Jan 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE DE STRASBOURG ECOLE DOCTORALE DES HUMANITES ED 520 EQUIPE D’ACCUEIL EA 1341 Thèse de doctorat en Études germaniques présentée par Sylvie FREYTAG Art et politique en Autriche. L‘impact des oeuvres d’Alfred Hrdlicka, de Friedensreich Hundertwasser, de Günter Brus et de Valie Export sur l’Autriche de la Seconde République Soutenue le 9 juin 2017 Directeur de thèse : Madame Geneviève HUMBERT-KNITEL, Professeur des Universités, Université de Strasbourg, Faculté des Langues et Civilisations étrangères. Rapporteurs : Madame Françoise KNOPPER, Professeur des Universités, Université Toulouse Jean Jaurès, Faculté des Langues, Littératures et Civilisations étrangères. -

The Future Fund of the Republic of Austria Subsidizes Scientific And
The Future Fund of the Republic of Austria subsidizes scientific and pedagogical projects which foster tolerance and mutual understanding on the basis of a close examination of the sufferings caused by the Nazi regime on the territory of present-day Austria. Keeping alive the memory of the victims as a reminder for future generations is one of our main targets, as well as human rights education and the strengthening of democratic values. Beyond, you will find a list containing the English titles or brief summaries of all projects approved by the Future Fund since its establishment in 2006. For further information in German about the content, duration and leading institutions or persons of each project, please refer to the database (menu: “Projektdatenbank”) on our homepage http://www.zukunftsfonds-austria.at If you have further questions, please do not hesitate to contact us at [email protected] Project-Code P06-0001 brief summary Soviet Forced Labour Workers and their Lives after Liberation Project-Code P06-0002 brief summary Life histories of forced labour workers under the Nazi regime Project-Code P06-0003 brief summary Unbroken Will - USA - Tour 2006 (book presentations and oral history debates with Holocaust survivor Leopold Engleitner) Project-Code P06-0004 brief summary Heinrich Steinitz - Lawyer, Poet and Resistance Activist Project-Code P06-0006 brief summary Robert Quintilla: A Gaul in Danubia. Memoirs of a former French forced labourer Project-Code P06-0007 brief summary Symposium of the Jewish Museum Vilnius on their educational campaign against anti-Semitism and Austria's contribution to those efforts Project-Code P06-0008 brief summary Effective Mechanisms of Totalitarian Developments. -

Intelligence Gathering in Postwar Austria P
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis US-led stay behind networks in Austria A tale from the Cold War: shady deals, dubious loyalties, and underground arms caches. verfasst von / submitted by Lorenzo Cottica, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 805 degree program code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Globalgeschichte degree program as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Uni.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina.1” (Thinking ill of others is a sin, but it often turns out good guesses.) 1 One of the most famous aphorisms credited to Giulio Andreotti, [undated], cited from ilsole24ore.com. Link. II Acknowledgments First and foremost, I want to express my sincere gratitude to the supervisor of this project, Prof. Oliver Rathkolb who, aside from assisting me throughout the research process, also granted me access to his private archive of copied source-material. Almost a third of all primary sources on which this thesis is founded upon, were thereby sponsored by prof. Rathkolb. I likewise want to thank General Horst Pleiner, for granting me the possibility to conduct and record an interesting interview of over an hour, thereby enriching the research with his expert perspective. III Abstract After dealing with a handful of editorial notes in chapter one, in chapter two, the thesis moves on to a description of the technical and methodological elements of the research itself, such as the terminology used, a critique of the main sources and an overview of the current state of research in this particular field. -

Austria and the Holocaust: Coming to Terms with the Past?
UNIVERSITY of GLASGOW Austria and the Holocaust: Coming to Terms with the Past? Dr Robert Knight Loughborough University The Sixth University of Glasgow Holocaust Memorial Lecture 24 January 2006 © Robert Knight 1. First of all let me say what a great honour it is for me to be invited to deliver this lecture to you. Above all I would like to thank the Principal for his kind invitation and Professor Otto Hutter for putting me forward. As you know this is the sixth lecture in this series. Tonight I will at least aspire to the high standards my five distinguished predecessors have set in their instructive lectures, as well as touching on some of the issues they have rajsed. My subject - Austria and the Holocaust - may appear limited but, as should become clear, Austria and the actions of Austrians are hardly marginal to the terrible events we are discussing this evening. What do we mean by "coming to terms with the past"? The phrase is one current translation of the German term "Vergangenheitsbewaltigung" a composite noun comprising "Vergangenheit" ( = past) and "Bewaltigung" (=' coming to terms). It probably entered English as a direct translation of the German in the 1960s. However "coming to terms" is not the only available translation of "Bewaltigung" - alternative current translations include "tackling, confronting or facing up to." These translations suggest a basic tension within the phrase. To put it simply, they point in two different directions and this divergence is not trivial. "Coming to terms" suggests a process which, painful though it is, allows a loss, or a trauma to be got through, at least to the point that the person or persons who have suffered it can in some sense, continue or "move on." We commonly associate "terms" with conditions, boundaries or finishing points. -

The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria
P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 This page intentionally left blank P1: JZZ 0521856833pre CUNY200B/Art 0521856833 October 7, 2005 21:45 The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria This book argues that Germans and Austrians have dealt with the Nazi past very differently and that these differences have had important con- sequences for political culture and partisan politics in the two countries. Drawing on different literatures in political science, David Art builds a framework for understanding how public deliberation transforms the political environment in which it occurs. The book analyzes how public debates about the “lessons of history” created a culture of contrition in Germany that prevented a resurgent far right from consolidating itself in German politics after unification. By contrast, public debates in Austria nourished a culture of victimization that provided a hospitable environ- ment for the rise of right-wing populism. The argument is supported by evidence from nearly 200 semistructured interviews and an analysis of the German and Austrian print media over a twenty-year period. David Art is an assistant professor of political science at the College of the Holy Cross. He teaches courses in European politics, international relations, and globalization. He received his B.A. from Yale University and his Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology. His cur- rent research focuses on the development of right-wing populist parties in comparative and historical perspective. i P1: -

60 Jahre.Pdf
Inhalt ÖH und Demokratie 6 Geschichte der ÖH Vorgeschichte 8 1940er: Aufbau studentischer Demokratie 11 Kommentar: Günther Wiesinger 17 1950er: Soziale Lage und Studiengebühren 20 Kommentar: Heinz Fischer 25 1960er: Studierende zwischen Borodajkewycz und 26 „1968“ Kommentar: Gerfried Sperl 31 1970er: Demokratie und Mitbestimmung in der 32 Universität Kommentar: Ernst Streeruwitz 35 1980er: Neue soziale Bewegungen 36 Kommentar: Martin Margulies 39 1990er: Der Mensch zuerst 40 Kommentar: Agnes Berlakovic 43 2000er: Gegenreform an der Uni und linker Erdrutsch 44 in der ÖH Kommentar: Andrea Mautz & Anita Weinberger 51 Wahlergebnisse und Vorsitzende 52 Die Rolle der Sprache in einer Gesellschaft kann kaum überschätzt werden. Sie transportiert die Uni im Wandel der Zeit 55 jeweils vorherrschenden Werte und Normen. Wir denken in Worten, Sprache schafft somit unser Be- Feminismus und ÖH 60 wusstsein. Auch die Sprache unserer Gesellschaft transportiert die ihr inne liegenden Wertvorstel- Protest und Vertretung 68 lungen. Damit Frauen und Männer zu gleichen Teilen in unserem Bewusstsein vorkommen, haben Zukunft der ÖH Arbeit 72 wir diese Broschüre geschlechtergerecht formu- liert. Artikel von externen AutorInnen wurde in Chronologie 76 jener Form belassen, wie sie geschrieben wurden. Anhang 78 1946 bis 2006 :: 60 Jahre :: ÖH und Demokratie Zwischen Anspruch und Realität Geschichte der ÖH Vorgeschichte 1940er: Aufbau studen- m 19.11.1946 war es also so weit. Alle Studierenden in Österreich wählten zum ersten tischer Demokratie Kommentar: Wiesinger AMal ihre Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Mittlerweile jährt sich die Gründ- 1950er: Soziale Lage und ung der ÖH zum sechzigsten Mal. Anlass für uns kritisch Bilanz zu ziehen. Die Struktur der Studiengebühren Kommentar: Fischer ÖH ist weltweit einmalig, sie gilt als Vorzeigemodell einer studentischen Interessenvertre- 1960er: Studierende zwischen Borodajkewycz tung. -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation Chamäleons im Blätterwald. Die Wurzeln der ÖVP-ParteijournalistInnen in Austrofaschismus, Nationalsozialismus, Demokratie und Widerstand. Eine kollektivbiografische Analyse an den Beispielen „Wiener Tageszeitung“ und „Linzer Volksblatt“ 1945 bzw. 1947 bis 1955. Verfasserin Mag. Franziska Dzugan angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, Februar 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 301 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Fritz Hausjell DANKSAGUNG Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Fritz Hausjell, der mir stets beratend und hilfreich zur Seite stand. Des Weiteren danke ich Michaela Lindinger, die mir ihre unveröffentlichten Recherchen zur „Wiener Tageszeitung“ zur Verfügung gestellt hat. Auch den Zeitzeugen gebührt mein Dank: Karl Pisa, Hugo Portisch, Harry Slapnicka und Leo Strasser. Nicht zuletzt möchte ich mich bei meinem Freund, meinen Freundinnen und meiner Familie bedanken. Sie waren und sind mir stets eine wertvolle Unterstützung. INHALT ABKÜRZUNGEN EINLEITUNG 1. Definitionen .............................................................................................................. 1 1.1 POLITISCHE PARTEIEN ........................................................................ 1 1.2 PARTEIPRESSE ................................................................................... 2 1.2.1 DER UNTERGANG DER PARTEIPRESSE ........................................... 5 1.3 „STÄNDESTAAT“ -
Figuring Austria's Repressed Violence
Figuring Austria’s Repressed Violence: Artistic Labour of the Body in the Work of Elfriede Jelinek and VALIE EXPORT Rose-Anne Sophia Gush Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies The University of Leeds August 2018 ii The candidate confirms that the work submitted is her own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Rose-Anne Sophia Gush to be identified as Author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. iii Acknowledgments I am grateful to the University of Leeds for awarding me the 110 Anniversary Scholarship. This allowed me the financial freedom to undertake this research, without which it would not have been possible. I am sincerely grateful to Dr Gail Day and Dr Diane Morgan for their patience, encouragement and sharp insight. I would also like to thank Professor Griselda Pollock, Professor John Mowitt for their conversations; my Leeds colleagues Fiona Allen, Luisa Corna, and Gill Park, Tom Hastings and Sophie Jones with whom I organised the conference in 2017 Speak, body: Art, the Reproduction of Capital and the Reproduction of Life, a related collaboration. I would like to thank those at the Generali Foundation archive, which I managed to visit in 2015 before its two-year closure; the Women in German Network which awarded me the Zantop Travel Award, making possible the time that I spent in Vienna in 2016. -
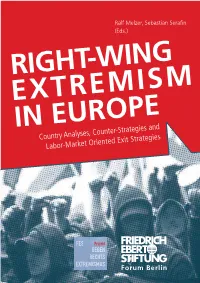
RIGHT-WING EXTREMISM in EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies
Ralf Melzer, Sebastian Serafi n (Eds.) RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies FES GEGEN RECHTS EXTREMISMUS Forum Berlin RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE I II RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies Imprint ISBN: 978-3-86498-522-5 Edited for: Friedrich-Ebert-Stiftung (Friedrich Ebert Foundation) by Ralf Melzer and Sebastian Serafi n Forum Berlin/Politischer Dialog “Project on Combatting Right-Wing Extremism” Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin Proofreading: Sandra Hinchman, Lewis Hinchman Translations: zappmedia GmbH, Berlin Photos: see page 464 Design: Pellens Kommunikationsdesign GmbH, Bonn Printing: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG Sontraer Straße 6, 60386 Frankfurt am Main Copyright 2013 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Projekt „Gegen Rechtsextremismus“, Forum Berlin Editors’ notes: The spelling, grammar, and other linguistic conventions in this volume refl ect American English usage. The judgments and opinions expressed in the articles collected for this book are those of the authors. They do not necessarily represent the views of the Friedrich Ebert Foundation or of the editors. In order to preserve the uniqueness and individuality of the contributions to this anthology, the editors have decided to retain divergent citation styles. This anthology was compiled as part of a project entitled “Confronting right-wing extremism by developing networks of exit-oriented assistance.” That project, in turn, is integral to the XENOS special program known as “exit to enter” which has received grants from both the German Federal Ministry of Labor and Social Affairs and the European Social Fund. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Erinnerungskonflikte im österreichischen Gedankenjahr 2005. Eine gedächtnisgeschichtliche Studie anhand ausgewählter Fallbeispiele“ Verfasserin Irene Maria Leitner angestrebter akademischer Titel Magistra der Philosophie (Mag.phil) Wien, im Dezember 2007 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 295 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Bertrand Perz Erinnerungskonflikte im Gedankenjahr 2005 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis.................................................................................... 1 Vorwort ..................................................................................................... 4 Einleitung.................................................................................................. 6 1 Theoretische Grundlagen ............................................................. 13 1.1 Memory Work ............................................................................ 13 1.2 Die hegemonietheoretisch - diskursanalytisch orientierte Gedächtnistheorie des transdisziplinären Forschungsprojektes „Transformationen gesellschaftlicher Erinnerung“..................... 20 2 „Land der Berge des Vergessen“: Österreichische Gedächtnisgeschichte von 1945 - 2005....................................... 26 2.1 „Double Speak“ im Nachkriegsösterreich .................................. 26 2.1.1 „Wir sind doch auf dem Standpunkt, daß wir etwas gemacht -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Kontinuitäten und Diskontinuitäten deutsch- nationaler katholischer Eliten im Zeitraum 1930 -1965“ Ihr Weg und Wandel in diesen Jahren am Beispiel Dr. Anton Böhms, Dr. Theodor Veiters und ihrer katholischen und politischen Netzwerke. Verfasserin Mag. Brigitte Behal Angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, im Jänner 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Hon. Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky 1 Für Peter in Zuneigung und Dankbarkeit 2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 7 Einleitung 9 1. Themenkreise und Fragestellungen 13 2. Gliederung der Arbeit 19 3. Methodischer Zugang 21 4. Quellen und Literatur 23 4.1 Ungedruckte Quellen 23 4.2 Gedruckte Quellen / Primärliteratur 26 4.3 Sekundärliteratur 28 4.4. Quellenkritik 29 I. Teil 30 Katholische, deutsch-national orientierte Intellektuelle in Österreich. Ihre Jugend im Spannungsfeld von Kirche, Republik, Ständestaat und Nationalsozialismus bis 1938. 1. Die Familien 33 Exkurs: Die Positionierung der katholischen Kirche und Klerus in der Zwischenkriegszeit 36 2. Sozialisation im Einflussbereich der Kirche 44 2.1 Die Katholische Aktion – eine kirchenpolitische Disziplinierungs- Maßnahme 44 Exkurs: Die Jugendbewegung 54 2.2. Jugendverbände und Schulen 60 3 Seite 2.2.1 Der Christlich-Deutsche Studentenbund 61 2.2..2 Das Feldkircher Jesuiten-Gymnasium „Stella Matutina“ 69 3. Die Universität Wien 73 3.1. Deutsch-nationale Universitätslehrer als Vorbilder 76 4. Die Haltung des deutschen Cartellverbandes zum Nationalsozialismus 84 5. „Berufung“ und Beruf zwischen Kirche und Staat bis zum „Anschluss“ 87 5.1. Anton Böhm zwischen katholischer „Mission“ und der Annäherung an das Dritte Reich 89 5.1.1. Böhms Wirken in „Neuland Bund katholischer Jugendbewegung in Österreich“, 1923 – 1938 91 5.1.2.