Inhaltsverzeichnis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

H Is to R Ič Ni S E M In
12 Jure Volčjak 12 Lilijana Žnidaršič Golec Irena Selišnik Gentiana Kera Mojca Žagar Karer Anja Benko Historični seminar Silvo Torkar 15 € Historični seminar 12 http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS12.pdf HISTORIČNI SEMINAR http://zalozba.zrc-sazu.si HS_12_OVITEK.indd 1 11. 04. 2016 12:34:21 Historični seminar 12 Uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer Ljubljana 2016 HS_12_konec.indd 1 11. 04. 2016 12:32:14 HISTORIČNI SEMINAR 12 Uredniški odbor Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer Znanstvena monografija je recenzirana. Uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer Jezikovni pregled slovenskih delov besedila Katarina Šter in Mojca Žagar Karer Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila Mitja Trojar Oblikovanje in prelom Brane Vidmar Založil Založba ZRC, ZRC SAZU Za založnika Oto Luthar Glavni urednik Aleš Pogačnik Tisk Collegium Graphicum, d. o. o. Naklada 150 Knjiga je prosto dostopna tudi v elektronski obliki (pdf), ISBN 978-961-254-902-2, COBISS.SI ID=284384512. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 930.1(082) 930.85(082) HISTORIČNI seminar 12 / uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer ; [prevod Mitja Trojar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 Dostopno tudi na: http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS12.pdf ISBN 978-961-254-901-5 1. Šter, Katarina 284384000 © 2016, Založba ZRC, ZRC SAZU Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oz. na kateri koli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta). -

Wintersemester 2005/06
UNIVERSITÄT WIEN PHILOLOGISCH-KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR SLAWISTIK INSTITUTSBERICHT FÜR DAS AKADEMISCHE JAHR 2015/2016 (Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 30.09.2016) zusammengestellt von Mag. Sylvia Richter im Auftrag von Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. h.c. Alois WOLDAN Institutsvorstand Juni 2017 Inhalt 1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ....................................................................................... 3 2. Lehre .................................................................................................................................. 5 2.1. HörerInnenstatistik ...................................................................................................... 5 2.1.1. HörerInnen WS 2015 ............................................................................................... 5 2.1.2. HörerInnen SoSe 2016 ............................................................................................. 5 2.2. Lehrveranstaltungen .................................................................................................... 5 2.2.1. Wintersemester 2015 ................................................................................................ 5 Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorprogramm ............................................................. 5 Lehrveranstaltungen aus dem Masterprogramm ................................................................ 7 Lehrveranstaltungen aus der Fachdidaktik ......................................................................... 8 2.2.2. -

Vienna As a Sculptural Centre in the Long Nineteenth Century Current Research on Sculpture in Central Europe
Vienna as a Sculptural Centre in the Long Nineteenth Century Current Research on Sculpture in Central Europe Ingeborg Schemper-Sparholz and Caroline Mang, eds. Abstract The Vienna Art Academy has always at- Still, the networks of sculptors in the capital tracted budding artists from all over the Em- and the crown lands during these decades pire, especially after the reform in 1872. Sim- have been not explored enough. This is not a ilarly, the School of Arts and Crafts in Vienna matter of purely art-historical questions; played an important role from its foundation rather, the national question plays an in 1867. It served as a model for such institu- important role. An international group of tions in the crown lands, including Zagreb, researchers is now tackling these connections, Budapest and Prague. At the same time, the a century after the collapse of the Austro- project of the Vienna Ringstraße, in which Hungarian Empire and decades after the end many professors from the academy were in- of the partial division of Europe by the Iron volved, offered the prospect of commissions. Curtain. RIHA Journal 0260 | 10 July 2021 DOI: https://doi.org/10.11588/riha.2021. 1 . 8 1885 RIHA Journal 0260 | 10 July 2021 [1] Und er ging nach Hause und ließ die Büste des Kaisers Franz Josef aus dem Keller holen, und er stellte sie auf, vor dem Eingang zu seinem Haus. Und vom nächsten Tage an – als hätte es keinen Krieg gegeben – als gäbe es keine neue polnische Republik – als ruhte der alte Kaiser nicht längst schon in der Kapuzinergruft – als gehörte dieses Dorf Lopatyny noch zu dem Gebiet der alten Monarchie: zog jeder Bauer, der des Weges vorbeizog, den Hut vor der sandsteinernen Büste des alten Kaisers. -
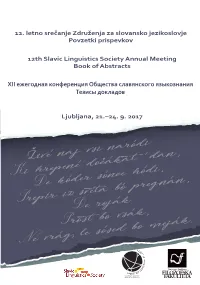
Zive Naj Vsi Narodi K I Hrepene Docakat Dan D E Koder Sonce Hodi P Repir I Z Sveta Bo Pregnan D E Rojak P Rost Bo Vsak N E Vrag
12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje Povzetki prispevkov 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting Book of Abstracts XII ежегодная конференция Общества славянского языкознания Тезисы докладов Ljubljana, 21.–24. 9. 2017 v / / Zive naj vsi narodi / / / K i hrepene docakatv dan , / / / D e koder sonce hodi , / / P repir/ iz sveta bo/ pregnan , / D e rojak / P rost bo vsak , / / / N e vrag, le sosed bo mejak. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje: Povzetki prispevkov 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting: Book of Abstracts XII ежегодная конференция Общества славянского языкознания: Тезисы докладов ISBN: 978-961-05-0027-8 Urednika / Editors / Редакторы: Luka Repanšek, Matej Šekli Recenzenti / Peer-reviewers / Рецензенты: Aleksandra Derganc, Marko Hladnik, Gašper Ilc, Zenaida Karavdić, Simona Kranjc, Domen Krvina, Nina Ledinek, Frančiška Lipovšek, Franc Marušič, Tatjana Marvin, Petra Mišmaš, Matic Pavlič, Анастасия Ильинична Плотникова / Anastasiia Plotnikova, Luka Repanšek, Михаил Николаевич Саенко / Mikhail Saenko, Дмитрий Владимирович Сичинава / Dmitri Sitchinava, Vera Smole, Mojca Smolej, Marko Snoj, Petra Stankovska, Andrej Stopar, Saška Štumberger, Hotimir Tivadar, Mitja Trojar, Mladen Uhlik, Mojca Žagar Karer, Rok Žaucer, Andreja Žele, Sašo Živanović Vodja konference / Conference leadership / Руководитель конференции: Matej Šekli Organizacijski odbor konference / Conference board / Оргкомитет конференции: Branka Kalenić Ramšak, Domen Krvina, Alenka Lap, Oto Luthar, Tatjana Marvin, Mojca -

Časopis Za Zgodovino in Narodopisje
• - •"•;' <ASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE NOVA VRSTA 6. (XLI.) LETNIK 1970 DRUGI ZVEZEK 1970 ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR I¿vle5ke prispevkov v tem =asopisu objavljata Historical Abstracts in America: History and Life Abstracts of ari idos in this journal are included in Historical Abstracts and America: History and Life N.i prednji strani platnic je fotografija reliefne plo££e erotov, najdene pri Bctnavl (Stanl;o Palile: Maribor v rimski Hobi, str. •2) Naslov uredništva CZN: Pedagoška akademija Maribor, Mladinska 9 Redakcija tega zvezka je bila kon=ana junija 1970 Za znanstveno vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji Stanko Pahi7 MARIBOR V RIMSKI DOBI V anti=ni dobi se položaj mariborskega prostora sicer ni bistveno spremenil v tistem smislu, da bi bilo tu nastalo novo enotno naselitveno središ=e, pa= pa v tem, da so nanj pri=ele delovati popolnoma nove geopoliti=ne silnice, ki so, izrazito usmerjane od zunaj, odlo=ilno vplivale na razvoj njegove poselitve. V vsem prazgodovinskem obdobju je bilo tod najzna=ilnejše gibanje ljudstev predvsem v vzhodno-zahodni smeri, zagatna lega ob Dravi in pomanjkanje pomembnejših poti v smeri sever—jug, ki bi bile s križiš=em mariborskemu kraju tako lego poživile. Vaške naselbine in zaselki prazgodovinskih prebivalcev se tod niso nikjer odlo=ilno osredoto=ili v obsežnejšo naselitveno skupnost z lastnim kulturnim izžarevanjem, temve= so se nevezano nizali po obrobjih reke. Težiš=e naselitve je bilo bolj ali manj izrazito prej na južnem kot na severnem bregu Drave, v železni dobi pa je na južni strani v glavnem tudi edino obsta- jalo. Kar je bilo kulturnih vplivov, prispelih semkaj s priseljenimi ljudstvi ali iz sosednjih središ= ter po trgovski poti, so se razpršili v partikularizmu lokalne naselitve, ali pa se nam danes ob dosedanjih najdbah samo tako zdi.1 Po prihodu Rimljanov je tako postal mariborski prostor prvi= izrazito in =vrsto — z upravo, gospodarstvom in kulturo — povezan z južno rimsko civi- lizacijo, kar je vplivalo tudi na družbeno sestavo njegovih prebivalcev. -

Slovenian Translations of Pushkin's Poetry and Prose
SLOVENIAN TRANSLATIONS OF PUSHKIN'S POETRY AND PROSE ( 1853 - 1901 ) by DRAGAN MARIJAN CERNETIC B. A., University of British Columbia, 1963 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS In the Department of Slavonic Studies We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April, 1968 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and Study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by h ils representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of SLAVONIC STUDIES The University of British Columbia Vancouver 8, Canada Date April 29th 1968 ABSTRACT The purpose of this study is to present in a concise form information concerning the extent and quality of Slovenian translations of Pushkin's poetry and prose. The author has investigated as fully as possible the renderings of all the known Slovenian translators of Pushki who were active during the second half of the nineteenth century. Particular attention has been focused on the authorship of the published translations, collection of full bibliographical data and evaluation of the quality of the Slovenian renderings. A brief survey of the contents of the chapters will show broadly how the author has approached this task. -

Zgodovinski Časopis - Letnik 49, Leto 1995, Številka 3 (100)
GODOVINSKI ČASOPIS HISTORICAL REVIEW ZVEZEK ZČ, Ljul i, številka 3 (100), strani 337-514 in IX-XIV UDC 949.712(05) ZGODOVINSKI UDK ČASOPIS ORICAL RLVIEW- ISSN 0350-5774 GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE Uredniški odbor: dr. Vasilij Melik (glavni in odgovorni urednik) Janez Stergar (namestnik glavnega urednika) Nataša Stergar (tehnični urednik) dr. Miro Stiplovšek dr. Peter Štih Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovo ljenjem uredništva in navedbo vira. Redakcija tega zvezka je bila zaključena 30.9.1995. Izdajateljski svet: dr. Milica Kacin-Wohinz, Zdravko Klanjšček, dr. Jože Koropec, Samo Kristen, dr. Vasilij Melik, dr. Darja Mihelič, dr. Janko Pleterski, Janez Stergar, Prvenka Turk Prevodi: Niko Hudelja, Vlado Valenčič in Katja Sturm-Schnabl (nemščina), Lidija Berden (angleščina), Jožica Pire (italijanščina) Zunanja oprema: Neta Zwitter Sedež uredništva in uprave: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, SI-1000 Ljubljana, Aškerčeva 2/1, tel.: (061) 17-69-210 Letna naročnina: za nečlane in ustanove 3900 SIT, za društvene člane 2700 SIT, za društvene člane- upokojence 2000 SIT, za društvene člane-študente 1350 SIT (vse za leto 1995) Cena tega zvezka v prosti prodaji je 1080 SIT Tekoči račun: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 50101-678-49040 Naročnina za tujino znaša za ustanove 80 DEM, za posameznike 55 DEM in za študente 35 DEM (ali ekvivalent v nacionalni valuti). Plačuje se na račun Zveze zgodovinskih društev Slovenije pri Novi Ljubljanski banki: 50100-620-133-27620-10295/4 Sofinancirajo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani Znanstveno-raziskovalni center SAZU Tisk: Tiskarna Slovenija, Ljubljana, november 1995 Naklada: 2000 izvodov Po mnenju Ministrstva za kulturo Republike Slovenije št. -
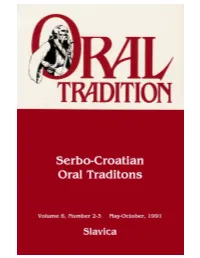
Complete Issue
_____________________________________________________________ Volume 6 May-October 1991 Number 2-3 _____________________________________________________________ Editor Editorial Assistants John Miles Foley David Henderson J. Chris Womack Whitney A. Womack Slavica Publishers, Inc. For a complete catalog of books from Slavica, with prices and ordering information, write to: Slavica Publishers, Inc. P.O. Box 14388 Columbus, Ohio 43214 ISSN: 0883-5365 Each contribution copyright (c) 1991 by its author. All rights reserved. The editor and the publisher assume no responsibility for statements of fact or opinion by the authors. Oral Tradition seeks to provide a comparative and interdisciplinary focus for studies in oral literature and related fields by publishing research and scholarship on the creation, transmission, and interpretation of all forms of oral traditional expression. As well as essays treating certifiably oral traditions, OT presents investigations of the relationships between oral and written traditions, as well as brief accounts of important fieldwork, a Symposium section (in which scholars may reply at some length to prior essays), review articles, occasional transcriptions and translations of oral texts, a digest of work in progress, and a regular column for notices of conferences and other matters of interest. In addition, occasional issues will include an ongoing annotated bibliography of relevant research and the annual Albert Lord and Milman Parry Lectures on Oral Tradition. OT welcomes contributions on all oral literatures, on all literatures directly influenced by oral traditions, and on non-literary oral traditions. Submissions must follow the list-of reference format (style sheet available on request) and must be accompanied by a stamped, self-addressed envelope for return or for mailing of proofs; all quotations of primary materials must be made in the original language(s) with following English translations. -

The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860
The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR NEUERE GESCHICHTE ÖSTERREICHS Band 115 Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Vorsitzende: em. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber Mitglieder: Dr. Franz Adlgasser Univ.-Prof. Dr. Peter Becker Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Laurence Cole Univ.-Prof. Dr. Margret Friedrich Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Garms-Cornides Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Gottsmann Univ.-Prof. Dr. Margarete Grandner em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas Univ.-Prof. i. R. Dr. Wolfgang Häusler Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Hanisch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz Dr. Michael Hochedlinger Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt Mag. Thomas Just Univ.-Prof. i. R. Dr. Grete Klingenstein em. Univ.-Prof. Dr. Alfred Kohler Univ.-Prof. Dr. Christopher Laferl Gen. Dir. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner Dr. Stefan Malfèr Gen. Dir. i. R. H.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky Dr. Gernot Obersteiner Dr. Hans Petschar em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Scheutz em. Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer Univ.-Prof. i. R. Dr. Arnold Suppan Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer Sekretär: Dr. Christof Aichner The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl Published with the support from the Austrian Science Fund (FWF): PUB 397-G28 Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. -

Štirideset Let Lektorata Romunščine Na Filozofski Fakulteti Univerze V Ljubljani
Ioana Jieanu, Katarina Marinčič, Marjana Šifrar Kalan (ur.) ŠTIRIDESET LET LEKTORATA ROMUNŠČINE NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI PATRUZECI DE ANI DE LIMBĂ ROMÂNĂ LA FACULTATEA DE LITERE A UNIVERSITĂȚII DIN LJUBLJANA Ljubljana 2021 40 let romunščine FINAL.indd 1 16. 07. 2021 08:45:31 Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Patruzeci de ani de limbă Română la Facultatea de Litere a Universității din Ljubljana Zbirka: Historia facultatis (ISSN 2712-6242, e-ISSN 2712-6250) Uredniški odbor zbirke: Tine Germ, Janica Kalin, Ljubica Marjanovič Umek, Gregor Pompe, Jure Preglau, Matevž Rudolf, Tone Smolej Odgovorni urednik: Tine Germ Glavni urednik: Tone Smolej Urednice: Ioana Jieanu, Katarina Marinčič, Marjana Šifrar Kalan Recenzentki: Meta Lah, Alina Bako Lektorici: Metka Šorli (slovenščina), Anca Ștefan (romunščina) Tehnično urejanje: Jure Preglau Prelom: Žiga Valetič Izdala in založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Za založbo: Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Tisk: Birografika Bori d. o. o. Ljubljana, 2021 Prva izdaja Naklada: 200 izvodov Cena: 19,90 EUR Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020. To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enaki- mi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije). / This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (except photographies). Prva e-izdaja. Publikacija je v digitalni obliki prosto dostopna na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ DOI: 10.4312/9789610604815 Kataložna zapisa o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Tiskana knjiga COBISS.SI-ID=66534403 ISBN 978-961-06-0480-8 E-knjiga COBISS.SI-ID=66600195 ISBN 978-961-06-0481-5 (PDF) 40 let romunščine FINAL.indd 2 16. -
Slowenische Dialektologie Und Weinbaukultur in Slowenien
Racquel Christine Fernandez Slowenische Dialektologie und Weinbaukultur in Slowenien Ein terminologisch-kulturwissenschaftlicher Einblick in den Weinbau in Male Dole bei Vojnik DIPLOMARBEIT Zur Erlangung des akademischen Grades Magistra der Philosophie Studium der Slawistik (Studienzweig Slowenisch) Alpe-Adria-Universität Klagenfurt Fakultät für Kulturwissenschaften Begutachterin: Ass.-Prof. Dr. Herta Maurer-Lausegger Institut für Slawistik September/2010 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbstständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus gedruckten, ungedruckten oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regelen für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch Fußnoten bzw. durch andere genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Diese Arbeit wurde in gedruckter und elektronischer Form abgegeben. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version vollständig mit dem der gedruckten Version übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Klagenfurt, 20. 09. 2010 2 INHALTSVERZEICHNIS Karten-, Tabellen- -
Downloaded from Brill.Com09/28/2021 12:22:28AM Via Free Access
journal of language contact 9 (2016) 543-571 brill.com/jlc Language Mixture, Contact and Semiotic Dynamics: Some Thoughts in Counterpoint to Schuchardt’s Approach1 Robert Nicolaï Institut Universitaire de France, Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques (cnrs, Paris) [email protected] Abstract This paper compares the conceptual framework of Schuchardt’s perspective on lan- guage mixing (or at least my representation of it) with that of ‘semiotic dynamics’ as presented in several of my earlier works (Nicolaï, 2011, 2012a). These two approaches entail a same interest in the activities of individuals and groups (communication actors, etc.) who, in their ordinary usage, produce and transform languages. Thus the framework of semiotic dynamics introduces conceptualizations, obviously developed independently of the process which « Slawo-deutsches und Slawo-italienisches » exem- plifies, but which, despite differing trajectories, intersects with it. This intersection justifies my assertion as to the work’s modernity and the usefulness of reviewing it. At the same time, this review broadens the scope of research and reflections in this field. In counterpoint, I will look into the justified (or not) propensity of scholars and documenters to consider a priori the objects-languages with which they work as con- stitutively homogeneous entities, albeit subject to modification and transformation by a (contingent) contact situation. Keywords Language contact – dynamics of language – semiotic dynamics – language mixture – Schuchardt 1 My thanks to Margaret Duhnam for her English translation of this paper and to Mirko Radenkovic (S&F) for his English translation of the German quotations from Schuchardt. © koninklijke brill nv, leiden, 2016 | doi 10.1163/19552629-00903005Downloaded from Brill.com09/28/2021 12:22:28AM via free access <UN> 544 Nicolaï 1 Back to the 19th Century.