1 Einleitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Birgitz Am Weg Zur „Gesunden Gemeinde“ Foto: Freizeit-Tirol.At/Bernhard Schösser
Birgitz am Weg zur „Gesunden Gemeinde“ Foto: freizeit-tirol.at/Bernhard Schösser Gesundheit fängt bei den Jüngsten an! Deshalb waren Kinder auch intensiv in den „Tag der Gesundheit“ in Birgitz eingebunden, der Ende Juni stattfand. Er war erster Programmpunkt des Vorzeigeprojektes „Die Gesunde Gemeinde“. Mit dem Kooperationspartner GemNova wird ein Konzept für die Übertragung des Modells auf andere Kommunen erstellt. Seiten 16/17 Ausgabe 07/08 2014 Aus dem Inhalt Besuchen Sie uns auch im Internet! n Die Meinung des Präsidenten 2/3 www.gemeinde verband-tirol.at n GF Helmut Ludwig geht in den Ruhestand 4-6 Telefon: 0512/ 587130 n Glasfaserzukunft Tirol 8-11 Anschrift: n Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 18-20 Adamgasse 7a 6020 Innsbruck n Feuerbeschau in den Gemeinden 24/25 n Im Porträt: Vier neue Bürgermeister 28-31 n Aktuelles aus der Geschäftsstelle 32-34 „Sponsoring Post“ Verlagspostamt 6020 Innsbruck GZ 02Z030434 S 2 Die Meinung des Präsidenten Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Leser Mit 1. Juli ist die No- hestens im Laufe des Jah- Das Umsatzvolumen, das velle zum Tiroler Flur- res 2015 ohne nachteilige über die GemNova abgewi- verfassungsgesetz in Kraft Auswirkungen für die Ge- ckelt wurde, hat sich allein getreten. Bezüglich der meinden getroffen werden von 2011 auf 2013 von 1,2 Umsetzung betreten alle können. Mio. € auf knapp 15 Mio. € Akteure Neuland. Und der gesteigert (+1.250 %). Ak- Tiroler Gemeindeverband Wir werden weiterhin tuell gehen wir davon aus, ist in engem Kontakt mit informieren, zumal wir dass im Jahr 2014 deut- der Agrarbehörde und der unverändert echte Sahne- lich über 50 Mio. -

Nösslachjoch-Obernberger See- Tribulaune Sind Lärchenwiesen, Bergmähder, Feuchtwiesen Erlawies, Niedermoore Eggerberg Und Extensive Talwiesen Bei Nösslach
Tätigkeitsbericht Auffinger, Bergmüller, Herzer 2013 Nösslachjoch-Obernberger See- Tribulaune Tätigkeitsbericht 2013 Ergeht an: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, Altes Landhaus, 6020 Innsbruck Vorgelegt von: Mag. Klaus Auffinger, Dr. Katharina Bergmüller, Mag. Kathrin Herzer Vorgelegt am: 16.1.2013 Seite - - 1 Tätigkeitsbericht Auffinger, Bergmüller, Herzer 2013 ZUSAMMENFASSUNG Im LSG Nösslachjoch-Obernberger See-Tribulaune im Jahr 2013 fünf Naturschutzprojekte betreut. Der Schwerpunkt lag auf der Umsetzung des Projekts „Erlawies“, wo eine Renaturierung der ehemaligen Feuchtwiesen, Quellmoore und Giessen angestrebt wird. Das Skitourenlenkungsprojekt in Obernberg wird laufend evaluiert und angepasst, die Arbeiten im Rahmen des Naturschutzplan auf der Alm konnten bis auf eine Alm abgeschlossen werden. Neu hinzu kam die Projektsplanung zur Erhaltung des Tannenbestands Oberlawies. Ein großes Thema war die Weiterführung der Naturschutzförderungen im Rahmen des ÖPUL-Programms in der neuen Förderperiode. Dabei ist die SG-Betreuung sowohl in der Kontrolle der bestehenden Förderungen als auch in der Zielerstellung für zukünftige Förderungen verstärkt eingebunden. Für den Landschaftsschutz werden laufend Zaun- und Stadelförderungen abgewickelt, und naturschutzrechtlich relevant waren 2 Wegprojekte zur Erschließung der Bergmähder. Im Bereich Umweltbildung konnte neben den Führungen und Schulprojekten auch heuer ein Bergwaldprojekt durchgeführt werden. Die Infotafeln wurden für dieses Schutzgebiet fertig gestellt und montiert, -

Galleria Di Base Brenner Del Brennero Basistunnel
Schwendau Fuegenberg Hippach Ahrental Pfalzen Langbericht Nr. Einlage U-I-2.0-01-04 Ausfertigung enbach Schwaz Codice generale Allegato Identificativo copia Valle Aurina Falzes Stans Pill Mayrhofen Legende Legenda Weerberg Enneberg St. Lorenzen Marebbe S. Lorenzo di Sebato Muehlwald Kiens Gemeinden Comuni Selva dei Molini Chienes Standortgemeinde Comune interessato AUSBAU POTENZIAMENTO Finkenberg Te re nt en Weer Tux Kolsassberg Te re nt o Anrainergemeinde mit Auswirkung Comune limitrofo con Impatti EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO Terfens Anrainergemeinde ohne Auswirkung Comune limitrofo senza Impatti MÜNCHEN - VERONA MONACO - VERONA Kolsass Sonstige Gemeinde Altri Comuni Luesen Luson Gemeinden mit Parteistellung Comune con qualità di Parte BRENNER GALLERIA DI BASE Fritzens Wattenberg Vintl Gnadenwald Wattens Vandoies Rodeneck BASISTUNNEL DEL BRENNERO Rodengo Vorhaben Progetto Baumkirchen Trasse und Kunstbauwerk Tracciato ed opere civili Volders Flächen für die Baustelleneinrichtung Aree di allestimento cantiere Mils und Deponien e deposito Schmirn UVE DCA 1.0 Tulfes Natz-Schabs Absam Muehlbach Naz-Sciaves Brixen Puffer Cuscinetto Navis Vals Rio di Pusteria Bressanone Hall in Tirol Technische Projektaufbereitung Elaborazione tecnica del progetto Rinn Pfitsch 500m 500m Val di Vizze 60.0 Ampass5.0 750m 750m Thaur Aldrans 5.0 55.0 1000m 1000m Sistrans Ellboegen 20.0 25.0 Pfons15.0 30.0 35.0 1500m 1500m 10.0 40.0 Fachbereich Settore Steinach am Brenner 45.0 50.0 Rum Franzensfeste Vahrn Projektrahmen - Zusammenfassung Quadro programmatico Gries am Brenner Feldthurns Lans Fortezza Varna Sonstiges Altro 5.0 Matrei am Brenner Velturno Staatsgrenze Confine di Stato Patsch und Maßnahmenübersicht Sintesi e panoramica degli interventi 1.0 Freienfeld Campo di Trens Thema Te ma Innsbruck Muehlbachl Schoenberg i. -

Innsbruck Aldrans, Ampass, Axams, Birgitz, Flaurling, +43.512.5356-0 Und Düsseldorf Nach Tirol
Orte auf der Karte finden? Hier umklappen! 1 Gut zu wissen 2 Land & Leute 1.1 Tourismusverbände Weitwandern MTB Klettern Familien X 1.2 Anreise 2.1 Tirols Berge XX 2.3 Essen & Trinken Telefonnummer Region besonders Orte dieser Region & E-Mail Webseite geeignet zum MIT DER BAHN erreichbar, von Kärnten Tirol ist das Land der Berge; mehr als 500 Dreitausender Von und nach Tirol fahren aus über die Bundesstraßen stehen hier. Im Norden Tirols dominieren die Nördlichen 1 Achensee Tourismus Achenkirch, Maurach, Pertisau, +43.5246.5300-0 www.achensee.com Züge der Österreichischen 107 und 108. Der Grenz- Kalkalpen. Dazu zählen das Wetterstein- und Kaisergebirge, Steinberg am Rofan [email protected] und der Schweizerischen übergang Innichen-Sillian die Brandenberger und Lechtaler Alpen, das Karwendel und Bundesbahnen, der Deut- verbindet Ost- und Südtirol. die Mieminger Kette. An den Grenzen zu Kärnten und Italien 2 Alpbachtal Alpbach, Brandenberg, Breitenbach am Inn, +43.5337.21200 www.alpbachtal.at schen Bahn und der Auf allen österreichischen Brixlegg, Kramsach, Kundl, Münster, Radfeld, [email protected] erstrecken sich die Südlichen Kalkalpen: die Karnischen und Rattenberg, Reith im Alpbachtal italienischen Trenitalia. Autobahnen herrscht Gailtaler Alpen mit den Lienzer Dolomiten. Die Kalkalpen Zwischen Wien und Inns- Mautpflicht. Die Vignette sind eigentlich Ablagerungen eines Urmeeres. Durch die 3 Erste Ferienregion Aschau, Bruck am Ziller, Fügen, Fügenberg, +43.5288.62262 www.best-of-zillertal.at im Zillertal Gerlos, Hart, Hippach, Hochfügen, Kaltenbach, [email protected] bruck verkehrt 14 Mal am kann bei Automobilclubs, Bewegung von Erdplatten begann der Meeresboden vor etwa Ried im Zillertal, Schlitters, Strass, Stumm, Stummerberg, Uderns Tag der ÖBB Railjet. -

Demographische Daten Tirol 2016
DEMOGRAPHISCHE DATEN TIROL 2016 Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Landesstatistik Tirol Innsbruck, August 2017 Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Bearbeitung: Dr. Christian Dobler Redaktion: Mag. Manfred Kaiser Adresse: Landhaus 2 Heiliggeiststraße 7-9 6020 Innsbruck Telefon: +43 512 508 / 3603 Telefax: +43 512 508 / 743605 e-mail: [email protected] http://www.tirol.gv.at/statistik Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Quellenangabe gestattet. Das Bundesland Tirol im Jahr 2016 Vorwort Die von der Landesstatistik herausgegebene Publikation „Demographische Daten Tirol 2016“ stellt Zahlen und Daten aus allen gesellschaftlich bedeutenden Bereichen vor. Sie präsentiert damit eine aktuelle und aussagekräftige Analyse und – in weiterer Folge – eine objektive Grundlage für künftige Maßnahmen und gesellschaftspolitische Weichenstellungen. Die vorliegende Veröffentlichung informiert über eine Vielzahl konkreter Themen. Die Datenerhebung erfasst Aktuelles zum Bevölkerungsstand, zu Geburten, Sterbefällen, zu Einbürgerungen und Migration, Eheschließungen und weiteren Bereichen, die für die künftige Entwicklung unseres Bundeslandes von Bedeutung sind. - So lebten am 31.12.2016 746.153 Personen in Tirol. Verglichen mit dem Vorjahr hat die Bevölkerungszahl in Tirol um 7.014 Personen (+0,9 %) zugenommen. Die Bevölkerungszunahme war zwar geringer als im Vorjahr, erreichte aber den zweithöchsten Wert seit Anfang der 1990er Jahre. Ein hoher Wanderungsgewinn sowie eine positive Geburtenbilanz waren für die überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme verantwortlich. - Der allgemein zu beobachtende Trend einer älter werdenden Gesellschaft macht auch vor unserem Bundesland nicht halt. Die Tiroler Bevölkerung weist einerseits eine niedrige Geburtenziffer auf, andererseits aber auch eine steigende Lebenserwartung. Beides führt dazu, dass in rund 20 Jahren bereits jede/r vierte TirolerIn 65 Jahre oder älter sein wird. -

Gemeinde/Comune Obernberg Am Brenner •Bezirksforstinspektion/ Ispettorato Forestale Steinach Am Brenner
Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 Projekt / Progetto NESBA Bezirksforstinspektion / Ispettorato Forestale Steinach am Brenner, Tirol Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 1 Projekt/Progetto NESBA Bergtourismus / turismo in montagna Schutzwald / boschi di protezione Biomasse/ Almwirtschaft / biomassa economia delle malghe Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 2 Projekt/Progetto NESBA Nachhaltige und integrierte Entwicklung von Schutzwäldern, Biomasse-Versorgung, Almwirtschaft und Bergtourismus Sviluppo sostenibile e integrato di boschi di protezione, dell´approvvigionamento di biomassa, dell´economia delle malghe e del turismo in montagna Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 3 Projektteilnehmer / Partecipanti al Progetto Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 4 Projektpartner/Partecipanti al Progetto Tirol/Österreich •Gemeinde/Comune Gries am Brenner •Gemeinde/Comune Obernberg am Brenner •Bezirksforstinspektion/ Ispettorato forestale Steinach am Brenner Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 5 Projektsgebiet / Area del progetto Gries/Obernberg Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, Progetto NESBA Bezirksforstinspektion Steinach 6 Gemeinde/Comune Gries am Brenner Einwohner/abitanti: 1.300 Fläche/superficie: 5.600 ha Wald/boschi: 2.400 ha Holzeinschlag/taglio legno: 4.500 m³ Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, -

Waldbetreuungsgebiete Im Bezirk Imst Bezirk Waldbetreuungsgebiet
Waldbetreuungsgebiete im Bezirk Imst Bezirk Waldbetreuungsgebiet GEM_NR GEM_NAME KG_NR KG_NAME Grundstück-Nummer Anmerkungen Imst Arzl im Pitztal 201 Arzl im Pitztal 80001 Arzl im Pitztal alle alle Gst. der KG Haiming, die nördlich und nordwestlich der nördlichen siehe WBG Haiming- Imst Haiming-Inntal 202 Haiming 80101 Haiming Grundstückslinie des Gst.-Nr. 5342/15 liegen Ochsengarten alle Gst. der KG Haiming, die in Ochsengarten liegen. Diese umfassen die siehe WBG Haiming- Imst Haiming-Ochsengarten 202 Haiming 80101 Haiming Wälder der Agrargemeinschaft Ochsengarten in EZ 262 und alle Privatwälder Inntal in Ochsengarten Imst Imst-Oberstadt 203 Imst 80002 Imst alle östlich des Pigerbaches und nördlich des Malchbaches Imst Imst-Unterstadt 203 Imst 80002 Imst südlich des Malchbaches 204 Imsterberg 80003 Imsterberg alle Imst Imsterberg/Mils 210 Mils bei Imst 80007 Mils alle Imst Jerzens 205 Jerzens 80004 Jerzens alle mit Ausnahme der Gst. im Bereich Steinhof oberhalb des Weilers Kienberg siehe WBG Wenns Imst Karres 206 Karres 80005 Karres alle Imst Karrösten 207 Karrösten 80006 Karrösten alle alle Grundstücke südlich des Hauerbaches, ausgenommen die Gst-Nr. 11999 siehe WBG Imst Längenfeld-Süd 208 Längenfeld 80102 Längenfeld und 12000 und alle Gst. südlich des Fischbaches, ausgenommen das Längenfeld-Nord Waldgebiet östlich der Waldlehnrinne (östlich des Gst-Nr. 9726/14) alle Grundstücke nördlich des Hauerbaches sowie die beiden südlich des Hauerbaches gelegenen Gst-Nr. 11999 und 12000; weiters alle Gst. nördlich siehe WBG Imst Längenfeld-Nord 208 Längenfeld 80102 Längenfeld des Fischbaches und zusätzlich südlich des Fischbaches das Waldgebiet Längenfeld-Nord östlich der Waldlehnrinne (östlich des Gst-Nr. 9726/14) Imst Mieming 209 Mieming 80103 Mieming alle 211 Mötz 80113 Mötz alle 221 Stams 80111 Stams alle Imst Mötz/Stams Mötzer Lärchwald bestehend aus Gst-Nr. -

Die Geologie Des Brenner-Mesozoikums Zwischen Stubai- Und Pflerschtal (Tirol) 173-242 ©Geol
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt Jahr/Year: 1962 Band/Volume: 105 Autor(en)/Author(s): Kübler Horst, Müller Wolf Eberhard Artikel/Article: Die Geologie des Brenner-Mesozoikums zwischen Stubai- und Pflerschtal (Tirol) 173-242 ©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at 173 Jb. Geol. B. A. Bd. 105 S. 173—242 Wien, Dezember 1962 Die Geologie des Brenner-Mesozoikums zwischen Stubai- und Pflerschtal (Tirol). Von HOBST KÜBLER und WOLF-EBERHARD MÜLLER *) Mit Tafeln 13—16 Gewidmet dem Andenken an unseren Freund und Studienkollegen Hannes Scheiber, der 1961 in den Stubaier Bergen verunglückte Inhalt Seite Resume 174 Vorwort und Einleitung 174 Geologische Übersicht 175 I. Stratigraphie 177 A. Verrucano 177 B. Unterer Dolomit 182 C. Raibler Horizont 185 D. Oberer Dolomit (Norischer Hauptdolomit) 192 E. Norisch-Rätische Grenzgesteine 194 F. Der metamorphe Kalkkomplex 201 G. Oberjura des Muli-Sehrofen 208 H. Stratigraphie und Verbreitung der Steinacher Decke 211 II. Stratigraphie und Tektonik der Schubmassen nördlich vom Gschnitztal 212 A. Schubmasse I Kössener Schichten 212 Adneter Lias der Kesselspitze 213 B. Schubmasse II Quarzphyllit 215 Karbon 216 Blaserdolomit 216 C. Die tektonischen Beziehungen an beiden Schubeinheiten 219 III. Die Verschuppung der Steinacher Quarzphyllit-Decke mit dem Brenner-Meso zoikum 220 IV. Beschreibung des inneren Gebirgsbaues 223 V. Junge geologische Bildungen (Bergzerreißungen, Quartär) 238 Literaturverzeichnis 240 Beilagen: 1 geologische Karte 1 : 32.000 x) Tafel 13 Profile Tafel 14 Stratigraphisehe Profile Tafel 15 Photos Tafel 16 x) Gedruckt mit Unterstützung durch den Österreichischen Alpenverein. *) Adresse der Verfasser: Dr. -

Free Mountain Hiking Program 2018
Innsbruck – Aldrans – Lans - Igls - Patsch FREE MOUNTAIN HIKING PROGRAM 2018 Autumn Hikes 1 – 26 October 2018 Monday Autumn Colours at Zirbenweg Hiking Region Patcherkofel Tuesday In the Sellrain Mountains Hiking Region Sellrain - Praxmar Wednesday Alpine – Urban Rustling of the Leaves Hiking Region Hungerburg - Nordkette Thursday Autumn Atmosphere at Mieming Plateau Hiking Region Mieming Plateau - Wildermieming Friday North-Tyrolean Dolomites Hiking Region Axamer Lizum – Birgitzer Alm Theme Hikes Each hike is dedicated to a theme. The qualified hiking guides from ASI Reisen give insight into the fauna and flora of the Tyrolean mountains and share their expertise on this region and its people. Important Information A good physical condition is required. The hikes are also suitable for fit children from the age of 8. Please always bring weatherproof clothing and boots, drinks, sun protection and headgear. All hikes include a stop at a mountain restaurant or hut – Tyrolean specialities at reasonable prices. Meeting Point/Departure Please see the respective day program on the bilingual brochure ‘Free Mountain Hiking Program 2018’. Services Bus transfers and mountain guides are free of charge with the Welcome Card. A limited number of borrow boots are available (FOC). ASI Reisen like dogs – Despite our love of animals we ask for your understanding that we can’t take dogs on the hikes out of consideration for fellow hikers Innsbruck – Aldrans – Lans – Igls - Patsch Theme Hike on Mondays: AUTUMN COLOURS AT ZIRBENWEG The panoramic Zirbenweg between the Patscherkofel and Glungezer mountains is the heart of the trail network in the nature reserve above Innsbruck, with a fantastic view of the river Inn valley and the main Alpine ridge. -

Aldrans, Ampass, Ellbögen, Igls, Lans, Patsch, Rinn, Sistrans
IT Aldrans, Ampass, Ellbögen, Igls, Lans, Patsch, Rinn, Sistrans www.innsbruck.info 2 / 3 Rifugio Patscherkofel (in alto a sin.), Impressioni sul Patscherkofel (foto grande) Natura da vivere. Città da scoprire. I VILLAGGI D’INCANTO A DUE PASSI DALLA CITTÀ 4 / 5 Innsbruck con la Nordkette, Seegrube (in alto) Ski & City SULLA SCIA DEL DIVERTIMENTO 6 / 7 Wellness e Nordic Walking (in alto a destra), Equitazione a Igls (in basso a destra), Panorama dal sentiero Zirbenweg su Innsbruck (foto grande) La città a portata di mano NATURA E CULTURA IN UN AMBIENTE ALPINO MOZZAFIATO La città di Innsbruck e le montagne dei dintorni sono a portata di mano. Igls – Vill, Lans, Rinn, Patsch, Aldrans, Ellbögen, Sistrans e Ampass, che fanno parte dei villaggi d’incanto di Innsbruck, sono il punto di partenza per esplorare il mondo delle vette in un contesto alpino straordinario, ma anche per visitare la città a valle, con tutto ciò che ha da offrire. Città e natura si fondono armoniosamente. Qui si può vivere l’idillio della campagna ascoltando gli echi della storia. Familiarità e riserva- tezza. A soli 5 km da Innsbruck numerosi alberghi rinomati ai piedi del Patscherkofel viziano i propri ospiti. Tradizione e ospitalità coniugate con tante opportunità per lo sport e il benessere a circa 900 m di quota stimolano il corpo, lo spirito e la circolazione, rigenerando l’individuo. Con qualche colpo sui campi da golf di Lans, Igls, Rinn o su uno dei percorsi Kneipp o, ancora, passeggiando sul sentiero dei cembri (l’incantevole Zirbenweg) attraverso piante secolari. Scopriamo la natura facendo escursioni verso malghe e vette, nuotando nei laghetti freschi, passeggiando piacevolmente, facendo una partita di golf, montando in sella a una mountain bike o a un cavallo. -
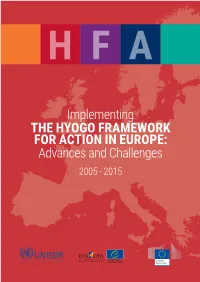
Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A
H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 Table of Contents 1. HFA Expected Outcomes..............................................................................................................9 2. Main Achievements of the HFA..................................................................................................10 2.1. Strategic Goal Area 1..........................................................................................................................................10 2.2. Strategic Goal Area 2..........................................................................................................................................15 2.3. Strategic Goal Area 3..........................................................................................................................................19 3. Drivers of Progress........................................................................................................................21 3.1. Multi-Hazard Approach......................................................................................................................................22 3.2. Gender Approach...............................................................................................................................................24 3.3. Capacities Approach...........................................................................................................................................25 -

Benefits of the Winter Welcome Card 2018/2019
Tobogganing in Oberperfuss FROM THE FIRST NIGHT’S STAY WELCOME SERVICES WELCOME CARD Free ski bus P Free cross-country skiing P CARD Free ice skating P WINTER 18/19 Swimming pools 50% discount P Family Programme 20% discount P Culture and customs 10–20% discount P Climbing 10–50% discount P Public transport (selected bus lines) P WITH A STAY OF THREE OR MORE NIGHTS AT A PARTNER COMPANY ADDITIONAL SERVICE WELCOME CARD PLUS Cable cars free for hikers and togobbanists: Oberperfuss lifts (Peter Anich sections I + II) - Oberperfuss P NO DIRECT ACCESS AT THE TURNSTILE ON LIFTS/ CABLE CARS. PLEASE ASK FOR TICKET AT THE TICKET OFFICE. unlimited unlimited Innsbruck Tourismus Burggraben 3 • 6020 Innsbruck, Austria E N Tel. +43 512 / 59 850 • [email protected] WWW.INNSBRUCK.INFO/WELCOME WWW.INNSBRUCK.INFO Rangger Köpfl #MYINNSBRUCK PUBLIC TRANSPORT WELCOME CARD Present your WELCOME CARD and enjoy free travel on selected VVT FREE SKI BUS buses within the Innsbruck holiday destination area. This free service to the TOP ski resorts in Olympia Skiworld does not apply to the City of Innsbruck (all inner city transport provided by IVB). FREE CROSS-COUNTRY SKIING Obsteig in the Innsbruck region and on the Seefeld Plateau More information about free travel available at Tourist Information, FREE ICE SKATING from your landlord and at Eisarena Silz www.innsbruck.info/welcome BUS LINES Eissportzentrum Götzens The Welcome Card acts as a valid ticket on the following bus lines Freizeitzentrum Axams between the specified route sections. Tickets are required for trips Kühtai by night that go beyond the free section.