Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Why Buy a Computer? How, Read the Instructions and Buy Books in Bookstores
Thanks for picking up this book. I appreciate the lift. occasionally bump into a paragraph that’s outdated or otherwise ill-advised, for which I humbly apologize, o master. Unique I’m your slave. Phone me anytime at 603-666-6644 to whip This is the only book whose author is weird enough to try to me into improving. I’m all ears, to improve my tongue. reveal everything important about computers — and also tricky living — all in one book. You can learn part of this info Come visit yourself, without this book, by just asking weird friends & When you visit New Hampshire, drop in & use my library, experimenting & sloshing through the Internet’s drivel, but free, anytime, day or night! In case I’m having an orgy with my 50 reading this book will save you lots of time and teach you tricks computers, phone first to pick a time when we’re cooled down. you can’t find elsewhere. You can also call the author’s cell Visit SecretFun.com. It reveals any hot news about us, gives phone, 603-666-6644, for free help, day or night. He’s usually you useful links, and lets you read parts of this book online, free. available. He’s me. Go ahead: bug me now! I read all email sent to [email protected]. I guarantee to Earlier editions were rated “the best,” praised by reply, but just by phone, so then phone me at 603-666-6644. The New York Times and thousands of other major newspapers, magazines, and gurus worldwide, in many countries; but this Mail the coupon 33rd edition is even better! It adds the world’s newest Mail us the coupon on this book’s last page. -

Journal of the International Academy for Case Studies
Volume 19, Number 1 Print ISSN: 1078-4950 Online ISSN: 1532-5822 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ACADEMY FOR CASE STUDIES Editors Inge Nickerson, Barry University Charles Rarick, Purdue University, Calumet The Journal of the International Academy for Case Studies is owned and published by Jordan Whitney Enterprises, Inc. Editorial content is under the control of the Allied Academies, Inc., a non-profit association of scholars, whose purpose is to support and encourage research and the sharing and exchange of ideas and insights throughout the world. Page ii Authors execute a publication permission agreement and assume all liabilities. Neither Jordan Whitney Enterprises nor Allied Academies is responsible for the content of the individual manuscripts. Any omissions or errors are the sole responsibility of the authors. The Editorial Board is responsible for the selection of manuscripts for publication from among those submitted for consideration. The Publishers accept final manuscripts in digital form and make adjustments solely for the purposes of pagination and organization. The Journal of the International Academy for Case Studies is owned and published by Jordan Whitney Enterprises, Inc, 51 Blake Drive, Arden, NC 28704, USA. Those interested in communicating with the Journal, should contact the Executive Director of the Allied Academies at [email protected]. Copyright 2013 by Jordan Whitney Enterprises, Inc, Arden NC, USA Journal of the International Academy for Case Studies, Volume 19, Number1, 2013 Page iii EDITORIAL BOARD MEMBERS Irfan Ahmed Devi Akella Sam Houston State University Albany State University Huntsville, Texas Albany, Georgia Charlotte Allen Thomas T. Amlie Stephen F. Austin State University Penn State University - Harrisburg Nacogdoches, Texas Harrisburg, Pennsylvania Ismet Anitsal Kavous Ardalan Tennessee Tech University Marist College Cookeville, Tennessee Poughkeepsie, New York Joe Ballenger Lisa Berardino Stephen F. -

Program, Starting in New Orleans and Houston, and Ended up As Corporate Vice President of Gas and Gas Liquids for Exxon in New York
TEXAS BUSINESS HALL OF FAME 35TH ANNUAL INDUCTION DINNER 3 Presenting Sponsor WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2017 HILTON ANATOLE HOTEL DALLAS, TEXAS YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW WELCOME JASON L. SIGNOR Chairman, Texas Business Hall of Fame INVOCATION REVEREND PAUL RASMUSSEN Highland Park United Methodist Church RECOGNITION OF TEXAS BUSINESS HALL OF FAME MEMBERS RECOGNITION OF 2017 INDUCTEES TOM LEppERT Master of Ceremonies DINNER RECOGNITION OF 2017 SCHOLARSHIP RECIPIENTS HALL OF FAME INDUCTION CEREMONY CLOSING REMARKS JASON L. SIGNOR CHARLES PHIlpOtt Chairman, 2018 Texas Business Hall of Fame Th2e 017 TO THE InducteesTEXAS BUSINESS HALL OF FAME LUCY BILLINGSLEY STAN RICHARDS Partner Principal/Creative Director Billingsley Company The Richards Group DALLAS DALLAS DAVID BONDERMAN CARL SEWELL Chairman and Founding Partner Chairman TPG Capital Sewell Automotive Companies FORT WORTH DALLAS FORREST E. HOGLUND ZALE /LIPSHY FAMILIES CEO Founders SeaOne Holdings Zale Corporation DALLAS DALLAS LUCY BILLINGSLEY Lucy Billingsley has spent her career in real estate, developing and managing commercial developments. Lucy and Henry Billingsley started Billingsley Company in 1978 hoping to develop lots of properties, have a legitimate business, sleep well at night and have fun along the way. Happily, it worked. From raw land to master-planned corporate parks and multifamily neighborhoods, the Billingsleys are involved in every step of design, instruction, leasing and management. They keep what they build. International Business Park, Austin Ranch, Cypress Waters and the Arts Plaza campus in Dallas’ Arts District are some of their larger projects. Prior to her focus on Billingsley Company, Lucy was chief executive officer of the Dallas Market Center and the Crow Design Centers in Dallas, Houston and Boston. -

WGM Retention
Hearing Date and Time: June 25, 2009 at 9:45 a.m. (Eastern Time) Objection Date and Time: June 19, 2009 at 4:00 p.m. (Eastern Time) Harvey R. Miller Stephen Karotkin Joseph H. Smolinsky WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP 767 Fifth Avenue New York, New York 10153 Telephone: (212) 310-8000 Facsimile: (212) 310-8007 Attorneys for Debtors and Debtors in Possession UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK ---------------------------------------------------------------x : In re : Chapter 11 Case No. : GENERAL MOTORS CORP., et al. , : 09-50026 (REG) : Debtors. : (Jointly Administered) : ---------------------------------------------------------------x APPLICATION OF THE DEBTORS PURSUANT TO 11 U.S.C. §§ 327(a) AND 328(a) AND FED. R. BANKR. P. 2014(a) FOR AUTHORITY TO EMPLOY WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP AS ATTORNEYS FOR THE DEBTORS, NUNC PRO TUNC TO THE COMMENCEMENT DATE TO THE HONORABLE ROBERT E. GERBER, UNITED STATES BANKRUPTCY JUDGE: General Motors Corporation (“ GM ”) and its affiliated debtors, as debtors and debtors in possession in the above-captioned chapter 11 cases (collectively, the “ Debtors ”), submit this application (the “ Application ”) for authority to employ and retain Weil, Gotshal & Manges LLP (“ WG&M ” or the “ Firm ”) as attorneys for the Debtors, nunc pro tunc to June 1, 2009 (the “ Commencement Date ”), the date on which the Debtors’ chapter 11 cases were filed, pursuant to sections 327(a) and 328(a) of title 11, United States Code (the “ Bankruptcy Code ”) US_ACTIVE:\20998563\04\20998563_4.DOC\72240.0635 and Rule 2014(a) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure (the “ Bankruptcy Rules ”) and respectfully represent: Jurisdiction 1. This Court has jurisdiction to consider this matter pursuant to 28 U.S.C. -
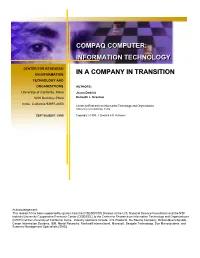
Compaq Computer:Computer
COMPAQCOMPAQ COMPUTER:COMPUTER: INFORMATIONINFORMATION TECHNOLOGYTECHNOLOGY CENTER FOR RESEARCH IN A COMPANY IN TRANSITION ON INFORMATION TECHNOLOGY AND ORGANIZATIONS AUTHORS: University of California, Irvine Jason Dedrick 3200 Berkeley Place Kenneth L. Kraemer Irvine, California 92697-4650 Center for Research on Information Technology and Organizations University of California, Irvine SEPTEMBER 1999 Copyright ã1999. J. Dedrick & K. Kraemer Acknowledgement: This research has been supported by grants from the CISE/IIS/CSS Division of the U.S. National Science Foundation and the NSF Industry/University Cooperative Research Center (CISE/EEC) to the Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO) at the University of California, Irvine. Industry sponsors include: ATL Products, the Boeing Company, Bristol-Myers Squibb, Canon Information Systems, IBM, Nortel Networks, Rockwell International, Microsoft, Seagate Technology, Sun Microsystems, and Systems Management Specialists (SMS). Abstract Compaq Computer, based in Houston, Texas, is the world’s largest personal computer manufacturer and the fourth largest information technology (IT) company. From 1992-1997, the company’s aggressive high volume PC strategy propelled it to high growth rates in revenues, while its leadership in PC servers sustained strong margins and drove profit growth. Starting in 1995, former CEO Eckhard Pfieffer began to transform Compaq from a pure PC company to a full-service IT company that could compete with the likes of IBM and Hewlett- Packard. The key strategic moves were the acquisitions of Tandem Computer and Digital Equipment Corporation in 1997 and 1998, giving Compaq a diverse line of technologies and service capabilities. Compaq stumbled badly in 1998 as it faced new challenges in the PC market and tried to assimilate Tandem and Digital. -

SLATE 2021, July 1–2, 2021, Vila Do Conde/Póvoa De Varzim, Portugal
10th Symposium on Languages, Applications and Technologies SLATE 2021, July 1–2, 2021, Vila do Conde/Póvoa de Varzim, Portugal Edited by Ricardo Queirós Mário Pinto Alberto Simões Filipe Portela Maria João Pereira OA S I c s – Vo l . 94 – SLATE 2021 www.dagstuhl.de/oasics Editors Ricardo Queirós Escola Superior de Media Artes e Design, Politécnico do Porto, Portugal [email protected] Mário Pinto Escola Superior de Media Artes e Design, Politécnico do Porto, Portugal [email protected] Alberto Simões Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugal [email protected] Filipe Portela Universidade do Minho, Portugal [email protected] Maria João Pereira Instituto Politécnico de Bragança, Portugal [email protected] ACM Classifcation 2012 Theory of computation → Formal languages and automata theory; Information systems → Data manage- ment systems; Information systems → World Wide Web; Computing methodologies → Natural language processing ISBN 978-3-95977-202-0 Published online and open access by Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, Dagstuhl Publishing, Saarbrücken/Wadern, Germany. Online available at https://www.dagstuhl.de/dagpub/978-3-95977-202-0. Publication date August, 2021 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografe; detailed bibliographic data are available in the Internet at https://portal.dnb.de. License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC-BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode. In brief, this license authorizes each and everybody to share (to copy, distribute and transmit) the work under the following conditions, without impairing or restricting the authors’ moral rights: Attribution: The work must be attributed to its authors. -
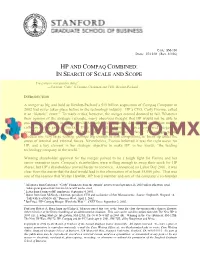
Hp and Compaq Combined: in Search of Scale and Scope
CASE: SM-130 DATE: 07/15/04 ( REV. 2/3/06) HP AND COMPAQ COMBINED: IN SEARCH OF SCALE AND SCOPE I’m going to overgun this thing.1 —Carleton “Carly” S. Fiorina, Chairman and CEO, Hewlett-Packard INTRODUCTION A merger as big and bold as Hewlett-Packard’s $19 billion acquisition of Compaq Computer in 2002 had never taken place before in the technology industry. HP’s CEO, Carly Fiorina, called it an “historic” event.2 To many critics, however, the merger seemed doomed to fail. Whatever their opinion of the strategic rationale, many observers thought that HP would not be able to successfully integrate its former rival. An embattled competitor described it as a “slow motion collision of two garbage trucks.”3 Even HP’s head of human resources compared mergers in general to icebergs where the real work takes place below the surface.4 The merger would produce one very large iceberg; perhaps big enough to sink competitors, or break up under the stress of internal and external forces. Nevertheless, Fiorina believed it was the right move for HP, and a key element in her strategic objective to make HP, in her words, “the leading technology company in the world.” Winning shareholder approval for the merger proved to be a tough fight for Fiorina and her senior executive team. Compaq’s shareholders were willing enough to swap their stock for HP shares, but HP’s shareholders proved harder to convince. Announced on Labor Day 2001, it was clear from the outset that the deal would lead to the elimination of at least 15,000 jobs. -
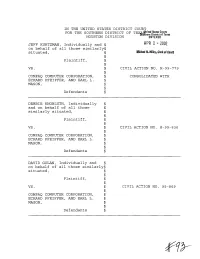
In Re: Compaq Computer Corporation Securities Litigation 99-CV-00779
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF TEX nited States Cou rts Texas HOUSTON DIVISION herENTEREDf JEFF KURTZMAN, Individually and § APR I - 2002 on behalf of all those similarly§ situated, § Michael N. Milby, Clerk of Court Plaintiff, § VS . § CIVIL ACTION NO . H-99-77 9 COMPAQ COMPUTER CORPORATION, § CONSOLIDATED WIT H ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . § MASON, § Defendants § DEBBIE KNOBLUTH, Individually and on behalf of all those similarly situated , Plaintiff , VS . CIVIL ACTION NO . H-99-83 6 COMPAQ COMPUTER CORPORATION, ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . MASON, Defendant s DAVID GOLAN, Individually and § on behalf of all those similarly§ situated, § Plaintiff, § VS . § CIVIL ACTION NO . 99-86 9 COMPAQ COMPUTER CORPORATION, § ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . § MASON, § Defendants § 4~qa,,- EMANUEL CATECHIS, Individually § and on behalf of all those § similarly situated, § Plaintiff, § § VS . § CIVIL ACTION NO . 99-88 9 § COMPAQ COMPUTER CORPORATION, § ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . § MASON, § Defendants § SUZANNE P . GOODMAN, Individually§ and on behalf of all those § similarly situated, § § Plaintiff, § VS . § CIVIL ACTION NO . 99-93 6 § COMPAQ COMPUTER CORPORATION, § ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . § MASON, § § Defendants § DAVID W . MAZONE, JUSTIN M . VANDERPOT, AND BEHRAH NAKHAI, Individually and on behalf of all those similarly situated , Plaintiffs , VS . CIVIL ACTION NO . 99-93 7 COMPAQ COMPUTER CORPORATION, ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . MASON, Defendants JOSEPH COTRONEO, Individually and on behalf of all those similarly situated , Plaintiff , VS . CIVIL ACTION NO . 99-95 2 COMPAQ COMPUTER CORPORATION, ECKARD PFEIFFER, AND EARL L . MASON, Defendant s GARY GILMAN, Individually and § on behalf of all those similarly§ situated, § § Plaintiff, § § VS . -

Acquisition Ofelectronic Commerce Capability: the Cases Ofcompaq and Dell in Sweden
Acquisition ofElectronic Commerce Capability: The Cases ofCompaq and Dell in Sweden Michael Kaplan AKADEMISK AVHANDLING Som for avlaggande av ekonomie doktorsexamen vid Hal1delshogskolan i Stoclffiolm framlaggs for offentlig granskning fredagen den 3 maj 2002, kl10.15, i sal Ruben, Handelsll0gskolan, Saltmatargatan 13-17 Acquisition ofElectronic COll1ll1erce Capability: The Cases ofCOll1paq and Dell in Sweden ,,~ STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS ~.~~~.~ EFI, THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE EFIMission EFI, the Economic Research Institute at the Stockholm School ofEconomics, is a scientific institution which works independently ofeconomic, political and sectional interests. It conducts theoretical and empirical research in management and economic sciences, including selected related disciplines. The Institute encourages and assists in the publication and distribution ofits research findings and is also involved in the doctoral education at the Stockholnl School ofEconomics. EFI selects its projects based on the need for theoretical or practical development ofa research donlain, on methodological interests, and on the generality ofa problem. Research Organization The research activities are organized in twenty Research Centers within eight Research Areas. Center Directors are professors at the Stockholm School of Economics. ORGANIZATION AND MANAGEMENT Management and Organisation; (A) ProfSven-Erik Sjostrand Center for Ethics and Economics; (CEE) Adj ProfHans deGeer Center for Entrepreneurship and Business Creation; (E) ProfCarin Holmquist Public -

The Role of Organizational Identification in Post-Death Organizing
The Role of Organizational Identification in Post-death Organizing Author: Ian Jude Walsh Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/670 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2009 Copyright is held by the author, with all rights reserved, unless otherwise noted. Boston College Wallace E. Carroll School of Management Department of Organization Studies THE ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN POST-DEATH ORGANIZING A Dissertation by Ian Jude Walsh Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Management March 23, 2009 i © copyright by IAN JUDE WALSH 2009 ii DEDICATION To my family. iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my deepest gratitude to all those people and organizations that have helped me to complete this research. This project would not have been possible without the wellspring of social, intellectual and financial support that I have been fortunate to receive throughout this journey. I am particularly thankful to my family and friends, whose boundless love, support and belief in my ability enabled me to complete this work. The members of my dissertation committee have provided me invaluable and immeasurable guidance that has helped me to develop the scholarly research skills I needed to complete this work. I appreciate Bill Stevenson’s extensive effort in helping me develop the quantitative skills to collect and analyze the large data set on which this dissertation is founded. Mary Ann Glynn encouraged me to fully develop my theoretical ideas and inspired me to maximize the contribution of this research through thoughtful discussions about the identity literature and consideration of alternative perspectives. -

Merging Information Technology and Cultures at Compaq-Digital
MIT LIBRARIES DUPL iiiiiiiiui mil mil lilll nil 1 1I1IIII 3 9080 02246 1815 328 i OEVii/i; \U"^ 414 ^ - Mi iT- CASE STUDY Merging Information Technology and Cultures at Compaq-Digital Jeanne W. Ross Carol Brown January 2001 CISRWPNo.312 Sloan WP No. 4155 i^ ©2001 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. Center for Information Systems Research Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology 3 Cambridge Center, NE20-336 Cambridge, MA 02142 MASSACHUSEHS INSTITUTE OF TECHNOLOGY APR 1 8 2001 LIBRARIES CISR Working Paper No. 312 Title: Merging Information Technology and Cultures at Compaq-Digital Author: Jeanne W. Ross and Carol Brown Date: January 2001 Abstract: Compaq Computer Corporation and Digital Equipment Corporation formally joined forces on June 11, 1998, creating a $37 billion (US) personal computer and computing services firm. The merger was expected to generate synergies that would lead to cost take-out and cross-selling opportunities. In order to generate these benefits, however, management of the combined firm would have to overcome the challenges presented by two very different management styles, cultures, organizational forms, and technology infi-astructures. This case describes the challenges from the perspective of the two firms' IT units. It explains how IT leaders ft-om the two firms cooperated to deliver an ambitious set of Day One goals, and how they worked through ongoing challenges during the eight months immediately following the merger. It offers lessons about the role of technology in facilitating merger-induced organizational changes and serves as a reminder of the importance of strategic direction in setting the IT agenda. -

PC Week Special Report Feburary 28, 1994
gaged in a struggle to re-engineer ,BY Dan Farber their info_nnation systeins. Terms like downsiring, ·upsizing, rightsiz en ~ears ago this v,;; e,k._:0}>~ ;" nahsts labored _long mto. the . ing, and scalable have become part of every managei 's .vocabul~ry: . ~ighttopr~ducethepremier issue of PC Week. •; One point is clear. The, expone~ lThe front-i;>age·bahner headline tial growth 'in -power and perfor announced new graphics capabili-· mance of PCs has created an envi ties for IBM's.327_0 PC: Apple's Mo- 6 ronment npe forclient/servercom torola 68000-based Lisa workstation ', puting. Mainframes are sharing pro- was expected to give it stiff compe, . cessingdutieswithlow-costPCs,and tition. Compaq hadjust completed· rapid application-development tools its first year d .business with•$1 _1 0 that provide seamless .data access million in s·ales, Pr~sident ·Reaga:n ~~e 1:i~gin~ing -~o ,proliferllte. Lega; ! .'' ' • ' :i i.:.; ..\: ,:~ • ·'' ' • was .entenng his fourthyear-in the cy operating systems such as CICS, White House, and'Lo~~ iriint . ' MVS,andVMSarefindingtheirway, ingmoneywith its 1-2~3 spre~~heet . · onto modern RISC platforms, and Fast-forward-· to 1994. Sam Whit- · .,. new enterprise operati~g systems . from Microsoft and IBM are start- In 1984, about30 ing to emerge. Spreadsheets, word percent or our. rocessors, and databas -'the standard ap- . catiol!-s that readers had LANs~ fined . com puting-are Today,"100 percent _becoming pow erful, multimedia . are connected. tools for collabora- more,John Dodge, Matt Kramer, . tion. E-mail is .now and Beth Freedman-original PC · the hub application Week staff members-are still toil for, global corporations.