2D-Code Fibel 2017.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mobile Application of Drug Follow-Up Information System with Data Matrix Reader
International Journal of Applied Mathematics, Advanced Technology and Science Electronics and Computers ISSN: 2147-82282147-6799 http://ijamec.atscience.org Original Research Paper Mobile Application of Drug Follow-up Information System with Data Matrix Reader Hamza Yaraş1, Kübra Uyar*2 Accepted 3rd September 2016 Abstract: The number of products that simplify people’s lives are increasing with the enormous development of the technology. Mobile devices have a great importance for the provision of communication which is one of the most significant need of human beings. Mobile devices have gone beyond to be used originally as a mobile phone purposes and they have begun to be used as a smartphone by taking in charge of computers. They are not only used for communication but also they are used like camera, photo camera, notebook, television and reminder. Google's Android platform is a widely anticipated open source operating system for mobile phones. Google’s Android Operating System (AOS) in mobile phones are still relatively new, however, AOS has been progressing quite rapidly. The increasing number of smartphone users has prepared the ground for the emergence of new ideas to make life easier. Recently, especially some applications in health sector have reflected one of the most important samples. Some of the mobile applications in this field used by humans are about hearing test, vision test, diabetes, pregnancy, and doctor appointment. This paper focuses on following of drugs, taken by patients, through mobile phones. The application running on the AOS provides the use of drugs on time with the alarm system. In addition to this, the application gives information (time, dosage, and name) about drugs by reading data matrix located on the medicine box. -

First Read Rate Analysis of 2D-Barcodes for Camera Phone Applications As a Ubiquitous Computing Tool
Edith Cowan University Research Online ECU Publications Pre. 2011 2007 First Read Rate Analysis of 2D-Barcodes for Camera Phone Applications as a Ubiquitous Computing Tool Hiroko Kato Edith Cowan University Keng T. Tan Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/ecuworks Part of the Engineering Commons 10.1109/TENCON.2007.4428778 This is an Author's Accepted Manuscript of: Kato, H., & Tan, K. (2007). First read rate analysis of 2D-barcodes for camera phone applications as a ubiquitous computing tool. Proceedings of IEEE Tencon (IEEE Region 10 Conference). (pp. 1-4). Taipei, Taiwan. IEEE. Available here © 2007 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works. This Conference Proceeding is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/ecuworks/4953 First read rate analysis of 2D-barcodes for camera phone applications as a ubiquitous computing tool. H. Kato and K.T. Tan School of Computer Science and Information Science Edith Cowan University 2 Bradford Street Mount Lawley, WA 6050 AUSTRALIA Abstract- This paper presents a detailed study on the first read In this paper, we present key factors that could enhance the rate (FRR) of seven 2D-barcodes currently used for camera phone robustness and usability of a 2D-barcode system2 based on our applications. -

© in This Web Service Cambridge University Press
Cambridge University Press 978-0-521-88839-4 - Barcodes for Mobile Devices Hiroko Kato, Keng T. Tan and Douglas Chai Index More information Index AC coefficient, 168, 169 biometric data, 66, 67, 92, 123 access control, 66 biometric encryption key, 67 Active Book, 98 bitmap (BMP), 166 Active CyberCode, 104, 105 bitwise-XOR operations, 143 Active TRIPboard, 107 blob, 70, 71, 73, 145 adaptive thresholding, 106, 172–174, 176 block code, 131 additive colour space, 124, 160, 161 blog, 31, 45, 115 Advanced Television Systems Committee Bluetooth, 76, 117–119 (ATSC), 131 Bluetooth device address (BD_ADDR), 118 Air Transport Association (ATA), 23, 60 Bose–Chaudhuri–Hochquenghem (BCH) code, 131 alignment failure, 203, 207, 210, 211, 213 bouse, 89 alignment pattern, 52–54, 147 brightness coordinate in colour space, 124 American National Standards Institute (ANSI), 61 bull’s eye, 12, 13, 36, 76, 145 American Standard Code for Information burst error, 54, 131, 137, 140, 141 Interchange (ASCII), 22–24, 33, 35, 36 business card scanner, 91 anti-aliasing, 91, 123, 147 byte compaction mode, 33 application identifier (AI), 41–43 application programming interface (API), 95 area sensor, 28 central circular finder pattern, 146, 155 arm in mCode symbol, 70 centre guard pattern, 24, 112 associative law, 132 charge coupled device (CCD), 12, 28, 31, 45, 58, 89, au (KDDI), 51 91, 97, 110, 122, 149, 158, 214, 215 augmented reality (AR), 31, 94, 97–99, 103–105, 108, 109, 121, 127 camera, 32, 37, 48, 58, 60, 69, 76, 78, 92, 100, Australian Communications and Media Authority -

Imageman.Net Getting Started
ImageMan.Net Getting Started 1 ImageMan.Net Version 3 The ImageMan.Net product includes fully managed .Net components providing an easy to use, yet rich imaging toolkit. Fully Managed Assemblies support X-Copy deployment and do not use COM Support for reading/writing many image formats including TIFF, BMP, DIB, RLE, PCX, DCX, TGA, PCX, DCX, JPG, JPEG 2000, PNG, GIF, EMF, WMF, PDF(with optional PDF Export/Import Addon Options), even plug in your own image codecs Object oriented architecture simplifies development. High level functionality allows for quick development while low level classes provide ultimate control Works with the ImageMan.Net Twain controls to easily scan from Twain compatible scanners, cameras and frame grabbers Winforms Viewer, File Open, Thumbnail Viewer, Annotation and Annotation Toolstrip controls Barcode creation and recognition support for 1-d and 2-d barcodes symbologies including QR, Datamatrix, 3 of 9, Codabar, PDF417, Code 3 of 9, Code 3 of 9 Extended, Code 93, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Aztec, Interleaved 2 of 5, Codabar and more Document Edition includes royalty free OCR, Annotations and document processing commands including despeckle, border removal, border cleanup and more Supports building client side Winforms and ASP.Net server side applications 32 & 64 bit assemblies for .Net 2.0, .Net 3.x and 4.x Support for Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012 and 2013 Context Sensitive Online Help and Documentation Backed up by Data Techniques professional support staff 1 ImageMan.Net Getting Started ImageMan.Net Getting Started 2 What's New in Version 3 What's new in the Summer Release PDFEncoder & OCR Engine Enhanced the Searchable PDF Support by assuring that the searchable text lines up with the raster image content. -
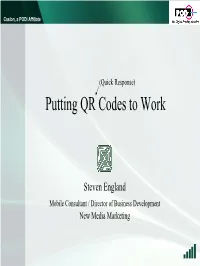
Putting QR Codes to Work
Caslon, a PODi Affiliate (Quick Response) Putting QR Codes to Work Steven England Mobile Consultant / Director of Business Development New Media Marketing Who is PODi? Who is Caslon? PODi Mission: Help members build & grow successful businesses using digital print • Printing and Marketing service providers, direct mailers & agencies • Enterprise companies • Consultants and educational organizations • Hardware and software solution providers • Regional industry vendors Caslon, a PODi Affiliate • Caslon creates cutting edge information and resources for Service Providers and Marketers • Manages and builds our community under license from PODi • Develops Case Studies, S3 sales tools, Find a Service Provider, and hosts DEX User Forums and our annual AppForum. Caslon, a PODi Affiliate What can PODi do for YOUR digital business? – Get more leads & promote your company • Connect to customers with Find a Service Provider • Self-Promo-in-a-Box lead generation campaign • Boost your reputation with a Best Practices Award, case study or PODi logo – Increase high-margin business & sell successfully • Energize sales with Digital Print Case Studies • Close more sales with proven S3 Council sales tools & NEW training modules • Learn at free monthly webinars. Plan new strategies with industry reports • NEW Caslon’s DEX S3 Forum – Boost your POD efficiency • NEW Production Central: one-stop resource center for technology support • NEW Caslon’s DEX Tech Forums: HP/Indigo, Kodak, Xerox • NEW Technology Webinars • PPML & CheckPPML_Pro – Save money on expert -

Evaluating the Usability and Suitability of Mobile Tagging Media in Educational Settings in a Developing Country
ISBN: 978-972-8924-77-5 © 2009 IADIS EVALUATING THE USABILITY AND SUITABILITY OF MOBILE TAGGING MEDIA IN EDUCATIONAL SETTINGS IN A DEVELOPING COUNTRY Samuel Olugbenga King Mathematics Education Centre Loughborough University, Loughborough, England Audrey Mbogho Department of Computer Science University of Cape Town, Rondebosch, South Africa ABSTRACT Due to the portability, mobility as well as the significantly enhanced processing and computing capabilities of mobile phones, applications based on the use of mobile phones are increasingly being used in the learning environment. However, there have not been comprehensive studies of how accessible these phone-based educational applications are, or how easy it is for novice users to learn to use them. This paper presents a study that focuses on the evaluation of 2D visual tag (or barcode) systems for accessing digital library content. The study is designed to determine the ease with which novice users can learn to use a tag-based system, and the appropriateness of use of such systems in Africa. The results show that visual tag applications are appropriate for use in Africa, and are also easy to learn to operate. The study incorporates guides on how to further enhance the usability of visual tag-based systems. It is expected that these findings are applicable to developing countries in general. KEYWORDS Visual Tags, Mobile Learning, Image Inputs 1. INTRODUCTION This research project focuses on the investigation of the 2D visual tag systems that are currently available for the linking of physical objects to information about the objects in ways that make social, educational and other interactions with the tagged objects possible. -

Extracting and Mapping Industry 4.0 Technologies Using Wikipedia
Computers in Industry 100 (2018) 244–257 Contents lists available at ScienceDirect Computers in Industry journal homepage: www.elsevier.com/locate/compind Extracting and mapping industry 4.0 technologies using wikipedia T ⁎ Filippo Chiarelloa, , Leonello Trivellib, Andrea Bonaccorsia, Gualtiero Fantonic a Department of Energy, Systems, Territory and Construction Engineering, University of Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 2, 56126 Pisa, Italy b Department of Economics and Management, University of Pisa, Via Cosimo Ridolfi, 10, 56124 Pisa, Italy c Department of Mechanical, Nuclear and Production Engineering, University of Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 2, 56126 Pisa, Italy ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: The explosion of the interest in the industry 4.0 generated a hype on both academia and business: the former is Industry 4.0 attracted for the opportunities given by the emergence of such a new field, the latter is pulled by incentives and Digital industry national investment plans. The Industry 4.0 technological field is not new but it is highly heterogeneous (actually Industrial IoT it is the aggregation point of more than 30 different fields of the technology). For this reason, many stakeholders Big data feel uncomfortable since they do not master the whole set of technologies, they manifested a lack of knowledge Digital currency and problems of communication with other domains. Programming languages Computing Actually such problem is twofold, on one side a common vocabulary that helps domain experts to have a Embedded systems mutual understanding is missing Riel et al. [1], on the other side, an overall standardization effort would be IoT beneficial to integrate existing terminologies in a reference architecture for the Industry 4.0 paradigm Smit et al. -
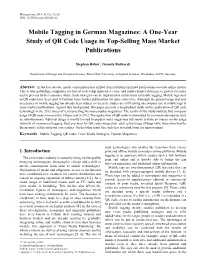
Mobile Tagging in German Magazines: a One-Year Study of QR Code Usage in Top-Selling Mass Market Publications
Management 2014, 4(3A): 12-20 DOI: 10.5923/s.mm.201401.02 Mobile Tagging in German Magazines: A One-Year Study of QR Code Usage in Top-Selling Mass Market Publications Stephan Böhm*, Daniela Ruthardt Department of Design and Computer Science, Rhein Main University of Applied Sciences, Wiesbaden, 65195, Germany Abstract In the last decade, media consumption has shifted from traditional printed publications towards online media. This is why publishing companies are forced to develop innovative cross- and multi-channel strategies to protect revenues and to prevent further customer churn. Such strategies can be implemented on the basis of mobile tagging. Mobile tags such as QR codes have been used in German mass market publications for quite some time. Although the general usage and user acceptance of mobile tagging has already been subject to research, studies are still lacking on company use of mobile tags in mass market publications. Against this background, this paper presents a longitudinal study on the application of QR code technology in the 2012 issues of ten top-selling German popular magazines. The results of the study indicate that company usage of QR codes increased by 140 percent in 2012. The application of QR codes is dominated by commercial purposes such as advertisements. Editorial usage is mostly limited to popular news magazines but seems to have an impact on the usage intensity of commercial tagging. Best practices for QR codes integration, such as the usage of deep links, were observed for the majority of the analysed case studies. On the other hand, the study has revealed room for improvement. -

Experience and Sociocultural Aspects of Using QR Code in Green Areas
U. Cocchi, V. Vaitkutė Eidimtienė / Miestų želdynų formavimas 2017 1(14) 14–22 Experience and Sociocultural Aspects of Using QR code in Green Areas Umberto Cocchi1, Vaida Vaitkutė Eidimtienė*2 1Umberto Cocchi Consulting, Piazza Unità d‘Italia 20 – I-35023 Bagnoli di Sopra (Padua), Italy. E-mail [email protected] 2Architecture, Art and Design Department, Klaipėda University K. Donelaičio sq. 5, LT-92144, Klaipeda, Lithuania 2Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences Liepų str. 1, LT-53101 Girionys, Lithuania. E-mail [email protected] (Received in January, 2017; Accepted in April, 2017; Available Online from 8th of May, 2017) Abstract QR code or quick response code, or matrix code, is the information storage system, used for different purposes since 1994. The code contains information (text, digits, internet links, any other information), which is read by using QR scanners or mobile phones. Changing needs of the society and developing technologies determined the emergence of QR codes formats. However, for the day being the code under discussion is dominating by the popularity of its use (identification of goods, information provided on notice boards, leaflets, business cards, advertising brochures, information stands). One of a more interesting ways is encountered in green areas of cities, which can be of different kind: educational, recreational, artistic. The article deals with the ways of using QR (quick response code) in green areas and introduces the research data. Key words:QR code, green areas, socio-culture, education, recreation. Anotacija QR kodas, kitaip „greitojo atsako“ arba reagavimo matricos kodas – informacijos laikmena, naudojama įvairiais tikslais nuo 1994 metų. -
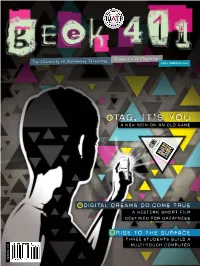
TAG, It's You! a NEW SPIN on an OLD GAME
Student Life Magazine The University of Advancing Technology Issue 5 SUMMER/FALL 2009 03 TAG, IT’S YOU A New Spin on an Old Game S N A P I T 50 D IGITAL DREAMS DO COME TRUE a Western Short FILM Destined for Greatness 24 Rise to The Surface Three Students Build a Multi-Touch Computer $6.95 SUMMER/FALL T.O.C. • • • LOOK FOR THESE MICROSOFT TAGS 04 TAG, IT'S YOU! A NEW SPIN ON AN OLD GAME TA B L E O F CON T E N T S GEEK 411 ISSUE 5 SUMMER/FALL 2009 ABOUT UAT 10 WE’RE TAKING OVER THE WORLD. JOIN US. 32 GET GEEKALICIOUS: T-SHIRT SALE 41 THE BRICKS (OUR AWESOME FACULTY) 49 THE MORTAR (OUR AWESOME STAFF) INSIDE THE TECH WORLD FEATURE 6 BIG BRAIN EVENTS STORIES 26 DEADLY TALENTED ALUMNI 35 WHAT'S YOUR GEEK IQ? 36 GO PLAY WITH YOUR DOTS 24 RISE TO THE SURFACE 38 WHAT’S HOT, WHAT’S NOT ThE RE STUDENTS BUILD A MULTI-TOUCH COMPUTER 42 DAYS OF FUTURE PAST 45 GADGETS & GIZMOS GEEK ESSENTIALS 12 GEEKS ON TOUR 18 DAY IN THE LIFE OF A DORM GEEK 30 LET THE TECH GAMES BEGIN 40 YOU KNOW YOU WANT THIS 46 HOW WE GOT SO AWESOME 47 WE GOT WHAT YOU NEED 22 GEEKILY EVER AFTER 54 GEEKS UNITE – CLUBS AND GROUPS HWTOO W UAT STUDENTS FELL IN LOVE AT FIRST SHOT STORIES ABOUT REALLY SMART PEOPLE 8 INVASION OF THE STAY PUFT BUNNY 29 RAY KURZWEIL 34 GEEK BLOGS 50 COWBOY DREAMS 20 DAVID WESSMAN IS THE MAN UAP T ROFESSOR DIRECTS FILM 16 LIVING THE GEEK DREAM 33 INTRODUCING… NEW GEEKS 14 WE DO STUFF THAT MATTERS 2 | GEEK 411 | UAT STUDENT LIFE MAGAZINE 09UT A 151 © CONTENTS COPYRIGHT BY FABCOM 20092008 LOOK FOR THESE MICROSOFT TAGS THROUGHOUT THIS S ISSUE OF GEEK 411 N AND TAG THEM A P TO GET MORE OF I THE STORY OR T BONUS CONTENT. -

Ident Jahrbuch 2012
D 14749 F Sonderausgabe JahrbuchJahrbuch 2007 2012 Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung & Identifikation BrancheEine • Barcode (1D+2D) & Mobile IT stellt sich vor • RFID Technologie & Sensorik • Kennzeichnung & Drucken • Auto-ID Kompetenzmatrix • Fachbeiträge & AIM-D e.V. • Logistiksoftware & WMS Jahrbuchwww.ident.de Online Das globale AutoID-Netzwerk für Forschung und Industrie mit Ausrichtung auf Barcodes, 2D Codes, RFID und Sensorik AIM-D, Mitglied im AIM-Global-Netzwerk, ist ein Industrieverband für Unternehmen und Forschungs- einrichtungen in Deutschland, Österreich und Schweiz. AIM-Mitglieder sind mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne. Sie bieten AutoID-Technologien und -Lösungen zum Einsatz der automatischen Kennzeichnung und Identifikation von Produkten und anderen Objekten, basierend auf Barcodes, 2D Codes, RFID und Sensorik. Wir zeigen auf Messen unser erfolgreiches AutoID-Live-Szenarium, das Tracking & Tracing Theatre, organisieren Gemeinschaftsstände und stellen Verbindungen zu anderen Marktakteuren her, auch zu Forschung, Politik und anderen Verbänden. AIM-D e.V. Deutschland - Österreich – Schweiz Richard-Weber-Str. 29 · D-68623 Lampertheim Telefon +49 6206 13177 · Fax +49 6206 13173 Verband für Automatische Datenerfassung, Identifikation und Mobilität E-Mail [email protected] · Internet www.AIM-D.de www.ident.de editorial 3 editorial ident Jahrbuch 2012 - Der Wegweiser für Anwender Auch wenn für dieses Jahr weder verlässliche Marktprognosen über die wirtschaft- liche Entwicklung in der EU, noch für die Auto-ID Branche vorliegen, wird allgemein davon ausgegangen, dass das Wachstum der Auto-ID Branche üblicherweise über dem der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Europa liegen wird. Die Optimie- rung und Gestaltung von effizienten Prozessen haben in Unternehmen seit langem Konjunk tur und das, sowohl in Zeiten einer boomenden Volkswirtschaft, als auch in Zeiten großer gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen. -

An Efficient Bar Code Recognition Engine for Enabling Mobile Services
Research Collection Doctoral Thesis An Efficient Bar Code Recognition Engine for Enabling Mobile Services Author(s): Adelmann, Robert Publication Date: 2011 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-6665246 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Diss. ETH Nr. 19721 An Efficient Bar Code Recognition Engine for Enabling Mobile Services A dissertation submitted to ETH Zurich for the degree of Doctor of Sciences presented by Robert Adelmann Diplom-Informatiker, Albert-Ludwigs-University Freiburg born October 01, 1977 citizen of Germany accepted on the recommendation of Prof. Dr. Friedemann Mattern, examiner Prof. Dr. Elgar Fleisch, co-examiner Prof. Dr. Michael Rohs, co-examiner 2011 2 | Abstract Abstract | 3 Abstract In the area of pervasive computing, mobile phones have evolved into attrac- tive development platforms that show considerable potential when it comes to bridging the often-cited gap between the real and virtual world. They are ubiquitous, highly mobile, provide significant computing power, and increas- ingly also offer an abundance of built-in sensors. With the general availability of smartphones and affordable data rates, consumers are beginning to use their mobile phones to interact with physical products found in stores in or- der to access product-related information and services. To support this inter- action, consumer-oriented mobile applications require a fast and convenient way to identify products. Even though Near Field Communication (NFC) and Radio-Frequency Identification (RFID) technology is very promising for that purpose, the widespread use of RFID tags on retail products remains unlikely for the next years.