Beiträge Zur Kleinasiatischen Münzkunde Und Geschichte 11
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Seven Churches of Revelation Turkey
TRAVEL GUIDE SEVEN CHURCHES OF REVELATION TURKEY TURKEY Pergamum Lesbos Thyatira Sardis Izmir Chios Smyrna Philadelphia Samos Ephesus Laodicea Aegean Sea Patmos ASIA Kos 1 Rhodes ARCHEOLOGICAL MAP OF WESTERN TURKEY BULGARIA Sinanköy Manya Mt. NORTH EDİRNE KIRKLARELİ Selimiye Fatih Iron Foundry Mosque UNESCO B L A C K S E A MACEDONIA Yeni Saray Kırklareli Höyük İSTANBUL Herakleia Skotoussa (Byzantium) Krenides Linos (Constantinople) Sirra Philippi Beikos Palatianon Berge Karaevlialtı Menekşe Çatağı Prusias Tauriana Filippoi THRACE Bathonea Küçükyalı Ad hypium Morylos Dikaia Heraion teikhos Achaeology Edessa Neapolis park KOCAELİ Tragilos Antisara Abdera Perinthos Basilica UNESCO Maroneia TEKİRDAĞ (İZMİT) DÜZCE Europos Kavala Doriskos Nicomedia Pella Amphipolis Stryme Işıklar Mt. ALBANIA Allante Lete Bormiskos Thessalonica Argilos THE SEA OF MARMARA SAKARYA MACEDONIANaoussa Apollonia Thassos Ainos (ADAPAZARI) UNESCO Thermes Aegae YALOVA Ceramic Furnaces Selectum Chalastra Strepsa Berea Iznik Lake Nicea Methone Cyzicus Vergina Petralona Samothrace Parion Roman theater Acanthos Zeytinli Ada Apamela Aisa Ouranopolis Hisardere Dasaki Elimia Pydna Barçın Höyük BTHYNIA Galepsos Yenibademli Höyük BURSA UNESCO Antigonia Thyssus Apollonia (Prusa) ÇANAKKALE Manyas Zeytinlik Höyük Arisbe Lake Ulubat Phylace Dion Akrothooi Lake Sane Parthenopolis GÖKCEADA Aktopraklık O.Gazi Külliyesi BİLECİK Asprokampos Kremaste Daskyleion UNESCO Höyük Pythion Neopolis Astyra Sundiken Mts. Herakleum Paşalar Sarhöyük Mount Athos Achmilleion Troy Pessinus Potamia Mt.Olympos -

Researches in Karia Author(S): W
Researches in Karia Author(s): W. R. Paton and J. L. Myres Source: The Geographical Journal, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1897), pp. 38-54 Published by: geographicalj Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1773642 Accessed: 27-06-2016 09:41 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Wiley, The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Geographical Journal This content downloaded from 198.91.37.2 on Mon, 27 Jun 2016 09:41:33 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms ( 38 ) RESEARCHES IN KARIA.* IBy W. R. PATON and J. L. MYRES. THE following notes summarize the geographical results of a series of short journeys made by Mr. W. R. Paton in 1893, partly at his own expense and partly by the aid of grants from the Royal Geographical and Hellenic Societies. Mr. Paton was accompanied in the peninsula of Myndos by Mr. J. L. Myres, Craven Travelling Fellow and Burdett- Coutts Scholar of the University of Oxford, with whom the whole material has been worked up conjointly. The inscriptions copied during these journeys, a detailed discussion of the ancient sites, and an essay on the types of tombs in this part of Karia, will be published in the Journal of Hellenic Studies, vol. -

The Influence of Achaemenid Persia on Fourth-Century and Early Hellenistic Greek Tyranny
THE INFLUENCE OF ACHAEMENID PERSIA ON FOURTH-CENTURY AND EARLY HELLENISTIC GREEK TYRANNY Miles Lester-Pearson A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2015 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/11826 This item is protected by original copyright The influence of Achaemenid Persia on fourth-century and early Hellenistic Greek tyranny Miles Lester-Pearson This thesis is submitted in partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy at the University of St Andrews Submitted February 2015 1. Candidate’s declarations: I, Miles Lester-Pearson, hereby certify that this thesis, which is approximately 88,000 words in length, has been written by me, and that it is the record of work carried out by me, or principally by myself in collaboration with others as acknowledged, and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. I was admitted as a research student in September 2010 and as a candidate for the degree of PhD in September 2011; the higher study for which this is a record was carried out in the University of St Andrews between 2010 and 2015. Date: Signature of Candidate: 2. Supervisor’s declaration: I hereby certify that the candidate has fulfilled the conditions of the Resolution and Regulations appropriate for the degree of PhD in the University of St Andrews and that the candidate is qualified to submit this thesis in application for that degree. -
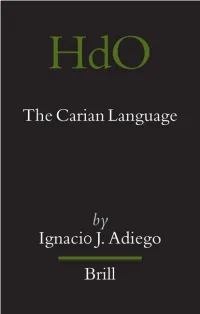
The Carian Language HANDBOOK of ORIENTAL STUDIES SECTION ONE the NEAR and MIDDLE EAST
The Carian Language HANDBOOK OF ORIENTAL STUDIES SECTION ONE THE NEAR AND MIDDLE EAST Ancient Near East Editor-in-Chief W. H. van Soldt Editors G. Beckman • C. Leitz • B. A. Levine P. Michalowski • P. Miglus Middle East R. S. O’Fahey • C. H. M. Versteegh VOLUME EIGHTY-SIX The Carian Language by Ignacio J. Adiego with an appendix by Koray Konuk BRILL LEIDEN • BOSTON 2007 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Adiego Lajara, Ignacio-Javier. The Carian language / by Ignacio J. Adiego ; with an appendix by Koray Konuk. p. cm. — (Handbook of Oriental studies. Section 1, The Near and Middle East ; v. 86). Includes bibliographical references. ISBN-13 : 978-90-04-15281-6 (hardback) ISBN-10 : 90-04-15281-4 (hardback) 1. Carian language. 2. Carian language—Writing. 3. Inscriptions, Carian—Egypt. 4. Inscriptions, Carian—Turkey—Caria. I. Title. II. P946.A35 2006 491’.998—dc22 2006051655 ISSN 0169-9423 ISBN-10 90 04 15281 4 ISBN-13 978 90 04 15281 6 © Copyright 2007 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Hotei Publishers, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers, and VSP. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Brill provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. -

Greece • Crete • Turkey May 28 - June 22, 2021
GREECE • CRETE • TURKEY MAY 28 - JUNE 22, 2021 Tour Hosts: Dr. Scott Moore Dr. Jason Whitlark organized by GREECE - CRETE - TURKEY / May 28 - June 22, 2021 May 31 Mon ATHENS - CORINTH CANAL - CORINTH – ACROCORINTH - NAFPLION At 8:30a.m. depart from Athens and drive along the coastal highway of Saronic Gulf. Arrive at the Corinth Canal for a brief stop and then continue on to the Acropolis of Corinth. Acro-corinth is the citadel of Corinth. It is situated to the southwest of the ancient city and rises to an elevation of 1883 ft. [574 m.]. Today it is surrounded by walls that are about 1.85 mi. [3 km.] long. The foundations of the fortifications are ancient—going back to the Hellenistic Period. The current walls were built and rebuilt by the Byzantines, Franks, Venetians, and Ottoman Turks. Climb up and visit the fortress. Then proceed to the Ancient city of Corinth. It was to this megalopolis where the apostle Paul came and worked, established a thriving church, subsequently sending two of his epistles now part of the New Testament. Here, we see all of the sites associated with his ministry: the Agora, the Temple of Apollo, the Roman Odeon, the Bema and Gallio’s Seat. The small local archaeological museum here is an absolute must! In Romans 16:23 Paul mentions his friend Erastus and • • we will see an inscription to him at the site. In the afternoon we will drive to GREECE CRETE TURKEY Nafplion for check-in at hotel followed by dinner and overnight. (B,D) MAY 28 - JUNE 22, 2021 June 1 Tue EPIDAURAUS - MYCENAE - NAFPLION Morning visit to Mycenae where we see the remains of the prehistoric citadel Parthenon, fortified with the Cyclopean Walls, the Lionesses’ Gate, the remains of the Athens Mycenaean Palace and the Tomb of King Agamemnon in which we will actually enter. -

Mediterranean Divine Vintage Turkey & Greece
BULGARIA Sinanköy Manya Mt. NORTH EDİRNE KIRKLARELİ Selimiye Fatih Iron Foundry Mosque UNESCO B L A C K S E A MACEDONIA Yeni Saray Kırklareli Höyük İSTANBUL Herakleia Skotoussa (Byzantium) Krenides Linos (Constantinople) Sirra Philippi Beikos Palatianon Berge Karaevlialtı Menekşe Çatağı Prusias Tauriana Filippoi THRACE Bathonea Küçükyalı Ad hypium Morylos Neapolis Dikaia Heraion teikhos Achaeology Edessa park KOCAELİ Tragilos Antisara Perinthos Basilica UNESCO Abdera Maroneia TEKİRDAĞ (İZMİT) DÜZCE Europos Kavala Doriskos Nicomedia Pella Amphipolis Stryme Işıklar Mt. ALBANIA JOINAllante Lete Bormiskos Thessalonica Argilos THE SEA OF MARMARA SAKARYA MACEDONIANaoussa Apollonia Thassos Ainos (ADAPAZARI) UNESCO Thermes Aegae YALOVA Ceramic Furnaces Selectum Chalastra Strepsa Berea Iznik Lake Nicea Methone Cyzicus Vergina Petralona Samothrace Parion Roman theater Acanthos Zeytinli Ada Apamela Aisa Ouranopolis Hisardere Elimia PydnaMEDITERRANEAN Barçın Höyük BTHYNIA Dasaki Galepsos Yenibademli Höyük BURSA UNESCO Antigonia Thyssus Apollonia (Prusa) ÇANAKKALE Manyas Zeytinlik Höyük Arisbe Lake Ulubat Phylace Dion Akrothooi Lake Sane Parthenopolis GÖKCEADA Aktopraklık O.Gazi Külliyesi BİLECİK Asprokampos Kremaste Daskyleion UNESCO Höyük Pythion Neopolis Astyra Sundiken Mts. Herakleum Paşalar Sarhöyük Mount Athos Achmilleion Troy Pessinus Potamia Mt.Olympos Torone Hephaistia Dorylaeum BOZCAADA Sigeion Kenchreai Omphatium Gonnus Skione Limnos MYSIA Uludag ESKİŞEHİR Eritium DIVINE VINTAGE Derecik Basilica Sidari Oxynia Myrina Kaz Mt. Passaron Soufli Troas Kebrene Skepsis UNESCO Meliboea Cassiope Gure bath BALIKESİR Dikilitaş Kanlıtaş Höyük Aiginion Neandra Karacahisar Castle Meteora Antandros Adramyttium Corfu UNESCO Larissa Lamponeia Dodoni Theopetra Gülpinar Pioniai Kulluoba Hamaxitos Seyitömer Höyük Keçi çayırı Syvota KÜTAHYA Grava Polimedion Assos Gerdekkaya Assos Mt.Pelion A E GTURKEY E A N S E A &Pyrrha GREECEMadra Mt. (Cotiaeum) Kumbet Lefkimi Theudoria Pherae Mithymna Midas City Ellina EPIRUS Passandra Perperene Lolkos/Gorytsa Antissa Bahses Mt. -

The Expansion of Christianity: a Gazetteer of Its First Three Centuries
THE EXPANSION OF CHRISTIANITY SUPPLEMENTS TO VIGILIAE CHRISTIANAE Formerly Philosophia Patrum TEXTS AND STUDIES OF EARLY CHRISTIAN LIFE AND LANGUAGE EDITORS J. DEN BOEFT — J. VAN OORT — W.L. PETERSEN D.T. RUNIA — C. SCHOLTEN — J.C.M. VAN WINDEN VOLUME LXIX THE EXPANSION OF CHRISTIANITY A GAZETTEER OF ITS FIRST THREE CENTURIES BY RODERIC L. MULLEN BRILL LEIDEN • BOSTON 2004 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mullen, Roderic L. The expansion of Christianity : a gazetteer of its first three centuries / Roderic L. Mullen. p. cm. — (Supplements to Vigiliae Christianae, ISSN 0920-623X ; v. 69) Includes bibliographical references and index. ISBN 90-04-13135-3 (alk. paper) 1. Church history—Primitive and early church, ca. 30-600. I. Title. II. Series. BR165.M96 2003 270.1—dc22 2003065171 ISSN 0920-623X ISBN 90 04 13135 3 © Copyright 2004 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Brill provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910 Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change. printed in the netherlands For Anya This page intentionally left blank CONTENTS Preface ........................................................................................ ix Introduction ................................................................................ 1 PART ONE CHRISTIAN COMMUNITIES IN ASIA BEFORE 325 C.E. Palestine ..................................................................................... -

PDF Formatlı Tadımlık Için Tıklayınız
Karialılar Denizcilerden Kent Kuruculara The Carians From Seafarers to City Builders 00_jenerik_onsoz_Karia.indd 1 18.11.2020 10:22 00_jenerik_onsoz_Karia.indd 2 18.11.2020 10:22 Karialılar Denizcilerden Kent Kuruculara The Carians From Seafarers to City Builders Hazırlayanlar | Edited by Olivier C. Henry Ayşe Belgin-Henry 00_jenerik_onsoz_Karia.indd 3 18.11.2020 10:22 Karialılar Denizcilerden Kent Kuruculara The Carians From Seafarers to City Builders Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin dokuzuncu kitabıdır. Bu seri Tüpraş - Yapı Kredi Yayınları işbirliği ile hazırlanmıştır. This is the ninth book in the Anatolian Civilizations Series. A co-publication of Tüpraş - Yapı Kredi Culture, Arts and Publishing. Yapı Kredi Yayınları - 5705 ISBN 978-975-08-4876-6 Proje Koordinatörü Project Coordinator Yapı Kredi Müzesi Müdürü Director of Yapı Kredi Museum Nihat Tekdemir Hazırlayanlar Edited by Olivier C. Henry Ayşe Belgin-Henry Editör Editor Nihat Tekdemir Redaksiyon Redaction Derya Önder Çeviriler Translations G. Bike Yazıcıoğlu, İpek Dağlı Dinçer Grafik Tasarım Graphic Design Nahide Dikel, Arzu Yaraş Düzelti Proofreading Filiz Özkan, Merete Çakmak Baskı Print Ofset Yapımevi Çağlayan Mah. Şair Sk. No: 4 Kağıthane - İstanbul Telefon: (0 212) 295 86 01 • www.ofset.com Sertifika No: 45354 1. baskı: İstanbul, Kasım 2020 1st printing: Istanbul, November 2020 © Ya p› Kre di Kül tür Sa nat Ya y›n c› l›k Ti ca ret ve Sa na yi A.Ş. 2020 Sertifika No Certificate No 44719 Bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from the publisher. -

Law and Power: Matthew, Paul, and the Anthropology of Law
Law and Power: Matthew, Paul, and the Anthropology of Law by David A. Kaden A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department for the Study of Religion University of Toronto © Copyright by David A. Kaden 2014 Law and Power: Matthew, Paul, and the Anthropology of Law David A. Kaden Doctor of Philosophy Department for the Study of Religion University of Toronto 2014 Abstract This dissertation examines the relationship between legal discourse and the exercise of power in the Gospel of Matthew and the letters of Paul. Drawing from Michel Foucault’s understanding of power, I argue that relations of power are instrumental in forming law as an object of discourse in these two sets of texts. This approach differs from the current approaches to studying law in Matthew and Paul in that it raises the question of why law emerges as an object of discourse. Previous studies have, conversely, tended to focus on what the two writers’ views of law are and where these views situate them vis-à-vis their contemporaries in first century C.E. Judaism. The main problem with this approach is that the evidence in Matthew and Paul is inconclusive regarding whether the two writers are inside or outside of Judaism; and scholarship in both fields has reached a stalemate over this issue. By raising a more fundamental question—why law?—my dissertation invites an analysis of law that moves beyond the Jewish/Christian cultural context, and probes the issue of why law emerges as an object in a variety of cultural settings. -

Masterarbeit / Master´S Thesis
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis „Die Asylie im Münzbild“ verfasst von / submitted by Mag. Victoria Johanna Breitsprecher angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master (MA) Wien, 2016 / Vienna, 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 067 309 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Numismatik und Geldgeschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Szaivert INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 11 1.1. Aufbau und Struktur der Arbeit 11 1.2. De nummis asylorum - RPC I und II 12 1.2.1. Asylie, Hikesie und Neokorie 12 1.2.2. Das asylietypische Münzbild 18 2. STÄDTEPRÄGUNGEN AUS DEM RPC III 22 2.1. MACEDONIA 23 2.1.1. Stoboi 23 2.1.1.1. Historischer Abriss - Stoboi 23 2.1.1.2. Münzprägung - Stoboi 23 2.2. ACHAIA 25 2.2.1. Argos 25 2.2.1.1. Historischer Abriss - Argos 25 2.2.1.2. Münzprägung - Argos 26 2.2.2. Epidauros 27 2.2.2.1. Historischer Abriss - Epidauros 27 2.2.2.2. Münzprägung - Epidauros 29 2.2.3. Korinth 30 2.2.3.1. Historischer Abriss - Korinth 30 2.2.3.2. Münzprägung - Korinth 32 2.3. ASIA 36 2.3.1. TROAS 36 2.3.1.1. Abydos 36 2.3.1.1.1. Historischer Abriss - Abydos 36 2.3.1.1.2. Münzprägung - Abydos 37 2.3.1.2. Ilion 38 2.3.1.2.1. -

APOLLO in ASIA MINOR and in the APOCALYPSE Abstract
Title: CHAOS AND CLAIRVOYANCE: APOLLO IN ASIA MINOR AND IN THE APOCALYPSE Abstract: In the Apocalypse interpreters acknowledge several overt references to Apollo. Although one or two Apollo references have received consistent attention, no one has provided a sustained consideration of the references as a whole and why they are there. In fact, Apollo is more present across the Apocalypse than has been recognized. Typically, interpreters regard these overt instances as slights against the emperor. However, this view does not properly consider the Jewish/Christian perception of pagan gods as actual demons, Apollo’s role and prominence in the religion of Asia Minor, or the complexity of Apollo’s role in imperial propaganda and its influence where Greek religion was well-established. Using Critical Spatiality and Social Memory Theory, this study provides a more comprehensive religious interpretation of the presence of Apollo in the Apocalypse. I conclude that John progressively inverts popular religious and imperial conceptions of Apollo, portraying him as an agent of chaos and the Dragon. John strips Apollo of his positive associations, while assigning those to Christ. Additionally, John’s depiction of the god contributes to the invective against the Dragon and thus plays an important role to shape the social identity of the Christian audience away from the Dragon, the empire, and pagan religion and rather toward the one true God and the Lamb who conquers all. ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY CHAOS AND CLAIRVOYANCE: APOLLO IN ASIA MINOR AND IN THE APOCALYPSE SUBMITTED TO THE FACULTY OF ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIBLICAL STUDIES BY ANDREW J. -

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dali Pisidia, Pamphylia Ve Lykia
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI PISIDIA, PAMPHYLIA VE LYKIA BÖLGESİ ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ (MS 1.-3. YÜZYILLAR) SİKKE DOLAŞIMI ESRA TÜTÜNCÜ 1130231008 YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖKER Isparta 2017 (TÜTÜNCÜ, Esra, Pisidia, Pamphylia ve Lykia Bölgesi Roma İmparatorluk Dönemi Sikke Sirkülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2017) ÖZET Bu yüksek lisans çalışmasında Pisidia, Pamphylia ve Lykia Bölgesi‟nde bulunan ve sikke buluntuları yayımlanan kentlerin, Roma İmparatorluk Dönemi‟ne ait sikkelerinin dolaşımı ve dolaşıma sebep olan unsurları ele alınmıştır. Ayrıca Anadolu‟da sikkeleri yayımlanan önemli merkezler, müze katalogları ve definelere bakılarak, Pisidia, Pamphylia ve Lykia Bölgesi‟nde bulunan kentlerin sikke dolaşımı da incelenmiştir. Böylece bölgelerin Roma İmparatorluk Dönemi‟nde siyasi, sosyal ilişkileri irdelenerek, kentlerin ekonomideki yerine değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Pisidia, Pamphylia, Lykia, Roma Eyalet Şehir Sikkeleri, Dolaşım i (TÜTÜNCÜ, Esra, Coin Circulation at Pisidia, Pamphylia and Lykia in Roman Imperial Period (A.D. 1st-3rd Centuries), Master Thesis, Isparta, 2017) ABSTRACT In this master degree thesis, the circulation of Roman Provincial coins of the cities that are located in Pisidia, Pamphylia and Lykia regions and brought out their coins and the factors caused the movement are discussed. Besides, the important centers which brought out their coins in Anatolia and the circulation of coins of the cities located in Pisidia, Pamhylia and Lykia regions have also been analyzed by looking over the museum catalogues, hoards and coin found in excavations. Therefore, by scrutinising the political and social relations of the regions in Roman Imperial Period, the importance of the cities in economics is touched on.