Wirtschaftstheorie in Zwei Gesellschaftssystemen Deutschlands Wirtschaftstheorie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
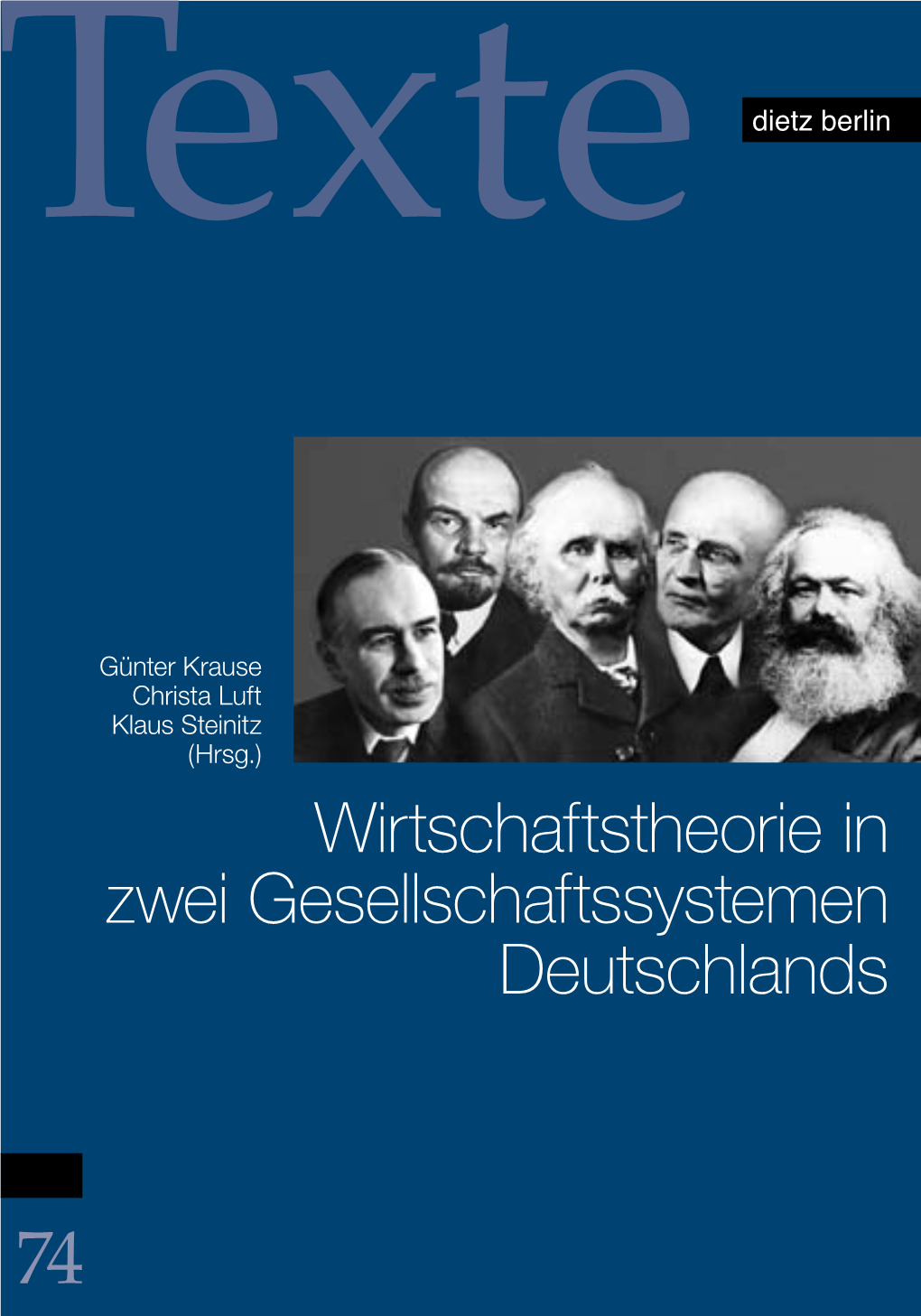
Load more
Recommended publications
-

Keynes's Investment Theory As a Micro-Foundation for His Grandchildren
Vol. 14, 2020-24 | July 03, 2020 | http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2020-24 Keynes's investment theory as a micro-foundation for his grandchildren Sergio Nisticò Abstract In contrast with the ‘missing micro-foundations’ argument against Keynes’s macro- economics, the paper argues that it is the present state of microeconomics that needs more solid ‘Keynesian foundations’. It is in particular Keynes’s understanding of investors’ behaviour that can be fruitfully extended to consumption theory, in a context in which consumers are considered as entrepreneurs, buying goods and services to engage in time- consuming activities. The paper emphasizes that the outcome in terms of enjoyment is particularly uncertain for those innovative and path-breaking activities, which Keynes discussed in his 1930 prophetic essay about us, the grandchildren of his contemporaries. Moreover, the Keynes-inspired microeconomics suggested in the paper provides an explanation of why Keynes’s prophecy about his grandchildren possibly expanding leisure did not materialize yet. The paper finally points at the need for appropriate economic policies supporting consumers’ propensity to enforce innovative forms of time use. JEL B41 D11 D81 Keywords Keynesian microeconomics; consumption; time use; uncertainty; Keynes’s grandchildren Authors Sergio Nisticò, Creativity and Motivations Economic Research Center, Department of Economics and Law, University of Cassino and Southern Lazio, Italy, [email protected] Citation Sergio Nisticò (2020). Keynes's investment theory as a micro-foundation for his grandchildren. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 14 (2020-24): 1–15. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2020-24 Received January 22, 2020 Published as Economics Discussion Paper February 14, 2020 Revised June 8, 2020 Accepted June 18, 2020 Published July 3, 2020 © Author(s) 2020. -

'Keynes Was an Extremely Political Person and We Should Be Too, Shouldn't
European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, Vol. 16 No. 1, 2019, pp. 1–7 ‘Keynes was an extremely political person and we should be too, shouldn’t we?’ Interview with Jan Priewe Jan Priewe is a retired Professor of Economics. He is a Senior Research Fellow of the Macroeconomic Policy Institute (IMK) and a Fellow and member of the coordination group of the Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM). His research areas include macroeconomics, economic policies and development economics. He has authored, co-authored or co-edited 16 books and numerous articles. Jan received his PhD in economics at the University of Bremen, Germany, in 1982 and has been a professor since then, first at the University of Applied Sciences Darmstadt, Germany, and from 1993 onwards at the HTW Berlin, Germany, before he retired in 2014. Soon after the student movements of 1968 you started your academic life, right? I started in Konstanz, Germany, and after the first semester I moved to Marburg in 1970 where my friends from high school lived. There I faced an extremely conservative faculty and at that time it did not provide a good education. In a way I regret that I switched from the University of Konstanz to Marburg. However, there was a very active student life, including radical movements and especially Marxists of all kinds. I learned more from the post-1968 student activities and self-studies, including immense amounts of reading in social science and economics, than in the lecture rooms. We felt that something was wrong with standard economics textbooks but we had hardly any academic ‘masters’ in West Germany, so we had to teach ourselves. -

Marginal Revolution
MARGINAL REVOLUTION It took place in the later half of the 19th century Stanley Jevons in England, Carl Menger in Austria and Leon walras at Lausanne, are generally regarded as the founders of marginalist school Hermann Heinrich Gossen of Germany is considered to be the anticipator of the marginalist school The term ‘Marginal Revolution’ is applied to the writings of the above economists because they made fundamental changes in the apparatus of economic analysis They started looking at some of the important economic problems from an altogether new angle different from that of classical economists Marginal economists has been used to analyse the single firm and its behavior, the market for a single product and the formation of individual prices Marginalism dominated Western economic thought for nearly a century until it was challenged by Keynesian attack in 1936 (keynesian economics shifted the sphere of enquiry from micro economics to macro economics where the problems of the economy as a whole are analysed) The provocation for the emergence of marginalist school was provided by the interpretation of classical doctrines especially the labour theory of value and ricardian theory of rent by the socialists Socialists made use of classical theories to say things which were not the intention of the creators of those theories So the leading early marginalists felt the need for thoroughly revising the classical doctrines especially the theory of value They thought by rejecting the labour theory of value and by advocating the marginal utility theory of value, they could strike at the theoretical basis of socialism Economic Ideas of Marginalist School This school concentrated on the ‘margin’ to explain economic phenomena. -

Xpenditures to More Socially Productive Uses
DOCUMENT RESUME ED 322 068 SO 030 105 AUTHOR Renner, Michael TITLE Swords into Plowshares: Converting to a Peace Economy. Worldwatch Paper 96. INSTITUTION Worldwatch Inst., Washington, D.C. REPORT NO ISBN-0-916468-97-6 PUB DATE Jun 90 NOTE 90p. AVAILABLE FROMWorldwatch Institute, 1776 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036 ($4.00). PUB TYPE Reports - Descriptive (141) EDRS PRICE MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Disarmament; *Economics; Foreign Countries; Futures (of Society); Global Approach; *International Relations; *National Defense; *Peace; Social Change; World Problems IDENTIFIERS China; *Economic Conversion; Europe (East); USSR ABSTRACT Recent world developments have created an opportune time for nations to vigorously pursue a policy of converting the huge portion of their economies that traditionally have been devoted to military expenditures to more socially productive uses. This paper outlines a strategy for such a conversion, and discusses the issues that must be confronted in such a process. Specific aspects of conversion include: (1) misconceptions about lessening military spending; (2) building a conversion coalition; (3) the paths forged by China and the Soviet Union; (4) upheaval in Eastern Europe; and (5) grassroots initiatives in the West. It is concluded that the gathering pressLre for disarmament suggests that conversion will bea topic gaining importance during the 1990's. A number of statistical tables, chalts, and maps appear throughout this paper, and 127 endnotes are provided. (DB) -

Literatur / Widerstand / Exil 37
ZWISCHENWELT LITERATUR / WIDERSTAND / EXIL 37. Jg. Nr. 1 Februar 2020 Euro 12,- SFr 15,- EIN DRÖHNEN Österreichische Post AG MZ 027030485 M Theodor Kramer Gesellschaft Engerthstr. 204/40 1020 Wien ISSN 1606-4321 204/40 1020 Wien Österreichische Post AG MZ 027030485 M Theodor Kramer Gesellschaft Engerthstr. Nicht fürs Süße, nur fürs Scharfe / und fürs Bittre bin ich da; / schlag, ihr Leute, nicht die Harfe, / spiel die Ziehharmonika. Theodor Kramer HIER ERHALTEN SIE DIE ZEITSCHRIFT ZWISCHENWELT UND DIE BÜCHER DES VERLAGS DER THEODOR KRAMER GESELLSCHAFT! Nach 24 Jahren in der Dorotheergasse im Jüdischen Museum der Stadt Wien, hat die jüdische Buchhandlung Singer eine neue Heimat gefunden. Zwischen der Seitenstettensynagoge und dem Wiener Wiesenthal- Forschungsinstitut, am Rabensteig 3 / Seitenstettengasse 6, haben wir die Lücke geschlossen und residieren hier mit koscherer Cafeteria, Buchhandlung und einem Infopoint zum Jüdischen Wien. Wie gehabt bieten wir ein reichhaltiges Sortiment zur jüdischen Literatur, Souvenirs und Geschenkartikel sowie Artikel für den rituellen Bedarf und bestellen für Sie jedes lieferbare Buch u.a. Am Infopoint wird neben Information diverser Art die Möglichkeit zur Teilnahme an geführten Spaziergängen und anderer Aktivitäten geboten. Schon sehr beliebt sind Veranstaltungen diverser Art in kleinem Rahmen, bestellen Sie unseren newsletter! Das Café ist klein und ruhig und eignet sich bestens für Termine aller Art! Unsere Öffnungszeiten sind Sonntag und Feiertage 9-16h, Montag- Donnerstag 9-19h, Freitag 9-14h. An Samstagen und während jüdischer Feiertage bleibt das Lokal geschlossen. WIR FREUEN UNS AUF EIN BALDIGES WIEDERSEHEN AM RABENSTEIG! Der berühmte Historiker der neuhebräischen Literatur Gershon Shaked hat neben Gedichten und Arbeiten für das Theater einen einzigen Roman geschrieben: „Mehagrim“ erschien 2001 auf Hebräisch. -

Evolution and Refinement of the Concept of Supply and Demand from Cournot to Marshall Ray Mcdermott
Evolution and Refinement of the Concept of Supply and Demand from Cournot to Marshall Ray McDermott Table of Contents Page Introduction 1 John Stuart Mill 2 Augustin Cournot 5 J. H. von Thunen 7 Hermann Heinrich Gossen 8 Fleeming Jenkin 10 William Stanley Jevons 13 Carl Menger 19 Leon Walras 21 Aspects of Marginal Theory as set by Jevons, Menger and Walras 28 Rudolf Auspitz and Richard Lieben 47 Alfred Marshall 52 Conclusion 66 Bibliography 67 ALUMNI MEMORIAL LIBRARY Creighton University Omaha; Nebraika 65178 fc v 385843 “ *** '••v.i-fii. Evolution and Refinement of the Concept of Supply and Demand from Cournot to Marshall The law of supply and demand can be restated in mathematical language. Fleeming Jenkin did this. As one looks at the correspondence between the economists of an eighty year period (Cournot to Marshall), thinking can be clarified on the discussion of supply and demand. Relationships are shown between these economists. There are similar ities as well as differences in their thinking. Disagreements on terminology pertaining to utility theory is evident between Jevons, Walras, and Menger. Priority on thoughts about utility was claimed and disputed between Jevons and Walras. Marshall was annoyed by Jevons* theory. Marshall, Walras, and Mill were all directed by their fathers in the classics. Lecturing at various universities was common for Jevons, Marshall, Walras, and Menger. Some however were not trained economists. Examples of these were Jenkin, Cournot, and von Thunen. Jevons, Menger, and Walras were the founders of the Marginal Utility School. The economists are not discussed according to the chronological time in which they lived. -

Why to Worry About the Wealth of Nations: Technological Unemployment, Unequal Distribution and Secular Stagnation
Why to Worry about the Wealth of Nations: Technological Unemployment, Unequal Distribution and Secular Stagnation Timon Scheuer October 14, 2016 Abstract Persistent unemployment challenges politics of today. The cure commonly prescribed is economic growth. While technological progress should still provide the necessary productivity gains, their interdepen- dency to the role allocation of private capitalism may also be an ori- gin or at least a magnifier of stagnation in the first place. In order to investigate these interdependencies the paper takes a system per- spective. Within a correspondingly aggregate model technical change affects needs of consumers, expectations of producers and productivity in different ways. Applying a corresponding set of equations in discrete time steps then allows for simulations of exemplary scenarios. In ab- sence of public interventions and institutions the stability of the system and its growth path strongly depends on the mixture of process and product innovation. If the latter fails to overcome temporary limita- tions of needs and expectations, the lack of demand may induce a loop of unemployment and stagnation. This risk increases with disparity, which itself may be triggered by certain forms of technical change in the first place. PROCEEDING OF A PRELIMINARY PRESENTED AT THE YOUNG ECONOMIST CONFERENCE 1 1 Introduction Social scientists know the name of Adam Smith (1776, [2006]) and his fa- mous `Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations`. He may even be seen as the father of economic liberalism emphasizing the role of spreading market interactions, the division of labour and the accumula- tion of capital in order to achieve productivity gains and boost economic growth (Sturn, 2008, pp. -

Austrian Economic Thought: Its Evolution and Its Contribution to Consumer Behavior
A Great Revolution in Economics –Vienna 1871 and after Austrian economic thought: its evolution and its contribution to consumer behavior Lazaros Th. Houmanidis Auke R. Leen A great REVOLUTION In economics —VIENNA 1871 and after AUSTRIAN ECONOMIC THOUGHT: ITS EVOLUTION AND ITS CONTRIBUTION TO CONSUMER BEHAVIOR Lazaros Th. Houmanidis Auke R. Leen The letter type on the cover is of Arnold Böcklin (Basel 1827-1901 Fiesole). It is a typical example of the Art Nouveau (Jugendstil) style—the fashionable style of art in Vienna at the end of the 19th century (the time older Austrianism came in full swing). In a sense, Böcklin’s work represents the essence of Austrianism: “Never was he interested in the accidental; he wanted the everlasting”. Cereales Foundation, publisher Wageningen University P.O. Box 357, 6700 AJ Wageningen, The Netherlands E [email protected] Printed by Grafisch Service Centrum Van Gils B.V. Cover design by Hans Weggen (Art Director Cereales) © 2001 Lazaros Th. Houmanidis and Auke R. Leen ISBN 90-805724-3-8 In the memory of our beloved colleague JACOB JAN KRABBE PREFACE A Great Revolution in Economics—Vienna 1871 and after is about the revolution in economic thought that started in Vienna in the last quarter of the nineteenth century. After a time of trying to save the objective value theory the time was there for a new awakening of economic thought. In Vienna, for the first time by the 1871 publication of Menger’s Grundsätze, value become subjective, and the market a process with a sovereign consumer. This book is about this awakening that proved to be more than a plaisanterie viennoise. -

Georgescu-Roegen on Gossen. Paola Tubaro
A tale of two destinies: Georgescu-Roegen on Gossen. Paola Tubaro To cite this version: Paola Tubaro. A tale of two destinies: Georgescu-Roegen on Gossen.. History of Political Economy, Duke University Press, 2014, 46 (1), pp.33-54. 10.1215/00182702-2398921. hal-01354924 HAL Id: hal-01354924 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01354924 Submitted on 20 Aug 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A tale of two destinies: Georgescu-Roegen on Gossen Paola Tubaro Abstract Nicholas Georgescu-Roegen edited the English translation of Gossen’s book The Laws of Human Relations (1983), and wrote a lengthy introduction to it. His highly appreciative, thoroughly documented study has become a major reference on an otherwise little known early writer. It suggests that Gossen was unjustly ignored by his contemporaries, just as Georgescu-Roegen felt that his own contributions to economics were insufficiently recognized. Yet it was not only a personal motive that inspired Georgescu-Roegen’s editorial enterprise: I show that his original plan was to build a model of consumer choice, with support of hints found in Gossen, to address what he saw as essential theoretical issues. -

Regional Foreign Direct Investment Review
PROMOTING INDUSTRIAL ZONES AND INVESTMENT MOBILIZATION USAID WB/G SO1: EXPANDING ECONOMIC OPPORTUNITIES CONTRACT NO. 294-C-00-00-00071-00 Regional Foreign Direct Investment Review SUBMITTED ON MAY 20, 2002 TO THE USAID MISSION TO THE WEST BANK AND GAZA MARGOT ELLIS, CTO BY THE SERVICES GROUP (TSG) SUTHERLAND MILLER III, SENIOR CONSULTANT 2300 CLARENDON BOULEVARD 1110 ARLINGTON, VIRGINIA 22201 USA WWW.TSGINC.COM USAID PRIZIM Project Regional Foreign Direct Investment Review Table of Contents Executive Summary i Chapter 1: Introduction and Methodology 1 Chapter 2: Regional Foreign Direct Investment Overview 7 Chapter 3: Sectoral Focus on Information Technology 24 Chapter 4: Sectoral Focus on Apparel and Textiles 48 Chapter 5: Sectoral Focus on Stone and Marble 59 Chapter 6: Conclusion 69 Annex A.1: Top 1,000 Companies in Pre-packaged Software A1-1 Annex A.2: Top 1,000 Companies in Computer Programming A2-1 Annex A.3: Top 1,000 Companies in Apparel Manufacturing A3-1 Annex A.4: Top Companies in Dimension Stone A4-1 The Services Group USAID PRIZIM Project Regional Foreign Direct Investment Review Executive Summary This report summarizes the available data on foreign direct investment (FDI) inflows into the Middle East region, and provides information that can help the Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA) target firms for investment promotion. The goal of this document is to better inform PIPA about regional FDI trends and guide their strategic planning for active and successful investment promotion activities. For this analysis regional investment activity was reviewed in detail for three sectors - information technology (IT), apparel manufacturing, and stone and marble - based on the previously completed Investor Targeting Strategy (ITS) completed by The Services Group in 1999. -

IZA Compact March 2013
IZA COMPACT Shaping the Future of Labor www.iza.org March 2013 IZA Celebrates 15 Years of Success in Labor Market Research and Policy Advice On the occasion of its 15th anniversary, network, the vital role of the IZA Discussion IZA celebrates and reviews its manifold ac- Paper series, now comprising over 7,000 1 15 tivities in scientific research and empirically studies, underlines the leading role of IZA in 99 based policy advice. In line with its mission, international labor economics. 8-2013 the institute takes a pioneering role in both of these areas on the national and interna- Thanks to a solid funding base provided tional level. Prominent labor economists by the Deutsche Post Foundation, comple- >> In This Issue from all over the world sent their best wish- mented by other sources of funding from es for IZA’s anniversary and underscored its all parts of the world, IZA is independent ANNIVERSARY EVENTS IN strong influence on the global debate. IZA from commissioned research and faces no WASHINGTON AND BERLIN Director Klaus F. Zimmermann, who founded restrictions concerning its research topics Many friends of IZA joined the cel- the institute 15 years ago, emphasized the and advisory activities. Members of the IZA ebration of its 15th anniversary with exceptional performance of the worldwide network are responsible for their own fund- events in the capitals of the U.S. and IZA network and announced new initiatives ing. Consequently, IZA’s research output re- Germany. page 2 for the future. flects the broad knowledge base of today’s labor economics with all its facets, regardless 10 YEARS OF AGENDA 2010 “I congratulate IZA on its splendid accomplishments of scientific approach IZA Compact summarizes the contri- over its first fifteen years. -
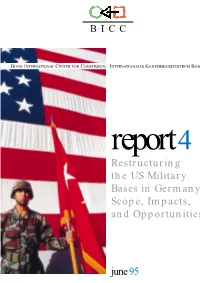
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options.