Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
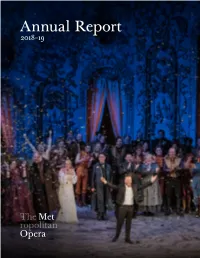
FY19 Annual Report View Report
Annual Report 2018–19 3 Introduction 5 Metropolitan Opera Board of Directors 6 Season Repertory and Events 14 Artist Roster 16 The Financial Results 20 Our Patrons On the cover: Yannick Nézet-Séguin takes a bow after his first official performance as Jeanette Lerman-Neubauer Music Director PHOTO: JONATHAN TICHLER / MET OPERA 2 Introduction The 2018–19 season was a historic one for the Metropolitan Opera. Not only did the company present more than 200 exiting performances, but we also welcomed Yannick Nézet-Séguin as the Met’s new Jeanette Lerman- Neubauer Music Director. Maestro Nézet-Séguin is only the third conductor to hold the title of Music Director since the company’s founding in 1883. I am also happy to report that the 2018–19 season marked the fifth year running in which the company’s finances were balanced or very nearly so, as we recorded a very small deficit of less than 1% of expenses. The season opened with the premiere of a new staging of Saint-Saëns’s epic Samson et Dalila and also included three other new productions, as well as three exhilarating full cycles of Wagner’s Ring and a full slate of 18 revivals. The Live in HD series of cinema transmissions brought opera to audiences around the world for the 13th season, with ten broadcasts reaching more than two million people. Combined earned revenue for the Met (box office, media, and presentations) totaled $121 million. As in past seasons, total paid attendance for the season in the opera house was 75%. The new productions in the 2018–19 season were the work of three distinguished directors, two having had previous successes at the Met and one making his company debut. -

The Foreign Service Journal, June 1962
A In This Issue The Modernization Process and Insurgency, by Henry C. Ramsey JUNE 7962 Since men began living together in organized societies, leaders have recognized a potent factor governing any action they may be about to undertake. The Romans called it vox populi. We still use the classic Latin phrase when referring to "the expressed opinion of the people" For many years, in over 100 countries, the people have been expressing their opinion of Seagram’s V.O. Canadian Whisky, with its true lightness of tone and its rare brilliance of taste. It is an enthusiastically positive opinion with a measureable effect: throughout the world more people buy A CANADIAN ACHIEVEMENT HONOURED THE WORLD OVER The Foreign Service Journal is the professional journal of the American For¬ FORSTGF^^^|JOURNAL eign Service and is published by the American Foreign Service Association, a non¬ profit private organization. Material appearing herein represents the opinions of rtJPUBLISHEO MONTHLY BY THE AMERICAN FOREIGN SERVICE ASSOCIATION X-f~l the writers and is not intended to indicate the official views of the Department of State or of the Foreign Service as a whole. AMERICAN FOREIGN SERVICE ASSOCIATION CHARLES E. BOHLEN, President TYLER THOMPSON, Vice President JULIAN F. HARRINGTON, General Manager CONTENTS JUNE 1962 Volume 39, No. 6 BARBARA P. CHALMERS, Executive Secretary BOARD OF DIRECTORS HUGH G. APPLING, Chairman H. FREEMAN MATTHEWS, JR., Secretary-Treasurer page TAYLOR G. BELCHER ROBERT M. BRANDIN MARTIN F. HERZ 21 THE MODERNIZATION PROCESS AND INSURGENCY HENRY ALLEN HOLMES by Henry C. Ramsey THOMAS W. MAPP RICHARD A. POOLE 24 THE BAR-NES COROLLARY TO PARKINSON’S LAW ROBERT C. -

From the Masses, to the Masses by Kilmore and John Albert
From the Masses, To the Masses by kilmore and John ALbert A Summation of the October 22 Coalition’s Resistance to Police Brutality in the Late 1990s written summer 2019 kites #1 DEDicatED in rEmEmbrancE of nicholas hEywarD, sr., a fiErcE fightEr in thE strugglE against policE violEncE * * * a FamIlIar sTory gaIns TracTIon Eric Garner, 43, in Staten Island, NY, 2014. Michael Brown, 18, in Ferguson, MO, 2014. Laquan McDonald, 17, in Chicago, IL, 2014. Tamir Rice, 12, in Cleveland, OH, 2014. Walter Scott. Freddie Gray. Alton Sterling. Philando Castile…. Over the past fve years, the number of high-profle murders at the hands of police has drawn national attention to the epidemic of police violence and the treatment of Black people in the United States (US). While the particular role played by police in the op- pression of Black people has been ongoing—a story told and retold with painstaking articulation in urban uprisings from Watts in 1965 to Baltimore in 2015—only recently have a signifcant number of petty-bourgeois and white people become familiar with it, newly “woke” to the sheer volume of incidents of brutality and murder per- petrated by police. Furthermore, only a select few cases were given coverage by mainstream media throughout the years, while today the epidemic nature of police violence is being more widely report- ed. In response to these outrages and to their revelation of a system- ic issue, hundreds of thousands have taken to the streets demanding justice, giving rise to a movement against unchecked police terror and violence. While noteworthy, this is hardly the frst incident of organized resistance to oppressive policing; the central, founding tenet of the Black Panther Party (BPP) at the time of its inception in 1966, for example, was to protect the Black community of Oak- land, California from the continuous abuse visited upon it by law enforcement (as is evident in the BPP’s original name: the Black Pan- 39 The October 22 Coalition logo. -

ALABAMA ALABAMA Name Age Nationality Photo
Stolen Lives: Killed by Law Enforcement ALABAMA ALABAMA Name Age Nationality Photo Donald Nabors — Black August 3, 1998. Talladega: Mr. Nabors was shot to death by a white police officer. Authorities refuse to identify the officer or divulge the circumstances surrounding the shooting. On Aug. 17, several hundred Black residents held a protest at city hall to demand justice. Source: Yahoo!/States News Service, 8/17/98 Calvin Moore 18 — February 21, 1996. Kilby Correctional Facility: Mr. Moore was serving a two-year sentence for a burglary conviction. He weighed about 160 pounds on Jan. 26, 1996. When he died less than a month later, he weighed 110 pounds. He had lost 56 pounds in less than a month and suffered symptoms of severe mental illness as well as dehydration and starvation after entering the prison. Despite the fact that Calvin was often unable to walk or talk and spent days lying on the concrete floor of his cell in a pool of his own urine, nurses repeatedly failed to provide basic medical care. Not even his vital signs were recorded for the last nine days of his life. An official state autopsy, which concluded that he died of “natural causes,” was called a “whitewash” by an internationally renowned expert on forensic medicine. The expert said Calvin’s death was “a homicide resulting from criminal negligence.” The prison’s health-care provider, Correctional Medical Services (CMS), said, “It is clear the health care staff provided appropriate and compassionate care.” Calvin Moore’s father sued CMS and seven medical professionals, including nurses and doctors, charging malpractice and negligence. -

SZÁZADOK a Magyar Történelmi Társulat Folyóirata
154. évfolyam (2020) | 3. szám SZÁZADOK A Magyar Történelmi Társulat folyóirata Az alapítás éve 1867 Főszerkesztő: Frank Tibor Felelős szerkesztő: Simon Anita Szerkesztőség: Bácsatyai Dániel, Bartha Ákos, Csukovits Enikő, Eiler Ferenc, Kenyeres István, Toma Katalin, Völgyesi Orsolya SZÁZADOK www.szazadok.hu A Magyar Történelmi Társulat folyóirata Szerkesztőség: H–1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. B. épület V. emelet 511. Telefon: (+36) 1 224 67 00 / 4637 mellék E mail: [email protected] 154. évfolyam (2020) 3. szám Szerkesztőbizottság: Csernus Sándor, Draskóczy István, Fodor Pál, Font Márta, Földes György, Gecsényi Lajos, Gyarmati György, Hermann Róbert, Horn Ildikó, Izsák Lajos, Klaniczay Gábor, Kövér György, Krász Lilla, Lévai Csaba, Orosz István, Pál Judit, Pál Lajos , Pálffy Géza, Papp Klára, Pók Attila, Rainer M. János, Romsics Ignác, Sajti Enikő, Szakály Sándor, Varga Zsuzsanna, Veszprémy László, Vonyó József, Zakar Péter, Zsoldos Attila Nemzetközi tanácsadó testület: Robert John Weston Evans (UK), Marie-Madeleine de Cevins (Franciaország), Holger Fischer (Németország), Ovidiu Ghitta (Románia), Olga Khavanova (Oroszország), Árpád von Klimó (USA), Lengyel Tünde (Szlovákia), Stanisław A. Sroka (Lengyelország), Arnold Suppan (Ausztria), Kees Teszelszky (Hollandia) Olvasószerkesztő: Reményi József Tamás Tördelés, nyomdai előkészítés: ElektroPress www.elektropress.hu Nyomás, kötészet: Prime Rate www.primerate.hu ISSN 0039–8098 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AMERIKA: TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK ÉS HATÁSOK Frank Tibor: Bevezető .......................................................................................................... -

Relatos De Guerra De Veteranos Da FEB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA Memórias do front: Relatos de guerra de veteranos da FEB Luciano Bastos Meron Salvador 2009 Luciano Bastos Meron Memórias do front: Relatos de guerra de veteranos da FEB Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em História. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eugênio Libano Soares Salvador 2009 __________________________________________________________________________ Meron, Luciano Bastos M567 Memórias do front: relatos de guerra de veteranos da FEB / Luciano Bastos Meron. -- Salvador, 2009. 160 f. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eugênio Líbano Soares Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2009. 1. Guerra Mundial, 1939-1945 - Brasil. 2. Brasil. Força Expedicionária Brasileira 3. Memória. 4. Brasil – Política e Governo - 1939-1945. 5. Brasil – Exército – História II. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III.Título. CDD – 940.5381 ___________________________________________________________________________ Luciano Bastos Meron Memórias do front: Relatos de guerra de veteranos da FEB Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História Social, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em História. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eugênio Libano Soares BANCA -

A Participação Do Brasil Na Segunda Guerra Mundial E a Importância Da Liderança Em Conflitos Armados
Centro Universitário de Brasília Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Relações Internacionais Gabriel Machado Borges de Oliveira A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a importância da liderança em conflitos armados Brasília Junho de 2011 Gabriel Machado Borges de Oliveira A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a importância da liderança em conflitos armados Monografia apresentada à Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Relações Internacionais. Orientador: Prof. Dr. Cláudio Tadeu Cardoso Fernades Brasília Junho de 2011 O48i Oliveira, Gabriel Machado Borges de. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a importância da liderança em conflitos armados / Gabriel Machado Borges de Oliveira. – 2011. 96 f. Orientador: Cláudio Tadeu. Monografia de conclusão de curso (graduação) – Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Curso de Relações Internacionais, 2011. 1. Segunda Guerra Mundial. 2. Conflitos armados. 3. Líderes militares. 4. Brasil. I. Tadeu, Cláudio. II. Centro Universitário de Brasília. III. Título. Gabriel Machado Borges de Oliveira A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a importância da liderança em conflitos armados Monografia apresentada à Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Relações Internacionais. Orientador: Prof. Dr. Cláudio Tadeu Cardoso Fernades _________________________________ Prof. Dr. Cláudio Tadeu _________________________________ Prof. Dr. Delmo Arguelhes _________________________________ Prof. Mestre. Marco Antônio Brasília, ______ de junho de 2011. Dedicatória A todos os ex-combatentes que saíram de suas casas para lutar por um Brasil melhor, e a todos os líderes, independente da área de atuação, que se dedicam para fazer com que suas equipes atinjam um objetivo comum. -

Divided Dreamworlds? the Cultural Cold War in East and West Isbn 978 90 8964 436 7
STUDIES OF THE NETHERLANDS INSTITUTE FOR WAR DOCUMENTATION DIVIDED DREAMWORLDS? STUDIES OF THE DIVIDED NETHERLANDS With its unique focus on how culture Peter Romijn is INSTITUTE DREAMWORLDS? contributed to the blurring of ideological head of the Research FOR WAR boundaries between the East and the West, Department at the Netherlands Institute this volume offers fascinating insights into the DOCUMENTATION THE CULTURAL COLD WAR for War Documentation tensions, rivalries and occasional cooperation (NIOD) and professor IN EAST AND WEST between the two blocs. Encompassing of history at Amsterdam developments across the arts and sciences, University. the authors analyse focal points, aesthetic Giles Scott-Smith is preferences and cultural phenomena through Ernst van der Beugel topics as wide-ranging as East and West Chair in Transatlantic German interior design; the Soviet stance on Diplomatic History at genetics; US cultural diplomacy during and Leiden University and senior researcher at the after the Cold War; and the role of popular Roosevelt Study Center music as a universal cultural ambassador. in Middelburg. Joes Segal is assistant Well positioned at the cutting edge of Cold professor in the War studies, this work illuminates some of the Department of History striking paradoxes involved in the production and Art History at and reception of culture in East and West. Utrecht University. Eds. P. Romijn, G. Scott-Smith andJ.Segal Romijn,G.Scott-Smith Eds. P. ISBN 978 90 8964 436 7 Edited by Peter Romijn Giles Scott-Smith 9 789089 644367 Joes Segal www.aup.nl Divided Dreamworlds? niod-dreamworlds-def.indd 1 21-6-2012 15:04:53 studies of the netherlands institute for war documentation board of editors: Madelon de Keizer Conny Kristel Peter Romijn i Ralf Futselaar — Lard, Lice and Longevity. -

Affairs of State: the Interagency and National Security
AFFAIRS OF STATE: THE INTERAGENCY AND NATIONAL SECURITY Gabriel Marcella Editor December 2008 Visit our website for other free publication downloads http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/ To rate this publication click here. This publication is a work of the U.S. Government as defined in Title 17, United States Code, Section 101. As such, it is in the public domain, and under the provisions of Title 17, United States Code, Section 105, it may not be copyrighted. ***** The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave, Carlisle, PA 17013-5244. ***** All Strategic Studies Institute (SSI) publications are available on the SSI homepage for electronic dissemination. Hard copies of this report also may be ordered from our homepage. SSI’s homepage address is: www.StrategicStudiesInstitute.army. mil. ***** The Strategic Studies Institute publishes a monthly e-mail newsletter to update the national security community on the research of our analysts, recent and forthcoming publications, and upcoming conferences sponsored by the Institute. Each newsletter also provides a strategic commentary by one of our research analysts. If you are interested in receiving this newsletter, please subscribe on our homepage at www.StrategicStudiesInstitute.army. mil/newsletter/. ISBN 1-58487-369-8 ii CONTENTS Foreword .......................................................................v 1. -

San Marco” Della R.S.I
LA DIVISIONE FANTERIA DI MARINA “SAN MARCO” DELLA R.S.I. LE BATTAGLIE A DIFESA DELLA LINEA GOTICA I BATTAGLIONI “UCCELLI” E “BLOTTO” di Lanfranco Sanna Sulla Linea Gotica (riquadro 1), dove si affrontarono oltre un milione di uomini, furono combattute le più sanguinose battaglie della Campagna d’Italia, dal settembre 1944 all’aprile del 1945. Le forze contrapposte (unità italiane erano presenti in entrambe gli schieramenti) erano così suddivise: per i tedeschi: 350.000 combattenti29 e 120.000 ausiliari in seconda linea, distribuiti in 2 Armate, 5 Corpi d’Armata, 20 Divisioni e 2 Gruppi autonomi; per gli Alleati: 600.000 combattenti30 e 300.000 ausiliari in seconda linea, distribuiti in 2 Armate, 5 Corpi d’Armata, 21 31 DRAPPELLA DELLA DIVISIONE “SAN MARCO” Divisioni, 8 Brigate autonome e 3 RCT . RIQUADRO 1 LA LINEA GOTICA La Linea Gotica (in tedesco Gotenstellung, in inglese Gothic Line) era una linea difensiva debolmente fortificata e predisposta velocemente dal feldmaresciallo tedesco Albert Kesselring nel 1944, nel tentativo di rallentare l'avanzata dell'esercito alleato – comandato dal generale Harold Alexander – verso il nord Italia. Si estendeva dalla provincia di Apuania (l'attuale Massa e Carrara), fino alla costa adriatica di Pesaro, seguendo un fronte di oltre 300 chilometri. In particolare, per la zona che ci interessa, partiva dal Fiume Versilia-Forte dei Marmi, saliva sulle Apuane e dalla Pania della Croce, passava tra i paesi di Vergemoli, Gallicano, Treppignana, Colle Monte San Quirico (Il Ciocco odierno), Lama, Monte Uccelliera, Monte Romecchio, per poi andare all’Abetone e verso il crinale pistoiese-fiorentino. La Linea Gotica passava inizialmente a sud di Borgo a Mozzano, tra Decimo e FELDMARESCIALLO Anchiano, ed era molto più consistente, potendo contare su opere di fortificazione ALBERT KESSELRING permanente, campi minati, muri anticarro, trincee, piazzole di tiro, camminamenti protetti. -
Annual Town Report
TOWN OF MEDFIELD Annual Town Report FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2016 366th Anniversary ANNUAL REPORT IN MEMORIAM Austin “Buck” Buchanan Civil Defense Director 1959 – 1973 Selectman 1959 – 1967 Town Garage Study Committee 1971 – 1972 Keeper of the Town Clock 1972 – 1999 American with Disabilities Compliance Committee 1992 – 2000 Mary Solari Crossing Guard 1967 – 2014 Police Matron 1970 – 2014 Edward A. Otting 350th Anniversary Committee 1997 – 2001 Richard L. Reinemann Medfield Historical Commission 1993 – 2001 Gayle E. McMullen-Currier 350th Anniversary Committee 1999 – 2001 James Wakely Economic Development Committee 2013 - 2016 SENATORS AND REPRESENTATIVES FOR MEDFIELD STATE Senator in General Court Governor’s Councillor Norfolk, Bristol, and Plymouth 2nd District District Robert L. Jubinville James E. Timilty State House Room 184 State House Room 518 Boston, MA 02133 Boston, MA 02133 (617) 725-4015 x2 (617) 722-1222 [email protected] [email protected] Representative in General Court 13th Norfolk District, Precinct 1 & 2 Denise Garlick State House Room 473G Boston, MA 02133 (617) 722-2070 [email protected] Representative in General Court 9th Norfolk District, Precinct 3 & 4 Shawn Dooley State House Room 167 Boston, MA 02133 (617) 722-2810 [email protected] FEDERAL U.S. Representative to Congress, 4th District Joseph Kennedy 29 Crafts Street Newton, MA 02458 (508) 332-3333 www.kennedy.house.gov United States Senator Elizabeth Warren 2400 J.F.K. Federal Building 15 New Sudbury Street Boston, MA 02203 (617 )565-3170 www.warren.senate.gov United States Senator Edward Markey 975 JFK Federal Building 15 New Sudbury Street Boston, MA 02203 (617) 565 8519 www.markey.senate.gov 1 ELECTED AND APPOINTED OFFICIALS 2016 Elected Officials Park and Recreation Commission Moderator Kirsten Young 2017 Scott F. -
Edition FALL 2
HONORS 2 0 1 0 Edition FALL 2 HONOR | COMMITMENT | INTEGRITY | DISCIPLINE | FAITH | CURIOSITY | CHARACTER | CREATIVITY In This Issue Honors Students From the Meet 2010 Buchanan Scholars ............................1 Phi Kappa Phi Recognition ......................................4 2010 Visiting Artist Seminar ................................5 Record Year for Fulbrights .....................................6 Martin Lecture: Ragsdale .......................................7 Who’s Who ..................................................................8 Dean’s Desk Michelle Ebel: Austria ............................................ 10 Daniel Vaughan Presentation ............................ 11 Mathis Research Scholarship ............................. 11 The spring of 2010 has been an exciting Study Abroad ........................................................... 11 Daniel Gouger: Chile ............................................... 12 time for the Honors College, and this issue Transfer Students .................................................. 13 of Honors Edition is our opportunity to share Interdisciplinary Seminar ..................................... 13 Student Research ................................................... 14 some of the highlights with you. I will concen- Thesis Certificate ................................................... 14 2011 Visiting Artist Seminar ............................. 15 trate on awards that our students have won, Scholars Week Winners ....................................... 16 Mock Trial ................................................................