Die Entwicklung Des Instruments Kleinregionales Entwicklungskonzept In
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

Gemeindezeitung 10/2018
An einen Haushalt Ausgabe IV Oktober November Dezember 2018 WW E IDNER GEMEINDENACHRICHTEN Baumgarten Oberweiden Zwerndorf FOCUS Neues in Weiden an der March • Der Blauglockenbaum • Das Marchfeld wird mobil • Neues Wasserwerk in Oberweiden • Der Siegelring des Richters / Baumgarten • Spring, und Dressurpferde in Oberweiden • Der Kieferborkenkäfer im Bezirk Gänserndorf • Diabetes eine Selbsthilfegruppe wurde gegründet • Straßensanierung B49 zw. Zwerndorf und Baumgarten Was das Blut für den Menschen, ist das Wasser für die Erde. © Hermann Lahm (*1948) Inhaltsverzeichnis Seiite Beiitrag 3 Wort des Bürgermeisters 4 Unser neues Wasserwerk 7 Tag des Zivilschutzes 10 Tatort WC 11 Baustelle B49 12 Das Marchfeld wird mobil 13 Der Kiefernborkenkäfer 15 Der Siegelring des Richters 17 Die March 18 VOR / Autofreier Tag 19 Termine 20 Wochenenddienste der Ärzte 21 Mitteilung der Pfarre 22 Gemeindebücherei 25 Kulturverein Oberweiden 27 Musikverein Oberweiden 28 Seniorenbund Zwerndorf 30 Lebenshilfe Baumgarten 31 Menschen aus der Gemeinde 32 Blaulicht 34 Kinderpolizei 35 Von Weidner für Weidner 36 Wasser sparen 37 Hitzerekord in Österreich 38 Gestüt Kronlechner 40 Blauglockenbaum 41 Diabetes / Selbsthilfegruppe 42 Oberweiden im TV 43 Mitzi`s Häferlgucker 44 Rätselseite 45 Anzeigenteil 47 Lösungsseite 48 Impressum Die Redaktion weißt darauf hin, dass es im Dezember eine weihnachtliche Sonderausgabe des Weidner Focus geben wird, indem aktuelle und neu dazugekommene Termine bekanntgegeben werden können. Alle Rechte beim Herausgeber. Die Beiträge werden inhaltlich unverändert übernommen, somit ist jeder Autor für seinen Beitrag eigenverantwortlich. 2 Wort des Bürgermeisters Liebe Weidnerinnen und Weidner Herbstzeiit iist Erntezeiit. Ich hoffe Sie haben den Sommer gut verbracht und sind erholt. Die große Hitze ist nun endgültig vorüber. Wir konnten Anfang September unser neues Wasserwerk feierlich eröffnen, womit ich mich bei Ihnen für Ihren Besuch noch einmal recht herzlich bedanken möchte. -
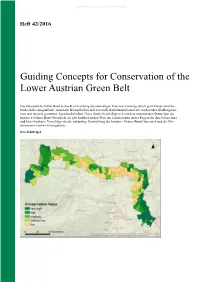
Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt
©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Heft 42/2016 Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Das Europäische Grüne Band erstreckt sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch ganz Europa und ver- bindet dabei ausgedehnte, naturnahe Biotopflächen und wertvolle Kulturlandschaften mit wachsenden Siedlungsräu- men und intensiv genutzten Agrarlandschaften. Diese Studie beschäftigt sich mit dem momentanen Status Quo der Initiative Grünes Band Österreich, sie gibt Einblick in den Wert der Landschaften dieser Region für den Naturschutz und bietet konkrete Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Initiative Grünes Band Österreich und der Nie- derösterreichischen Grenzgebiete. Eva Schweiger ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Eva Schweiger, 2015 ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at ©Nationalpark Donau-Auen GmbH, download www.zobodat.at Abstract Stretching across Europe along the former Iron Curtain, the European Green Belt connects large undisturbed natural biotopes and valuable cultural landscapes with developing urban areas and intensively used agricultural landscapes. The European Green Belt initiative’s main goal is to preserve and restore a pan-European ecological network with a connecting function for species and habitats as well as for conservation work. This study investigates the current status quo of the Austrian Green Belt initiative in regard of organisational structures and conservation activities. Furthermore, a spatial analysis of one specific part of the Austrian borderlands, the Lower Austrian Green Belt, sheds light on the value of this region’s landscapes for nature conservation and clearly shows that the Iron Curtain’s preserving effect is still present in proximity to the border. -

Räumliches Entwicklungskonzept Für Marchegg Impressum
von marchegg Räumliches Entwicklungskonzept für Marchegg Impressum Gruppe 1 Christopher Karl 1207237 Stefanie Kristen 1326491 Martin Nikisch 0826326 Julia Pferzinger 1325671 Lisa-Anna Steinmetz 1326939 Abb. 1.1. Gruppenbild Fachbereich Örtliche Raumplanung Vertr.Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Helena Linzer Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Werner Tschirk Fachbereich Finanzwissenschat und Infrastrukturpolitik Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.rer.soc.oec. Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald Fachbereich Verkehrssystemplanung Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Bardo Hörl Institut für EDV-gestützte Methoden in Architektur und Raumplanung Senior Lecturer Dipl.-Ing. Arnold Faller 2 2 2 Projekt 2 I Marchegg I Gruppe 1 I WS 2015 1. Einleitung ..................................................... 4 1.1. Fakten......................................................6 1.2. Projektablauf..........................................8 1.3. Erste Eindrücke.......................................9 2. Analyse...................................................... 10 2.1. Bestandsanalyse..................................11 2.2. SWOT-Analyse ......................................13 3. Leitbild ....................................................... 14 3.1. SWOT-Analyse ......................................15 3.2. Szenarien...............................................16 3.3. Leitbildentwicklung .............................20 3.4. Leitbild ...................................................21 3.5. Logo .......................................................23 3.6. Die 5 Elemente des -

Sportbericht 2014
Sportbericht 2014 Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung — Abteilung Sport www.noe.gv.at SPORT.LAND.Niederösterreich — Programme SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich Sportbericht NiederöSterreich 2014 Fotos: 1) Rainer Mirau 2) Franz Baldauf 1 2 2 vorwort SPORT.LAND.Niederösterreich bewegt.begeistert.gewinnt Wieder ist es soweit, mit dem Sportbericht das Kapitel für ein Sportjahr zu schließen. Das heißt, Bilanz zu legen in Bezug auf die erfolgte Arbeit im Sportnetzwerk Niederösterreich. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, die Bewegungs- und Leistungskultur in Niederösterreich zu fokussieren und über den Entwicklungsstand zu berichten. Eines vorab: SPORT.LAND.Nie- derösterreich ist für viele Menschen zum Begriff geworden, den sie sehr konkret mit Sportpersönlichkeiten, mit herausragenden Erfolgen, mit be- eindruckenden Veranstaltungen, unterstützenden Serviceleistungen oder auch sehr persönlichen emotionalen Erlebnissen verbinden. Niederöster- reich setzt auf Sport und Bewegung und somit darauf, die Sportkultur in der Bevölkerung fest zu verankern. Das gemeinsame Zukunftsbild lautet: Niederösterreich ist ein Land mit ausgeprägter Sportkultur. Kurz gesagt: „SPORT.LAND.Niederösterreich – bewegt.begeistert.gewinnt“. Mit der Präsentation der neuen Sportstrategie 2020 wurde ins Sportjahr 2014 gestartet. Ein sehr umfassender Entwicklungsprozess mit den Netzwerkpartnern im Sportland Niederösterreich ist vor- angegangen. Im Rahmen des breit angelegten Sportdialogs konnte Einklang für die Vision, die Ziele und die grundstrategischen Aussagen hergestellt -

Kundmachung Ersatzneubau APG-Weinviertelleitung
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Abteilung Umwelt- und Energierecht – RU4 Kundmachung (Zl. RU4-U-768/053-2017) Die Austrian Power Grid AG, vertreten durch ONZ ONZ KRAEMMER HÜTTLER Rechts- anwälte GmbH, 1010 Wien, hat den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dem UVP-G 2000 bei der Niederösterreichischen Landesregierung als UVP-Behörde für das Verfahren „Ersatzneubau APG-Weinviertelleitung“ gestellt. Gemäß §§ 44a und 44d des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG und gemäß § 9 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 – UVP-G 2000 wurde der verfahrenseinleitende Antrag und die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung im Großverfahren kundgemacht. Zu diesem Vorhaben fand am 14.September 2017, 15.September 2017 und 18.September 2017 eine öffentliche mündliche Verhandlung in 2170 Poysdorf, statt. Gemäß § 44e AVG ist die Verhandlungsschrift spätestens eine Woche nach Schluss der mündlichen Verhandlung bei der Behörde und bei der Gemeinde während der Amtsstun- den mindestens drei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ausfertigung der aufgenommenen Verhandlungs- schrift bei der Standortgemeinden Altlichtenwarth, Angern an der March, Auersthal, Bern- hardsthal, Bockfließ, Drösing, Dürnkrut, Ebenthal, Enzersfeld im Weinviertel, Gänserndorf, Großebersdorf, Großengersdorf, Großkrut, Hausbrunn, Hohenau an der March, Jeden- speigen, Neusiedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf, Pillichsdorf, Prottes, Ra- bensburg, Ringelsdorf-Niederabsdorf, Schönkirchen-Reyersdorf, Spannberg, Stetten, Velm-Götzendorf, Weiden an der March, Weikendorf, Wolkersdorf im Weinviertel und Zis- tersdorf sowie beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Energierecht – RU 4, 3109 St. Pölten, Neue Herrengasse, Haus 16, Erdgeschoss, während der Amts- stunden innerhalb der nächsten 3 Wochen zur Einsichtnahme aufliegt. Eine Abschrift der Verhandlungsschrift ist ebenfalls auch im Internet unter - 2 - http://www.noe.gv.at/Umwelt/Umweltschutz/Umweltrecht-aktuell.html, während der nächsten 3 Wochen zu finden. -

Biologische Landwirtschaft Im Marchfeld
Federal Environment Agency – Austria BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT IM MARCHFELD Potenziale zur Entlastung des Natur- und Landschaftshaushaltes Sonja Hadatsch Ruth Kratochvil Anna Vabitsch Bernhard Freyer Bettina Götz MONOGRAPHIEN Band 127 M-127 Wien, 2000 Projektleitung Bettina Götz Autoren Sonja Hadatsch, Ruth Kratochvil, Anna Vabitsch, Bernhard Freyer (alle: Institut für Ökologischen Landbau, Universität für Bodenkultur) Bettina Götz (Umweltbundesamt) Projektmitarbeit Alarich Riß, Gerhard Zethner Übersetzung Brigitte Read Lektorat Elfriede Kasperowski Abbildungs- und Tabellennachbearbeitung Manuela Kaitna Satz/Layout Manuela Kaitna Dank: Besonderer Dank gilt den Betriebsleitern der sechs landwirtschaftlichen Betriebe, die an der ökologischen Bewertung nach dem Ökopunkteprogramm Niederösterreich teilgenommen haben. Weiters wird den neun Experten aus dem Bereich der konventionellen Landwirtschaft, der bio- logischen Landwirtschaft, der Biovermarktung und aus dem Bereich des Gewässerschutzes für ihre Bereitschaft für ein Interview im Rahmen der Akzeptanzanalyse herzlich gedankt. Allen Teilnehmern am Workshop am 6. März 2000 in der landwirtschaftlichen Fachschule in Obersiebenbrunn wird für ihre Teilnahme und aktive Mitarbeit in den Arbeitskreisen gedankt. Impressum Medieninhaber und Herausgeber: Umweltbundesamt GmbH (Federal Environment Agency Ltd) Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien (Vienna), Austria Druck: Riegelnik, A-1080 Wien © Umweltbundesamt GmbH, Wien, 2000 Alle Rechte vorbehalten (all rights reserved) ISBN 3-85457-555-6 Potenziale der -

Gliederung Österreich in NUTS-Einheiten Gebietsstand 1.1.2015
Gliederung Österreichs in NUTS-Einheiten Gebietsstand 1.1.2015 CODE Zugehörige Bundesländer, NUTS1 SS Statutarstädte, NUTS2 PB Politische Bezirke NUTS3 AT Österreich AT1 Ostösterreich Burgenland, Niederösterreich, Wien AT11 Burgenland (AT) Ganzes Bundesland AT111 Mittelburgenland PB Oberpullendorf AT112 Nordburgenland SS Eisenstadt, SS Rust, PB Eisenstadt-Umgebung, PB Mattersburg, PB Neusiedl am See AT113 Südburgenland PB Güssing, PB Jennersdorf, PB Oberwart AT12 Niederösterreich Ganzes Bundesland AT121 Mostviertel-Eisenwurzen SS Waidhofen an der Ybbs, PB Amstetten, PB Melk, PB Scheibbs AT122 Niederösterreich-Süd SS Wiener Neustadt, PB Lilienfeld, PB Neunkirchen, PB Wiener Neustadt (Land), PB Baden (Teil) mit den Gemeinden Altenmarkt an der Triesting, Berndorf, Enzesfeld-Lindabrunn, Furth an der Triesting, Hernstein, Hirtenberg, Pottenstein, Weissenbach an der Triesting AT123 Sankt Pölten SS St. Pölten, PB St. Pölten (Land) AT124 Waldviertel SS Krems an der Donau, PB Gmünd, PB Horn, PB Krems (Land), PB Waidhofen an der Thaya, PB Zwettl AT125 Weinviertel PB Hollabrunn, PB Mistelbach (Teil) mit den Gemeinden Altlichtenwarth, Asparn an der Zaya, Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein, Fallbach, Gaubitsch, Gaweinstal, Gnadendorf, Großharras, Großkrut, Hausbrunn, Herrnbaumgarten, Laa an der Thaya, Ladendorf, Mistelbach, Neudorf bei Staatz, Niederleis, Ottenthal, Poysdorf, Rabensburg, Schrattenberg, Staatz, Stronsdorf, Unterstinkenbrunn, Wildendürnbach, Wilfersdorf, PB Gänserndorf (Teil) mit den Gemeinden Drösing, Dürnkrut, Hauskirchen, Hohenau -

„Malen Ohne Grenzen“ Anlässlich 30 Jahre Fall Des Eisernen Vorhangs (Eine Aktivität Im Veranstaltungskalender Der Kulturabteilung Des Landes Niederösterreich)
„Malen ohne Grenzen“ anlässlich 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs (Eine Aktivität im Veranstaltungskalender der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich) Bis 1989, fast 40 Jahre lang, trennte der sogenannte „Eiserne Vorhang“ Europa. Die March war Teil dieser unüberwindbaren Grenze zwischen Ost und West. Anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs veranstaltete die Region Marchfeld eine mehrtätige Malaktion an der Brücke der Freiheit Schloss Hof- Devínska Nová Ves. An der Aktion „Malen ohne Grenzen“ nahmen österreichische und slowakische SchülerInnen und KünstlerInnen teil. Ziel dieses Projektes war es nicht nur dem Jubiläum Fall Eiserner Vorhang zu gedenken sondern auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken und weiter auszubauen. Im Rahmen dieser Aktion beschäftigten sich die SchülerInnen mit dem Thema Fall Eiserner Vorhang und geschlossenen Grenzen. Gemalt wurde auf slowakischer Seite bei der Brücke Freiheit oder im Klassezimmer. Die bemalten Planen sind auf der Brücke der Freiheit, auf derzeit unbestimmte Zeit, frei zugänglich. Die Region Marchfeld bedankt sich herzlich bei allen beteiligten SchülerInnen, LehrerInnen, DirektorInnen, KünstlerInnen und sonstigen UnterstützerInnen des Projektes. Fakten zum grenzüberschreitenden Projekt „Malen ohne Grenzen“ 400 SchülerInnen nahmen an der Aktion teil 8 KünstlerInnen 59 Planen wurden mit verschiedenen Maltechniken bemalt (2.10m x 1m) Bemalte Gesamtlänge: 124m 2/3 der Kinder aus Österreich und 1/3 der Kinder aus der Slowakei Sieben Schulen aus dem Marchfeld nahmen teil - VS Engelhartstetten - VS Gänserndorf Hort - VS Lassee - VS Weikendorf - VS Leopoldsdorf im Marchfelde - NMS Orth an der Donau - NMS Marchegg Drei Schulen aus der Slowakei - VS Devínska Nova Vés - VS Stupava - VS Záhorská Ves Veranstalter: Region Marchfeld (Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Marchfeld) „Malen ohne Grenzen“ wurde durch die NÖ.Regional.GmbH im Rahmen des Projektes Interreg „ConnReg SK-AT“ aus dem Aktionsbudget unterstützt. -
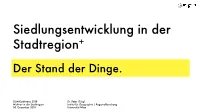
181203 PP Sum-Konferenz Peter
Siedlungsentwicklung in der Stadtregion+ Der Stand der Dinge. SUM-Konferenz 2018 Dr. Peter Görgl Wohnen in der Stadtregion Institut für Geographie | Regionalforschung 05. Dezember 2018 Universität Wien Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion+ Relative Bevölkerungsentwicklung in der SRO+ 2008-15 in Prozent Bevölkerung 2008: 2.587.562 Bevölkerung 2015: 2.763.761 Stadtregion+ +176.199 Wien +126.116 SRO+ Nö./Bgld. +50.083 Quelle: Monitoring der Siedlungsentwicklung in der Stadtregion+ Planungsgemeinschaft Ost 2017 Bevölkerungsveränderung in der SRO+ - 2010 bis 2015 absolute Entwicklung im 1.000m-Raster Stärkstes Wachstum in Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 EinwohnerInnen. Großteil der Entwicklung entlang höherrangiger Verkehrsachsen. Quelle: Monitoring der Siedlungsentwicklung in der Stadtregion+ Planungsgemeinschaft Ost 2017 | S.84 à aus übergeordneter Sicht verlief die Entwicklung bislang an planerisch weitgehend „sinnvollen“ Standorten à aus übergeordneter Sicht verlief die Entwicklung bislang an planerisch weitgehend „sinnvollen“ Standorten à die größeren Gemeinden im Umland urbanisieren sich zunehmend: das eröffnet Chance für städtebaulich und konzeptionell neue Siedlungsprojekte à aus übergeordneter Sicht verlief die Entwicklung bislang an planerisch weitgehend „sinnvollen“ Standorten à die größeren Gemeinden im Umland urbanisieren sich zunehmend: das eröffnet Chance für städtebaulich und konzeptionell neue Siedlungsprojekte à es haben sich, weitgehend ohne (regional)planerisches Zutun, Entwicklungsachsen herausgebildet Suburbanisierung prägt die Stadtregion+ noch immer. Wanderung nach Alter zwischen Wien und dem SRO+ - Umland 2007 und 2014 im Vergleich. 17.861 Menschen zogen 2014 aus Wien ins Umland. 12.746 Menschen zogen 2014 aus dem Umland nach Wien. Quelle: Monitoring der Siedlungsentwicklung in der Stadtregion+ Planungsgemeinschaft Ost 2017 | S.27 à Gemeinden werden die Abwanderung der Jungen Richtung Großstadt nicht aufhalten können, müssen aber dennoch „junges“ | „leistbares“ Wohnen anbieten. -

UMSETZUNGSKONZEPT Klima- Und Energie-Modellregion Marchfeld
UMSETZUNGSKONZEPT Klima- und Energie-Modellregion Marchfeld Projekt-Nr: B870535 ©Klima- und Energiefonds/Barbara Krobath Umsetzungskonzept erstellt von: Energy Changes Projektentwicklung GmbH Wiener Straße 9/5, 3133 Traismauer Dezember 2019 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................. 2 1 Vorwort .................................................................................................................................. 4 1.1 Obmann ............................................................................................................................................... 4 1.2 Vorwort KEM-Managerin .................................................................................................................... 5 2 Hintergrund Klima- und Energiemodellregion ...................................................................... 6 2.1 Förderprogramm ................................................................................................................................. 6 2.2 Organisation ........................................................................................................................................ 7 3 Standortfaktoren Marchfeld .................................................................................................. 8 3.1 Charakterisierung der Region ............................................................................................................. 8 3.2 -

Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA
Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for irrigation Area actually irrigated NUTS1-region NUTS2-region (ha) (ha) Burgenland Ostösterreich 24 790 10 940 Niederösterreich Ostösterreich 79 050 27 520 Wien Ostösterreich 1 770 550 Kärnten Südösterreich 1 040 210 Steiermark Südösterreich 3 570 1 340 Oberösterreich Westösterreich 2 270 720 Salzburg Westösterreich 240 40 Tirol Westösterreich 3 170 2 090 Vorarlberg Westösterreich 150 40 Austria total 116 050 43 450 NUTS1-region Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water Ostösterreich 105 610 89 192 16 418 Südösterreich 4 610 2 143 2 467 Westösterreich 5 830 3 267 2 563 Austria total 116 050 94 602 21 448 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/aut/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for Municipality NUTS3-region Province irrigation (ha) Deutschkreutz Mittelburgenland Burgenland 0 Draßmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Frankenau-Unterpullendorf Mittelburgenland Burgenland 0 Großwarasdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Horitschon Mittelburgenland Burgenland 0 Kaisersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Kobersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Lackenbach Mittelburgenland Burgenland 0 Lackendorf Mittelburgenland Burgenland 3 Lockenhaus Mittelburgenland Burgenland 0 Lutzmannsburg Mittelburgenland Burgenland 8 Mannersdorf an der Rabnitz Mittelburgenland Burgenland 129 Markt Sankt Martin Mittelburgenland Burgenland 0 Neckenmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Neutal Mittelburgenland Burgenland 0 Nikitsch