Forschungen Zur Baltischen Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Russian Art Hôtel Metropole Monaco 27/28/29 October
RUSSIAN ART HÔTEL METROPOLE MONACO 27/28/29 OCTOBER ABOVE: LEVASSOR (MICHEL), THE HISTORY OF LOUIS XIII (LOT 115) FRONT COVER: FOLLOWER OF JOHANN HEINRICH WEDEKIND. PORTRAIT OF EMPRESS CATHERINE I (LOT 68) BACK COVER: SOUVENIR TABLE WITH MEDALLIONS BASED ON ORIGINALS BY V.V. VERESHCHAGIN (LOT 21) Sans titre-1 1 26/09/2017 11:33:03 PAR LE MINISTERE DE MAITRE CLAIRE NOTARI HUISSIER DE JUSTICE A MONACO RUSSIAN PAINTINGS, ENGRAVINGS, MINIATURES, SCULPTURES, MAPS, BOOKS, MANUSCRIPTS, And WORKS OF ART SESSION 1 (lot 1 to 203) FRIDAY OCTOBER 27, 2017 - 18:00 SESSION 2 (lot 204 to 413) SATURDAY OCTOBER 28, 2017 - 14:00 SESSION 3 (lot 414 to 528) SUNDAY OCTOBER 29, 2017 - 14:00 Hotel Metropole - 4 avenue de la Madone - 98000 MONACO GRAND OPENING: THURSDAY OCTOBER 26, 2017 AT 18:00 EXHIBITION FRIDAY OCTOBER 27 11:00 - 17:00 SATURDAY OCTOBER 28 11:00 - 14:00 SUNDAY OCTOBER 29 - 11:00 - 14:00 Inquiries - tel: +377 97773980 - Email: [email protected] 25, Avenue de la Costa - 98000 Monaco Tel: +377 97773980 www.hermitagefineart.com 03 SPECIALISTS AND AUCTION ENQUIRIES Alessandro Conelli Ivan Terny Elena Efremova President C.E.O. Director Contact : Tel: +377 97773980 Fax: +377 97971205 [email protected] Ekaterina Tendil Alexandra Gamaliy Julia Karpova Head of European Head of Business Client Manager Departement Development Design and Research Arthur Gamaliy Nicolas Tchernetsky Viktoria Lapteva Federico Pastrone Jerome Cortade Senior Expert Expert Expert Expert Expert Russian Art Western European Art Numismatics Manuscripts Books Russian Art, Manuscripts XVIII-mid-XX century TRANSPOTATION PHOTOGRAPH Maxime Melnikov LIVE AUCTION WITH 04 We dedicate our first auction to the legacy of Nikolay Nikolayevich Turoverov, the great poet, Cossack officer, man of culture and bibliophile. -

Eesti Mõtteloo Uurimine 21. Sajandil
Acta Historica Tallinnensia, 2020, 26, 145–166 https://doi.org/10.3176/hist.2020.1.06 EESTI MÕTTELOO UURIMINE 21. SAJANDIL Pärtel PIIRIMÄE Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut, Ülikooli 18, 50090 Tartu, Eesti; [email protected] Artikli eesmärgiks on anda ülevaade mõtteloo uurimisest Eestis 21. sajandi esimestel kümnenditel. Et paremini mõista mõtteajaloo või intellektuaalajaloo hetkeseisu, heidetakse artiklis pilk selle eelloole Eestis avant la lettre ehk enne valdkonna distsiplinaarset emantsipeerumist ning vaadeldakse lühidalt valdkonna tähtsamaid arengusuundi mujal maailmas 20. sajandil ja 21. sajandi algul. Sellel taustal eritletakse peamisi meetodeid ja žanre, mida on viimastel aastakümnetel kasutatud mõtteloo uurimisel Eestis, arutletakse eri käsitlusviiside eeliste ja puuduste üle ning võetakse kõne alla võimalikud eda sised uurimisperspektiivid. MÕTTELOO UURIMISTRADITSIOONIST EESTIS Erinevalt mitmest teisest ajaloo valdkonnast – medievistika, sotsiaalajalugu, ma jandusajalugu jt – puudub ideede või mõtteajalool Eestis selgepiiriline identiteet ja pikaajaline uurimistraditsioon, millele praegused uurijad saaksid toetuda või mil lega kriitiliselt suhestuda. 21. sajandi algust võibki pidada mõtteajaloo kui eraldi seisva teadusvaldkonna sünniperioodiks Eestis. See ei tähenda, et Eestis ei oleks mõttelugu varem üldse käsitletud või selle süstemaatilisema uurimise vajadust tead vustatud. Me saame rääkida ajalooliste ideede uurimise vähemalt sajandipikkusest traditsioonist, -

Lisa Reihana's
Lisa Reihana’s T In Pursuit of Venus HE CO N Q U E R O R ’S E Y E KUMU ART MUSEUM 19.09.2019–26.01.2020 Curators: Linda Kaljundi, Eha Komissarov and Kadi Polli Coordinator: Mari Kangur Exhibition design and graphic design: AKSK It is virtually impossible to overestimate the importance of images in the history of colonialism. The start of the colonial conquest of new territories coincided with the invention of the art of printing: Columbus reached America in 1492 and Gutenberg had invented the printing press in the 1440s. The art of printing made the written word accessible to wide audiences, and it also meant an explosion in the spread of images on a global level. The discovery of new continents had turned the understanding of the world as it had hitherto existed upside down. So the public was particularly interested in images depicting unknown lands and their exotic inhabitants. The images not only reflected and described the course of conquests and novel territories and their peoples, but also actively participated in conceptualising these and creating stereotypes of the “Other”, thus contributing to the belief in a radical difference between primitive natives and civilised Europeans. An emphasis on We thank: Lisa Reihana, James Pinker, Eidotech, Liina Siib, Estonian History Museum, Estonian National Museum, Pärnu Museum, Tallinn City Museum, Academic Library of cultural differences helped to justify both the conquests Tallinn University, University of Tartu Museum, University of Tartu Library and Valga and the domination of Europeans over native populations. Museum Thus, images of the colonial territories tellingly highlight the close ties of visual culture with power. -

What Is Estonian Philosophy?
What is Estonian Philosophy? Margit Sutrop Department of Philosophy, University of Tartu e purpose of this article is to inquire what should belong in an encyclopedia arti- cle entitled “Estonian philosophy,” should one ever endeavour to write it. e ques- tion “What is Estonian philosophy?” has two parts. First we have to know what we mean by the concept philosophy and aer that how we would specify Estonian phi- losophy? Relying on a Wittgensteinian approach, I will argue that philosophy is an open concept. Although all philosophical works have some resemblances to other philosophical works, it is impossible to nd criteria characteristic of all the varieties of schools and traditions in which philosophizing is carried out. Philosophy should be understood as a certain social practice. ere can, however, be a large number of dierent practices. I will show that if by Estonian philosophy we have in mind a philosophy that is originally and purely Estonian, then at this point such does not exist. If by Estonian philosophy we mean philosophy created in Estonia, regardless of the practitioners’ ethnicity and the language in which they wrote, the history of our philosophy is very rich and diverse. People of many dierent ethnicities have created philosophy in Estonia, articulating their philosophical ideas in Estonian, English, German, Latin, Russian, and Swedish. And if we broaden our concept of Estonian philosophy to also include the work of philosophers of Estonian extraction living abroad, then one could write quite a respectable article on the topic. Keywords: denition of philosophy, Estonian philosophy, philosophy in Estonia, University of Tartu, family resemblance, open concept, African philosophy, Danish philosophy, Finnish philosophy Õ. -

Andekuse-Geen Ok Autorile
baltisaksa ja eesti suguvõsades m a t i l a a n e baltisaksa ja eesti suguvõsades Ì Kujundanud Janika Vesberg Tekst © Mati Laane, 2013 Fotod © Mari ja Mati Laane, 2013 Reproduktsioonid: Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Kose koguduse arhiiv, autori erakogu ISBN 978–9985–3– Kirjastus Varrak Tallinn, 2013 www.varrak.ee Trükikoda Greif OÜ 4 Sisukord Lugejale ............................................................................................................................................. 8 Eellugu .............................................................................................................................................. 9 Mõisaparkide loojad................................................................................................................... 12 Engelhardt, Oettingen, Sivers, Tigerstedt, Schrenck, Liphart, Bock Baltisaksa kunstnikud................................................................................................................ 29 Üle 60 isiku, sh. 44 aadlikku, 17 mitteaadlikku Baltisakslastest aunimetuse kavalerid .................................................................................. 48 Ungru krahvid .............................................................................................................................. 48 Stael v. Holstein, Wrangell, Orlov, Klinger, Zoege, Pahlen Lievenid .......................................................................................................................................... 60 Kaupo, -

NEEME KÜLM the Sail TÕNIS SAADOJA
22 30 44, 45 46 NEEME KÜLM TÕNIS SAADOJA The Sail 2021. Installation Portraits were the most important genre in Baltic German art. An art collection in the Baltic manor house of the 18 th and 19th centuries typically amounted to a gallery of family portraits. Owing to these portraits, an array of images of the ruling monarchs ERNST HERMANN SCHLICHTING OTTO ZOEGE VON MANTEUFFEL LYDIA VON RUCKTESCHELL PAUL RAUD and the local German-speaking elite has become lodged in the 1812–1890 1822–1889 1858–1936 1865–1930 Estonian cultural memory: portraits of Russian emperors and Birthday The Artist’s Family Portrait of a Man Baroness Natalie von Uexküll senior officials of the imperial court, Baltic barons and intellectuals, 1842. Oil 1850s. Oil 1880s–1890s. Oil 1905–1906. Oil girls of the Biedermeier era, spinsters in bonnets, portraits in Ernst Hermann Schlichting was not only a por - Here, Otto Zoege von Manteuffel has Portrait of a Lady The first Estonian artists also painted portraits domestic interiors and in landscape settings, portraits of families, traitist but also a genre and landscape painter. portrayed himself with his mother and sisters. 1885–1886. Oil of Baltic German nobility, often to express Birthday is one of the few works in Estonian The artist’s late father looks down upon his gratitude to their patrons. Paul Raud studied children and dogs. art that offers a glimpse into the lifestyle and family from the portrait on the wall. Towards the end of the 19 th century, there at the Düsseldorf Academy of Arts, where customs of Baltic Germans. -
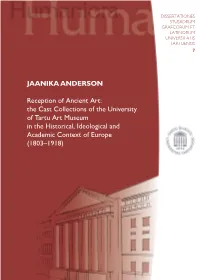
JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient
DISSERTATIONES JAANIKA ANDERSON JAANIKA STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum of Ancient Art: of Tartu the Cast Collections of University Reception JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918) Tartu 2015 ISSN 1406-8192 ISBN 978-9949-32-768-3 DISSERTATIONES STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 DISSERTATIONES STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918) Faculty of Philosophy, University of Tartu This dissertation was accepted for the commencement of the decree of Doctor of Philosophy (Classical Philology) on January 30, 2015 by the Committee of the College of Foreign Languages and Cultures of the University of Tartu. Supervisors: Kristi Viiding, Professor of Classical Philology, Department of Classical Philology, University of Tartu Epi Tohvri, Associate Professor, Department of Technology, Tartu College of Tallinn University of Technology Opponents: Prof. Dr. Lorenz Winkler-Horaček, curator, Institut für Klassische Archäologie der Freien Universität Berlin und Abguss-Sammlung Antiker Plastik, Berlin Dr. Aira Võsa, researcher, Tartu University Library Commencement: on March 20, 2015 at 12.15, in the Senate room of the Uni- versity of Tartu (Ülikooli 18). ISSN 1406-8192 ISBN 978-9949-32-768-3 (print) ISBN 978-9949-32-769-0 (pdf) Copyright: Jaanika Anderson, 2015 University of Tartu Press www.tyk.ee ACKNOWLEDGEMENTS I am very grateful to the people who have directly or indirectly contributed to the completion of this dissertation. -

The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831
The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831 John P. LeDonne OXFORD UNIVERSITY PRESS The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831 John P. LeDonne 1 2004 3 Oxford New York Auckland Bangkok Buenos Aires Cape Town Chennai Dar es Salaam Dehli Hong Kong Istanbul Karachi Kolkata Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi São Paulo Shanghai Taipei Tokyo Toronto Copyright © 2004 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York, 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data LeDonne, John P., 1935– The grand strategy of the Russian Empire : 1650–1831 / John P. LeDonne. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-19-516100-9 1. Russia—Territorial expansion. 2. Russia—History—1613–1917. 3. Imperialism. I. Title. DK43.L4 2003 947—dc21 2002044695 246897531 Printed in the United States of America on acid-free paper Preface must begin with a caution and a plea. Some readers will argue that writing a first Ibook on Russian grand strategy without the benefit of monographs concentrating on specific problems—decision making, for example—is running the risk of writing about the “virtual past.”1 They will argue that what is presented here is nothing but “virtual strategy,” in which the author attributes to the Russian political elite a vision they never had. -
№ 13 – the KITCHEN STAIRCASE 1. Console
№ 13 – THE KITCHEN STAIRCASE 1. Console - table. Germany, early 18th c. 2. Vase. China, 18th c. Brass mount – Europe, 19th c. 3. Mirror. Russia, 4th quarter of the 19th c after the original of Gustave Doret, 1877 4. Unknown artist. Settlement Near the Ford. Holland, 2nd half of the 17th c. 5. Unknown artist. Abraham’s Sacrifice. Germany (?), late 18th c. A copy 6. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 7. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 8. Console – table. A copy from the german original of early 18th c. Latvia, 1981 9. Unknown sculptor. Austrian generalissimo Ernst Gideon von Laudon (?). Latvia, 2nd half of the 18th c. 10. Wallsconces. Copies after the russian18th century pattern 11. Latern. A copy from the18th century lantern in the Kuskovo Palace, Moscow № 70 - THE ANTECHAMBER OF THE GOLD HALL 1. Cartel clock. France, Chateaudun, clockmaker Godeau, 2nd half of the 18th c. 2. Unknown artist, russian school. Elizabeth Petrovna, Empress of Russia. 18th c. 3. Jan de Bray (?). Artemisia. Netherlands, mid of the 17th c. 4. Unknown artist. The Finding of Moses. Flanders, 17th c. 5. Unknown artist. Juno at the Corpse of Argus. Italy, late 17th c. 6. Chairs (10). Germany/Belgium, Aachen-Liège, 18th c. 7. Thomass Huber. Painter Friedrich Wilhelm Weidemann. Germany, 1743 Chandelier. A copy from the original 18th century chandelier in the Kuskovo Palace, Russia № 74 - THE BLUE ROOM 1. Mirror. Germany, 1st quarter of the 18th c. 2. Vase. China, 18th c. 3. Console table. -

The First Buddhist Priest on the Baltic Coast”: Karlis Tennison and the Introduction of Buddhism in Estonia
“THE FIRST BUDDHIST PRIEST ON THE BALTIC COAST”: KARLIS TENNISON AND THE INTRODUCTION OF BUDDHISM IN ESTONIA Mait Talts Abstract: Karlis Tennison(s) is an essential, although controversial figure in the history of Buddhism in Estonia and Latvia. He was, without doubt, the first to disseminate Buddhism in the Baltic countries and also one of the earliest disseminators of Buddhism in Eastern Europe. Karl August Tõnisson, born in 1883 near Põltsamaa, Estonia, later repeatedly changed his biography (for ex- ample, transformed from an Estonian to a Latvian and simultaneously became ten years older). The article focuses on the development of his ideas. All his books and other publications, which are modest in volume and usually self-published, were is- sued between 1909–1916 and 1925–1930. The development of his views can be divided into three main periods: the pre-Buddhist period (before 1911); the ‘theosophical Buddhist’ period (1911–1916) and the period of ego-Buddhism or neopaganism (1925–1930). Around 1910–1911 Tennison ultimately converts to Buddhism. As he did not identify with any particular school, we may call him an ‘abstract’ Buddhist. In 1925 Tennison published a book in Latvian and from 1928 to 1930 three books in Estonian. In the publications of this period, Tennison retreats from the principles of Buddhism and allots more space to the glorifica- tion of his own personality and to criticism of Christianity, which was typical of neopaganism popular in Europe at the period. One of the most peculiar ideas in Tennison’s books is that of the Pan-Baltonian Empire. In that period Tennison also began to disseminate his view that Estonians’, Latvians’ and Lithuanians’ pre-Christian beliefs were somewhat similar to the religious and philosophical systems of India in the Vedic period, which, in the present-day world, are repre- sented in their purest form in Buddhism. -

The River Avijõgi, the River Tagajõgi, the River Pada and the River Pühajõgi
The River Avijõgi, the River Tagajõgi, the River Pada and the River Pühajõgi Tartu–Kuru 2010 Publication is supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism Rivers with Limited Conservation Areas in Virumaa 1 The River Avijõgi, the River Tagajõgi, the River Pada and the River Pühajõgi © Keskkonnaamet Compilers: Eva-Liis Tuvi and Anne-Ly Feršel Editor: Ann Marvet Translated by Mall Leman and Gordon Allan Leman Cover photo: The River Avijõgi. Enn Käiss Photos: Anne-Ly Feršel, Eva-Liis Tuvi, Estonian History Museum, Estonian National Museum, Virumaa Muuseumid/Museums of Virumaa, Avinurme Museum, Tudulinna local lore room, Viru-Nigula local lore museum, private collections Design and layout: Irina Tammis / Akriibia OÜ Printed: Actual Print ISBN 978-9949-9057-3-7 Contents Introduction 5 Rivers as arteries of landscapes 7 Protected natural objects 7 Laws protecting the bodies of water 9 Rivers in the ecological network 10 The River Avijõgi 17 From the edge of the Pandivere Upland through the woods of Alutaguse to Lake Peipsi 20 Biota rich in rare species 22 Human habitation on the banks of the River Avijõgi 27 The River Tagajõgi together with the River Pungerja 53 Biota in the river and on the shores of the Tagajõgi 7 Human habitation on the banks of the River Tagajõgi 62 Protection of the River Tagajõgi and the landscapes in the vicinity 88 The River Pada 92 The river’s journey on the limestone plain, and breaking through the limestone cliff 92 The biota has so far not been studied enough 100 Human habitation on the banks of the River Pada 103 Protection of the River Pada and the landscapes in the vicinity 122 The River Pühajõgi 125 Biota in the past and present, hopes for the future 133 Through the ancient settlement sites 137 Protection of the River Pühajõgi and the landscapes in the vicinity 153 Reference literature 156 1. -

Imagining Europe, Imagining the Nation Estonian Discussion on European Unification, 1923–1957
YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. B OSA - TOM. 335 HUMANIORA Imagining Europe, Imagining the Nation Estonian Discussion on European Unification, 1923–1957 by Pauli Heikkilä TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU Turku 2011 From the Department of Political Science and Contemporary History, University of Turku, Finland Supervised by Timo Soikkanen, Dr.Soc.Sc. Professor of Contemporary History, University of Turku, Finland Reviewed by Andres Kasekamp, PhD Professor of Baltic Politics, University of Tartu, Estonia Pertti Grönholm, PhD Docent, General History, University of Turku, Finland Dissertation opponents: Andres Kasekamp, PhD Professor of Baltic Politics, University of Tartu, Estonia Pertti Grönholm, PhD Docent, General History, University of Turku, Finland ISBN 978-951-29-4635-8 (PDF) ISSN 0082-6987 “See, mida Euroopa tähendas kunagi meile, “What Europe ever meant for us before, sel polegi tähtsust: see oli ju kunagi eile.” it doesn't matter: it was already yesterday.” J.M.K.E. (Villu Tamme): Õhtumaa viimased tunnid (2000) 4 5 TIIVISTELMÄ Pauli Heikkilä Kuvitella Eurooppaa, kuvitella kansaa. Virolainen keskustelu Euroopan yhdentymisestä 1923–1957 Politiikan tutkimuksen laitos, poliittisen historian oppiaine, Turun yliopisto Annales Universitatis Turkuensis, Turku 2011 Väitöstutkimus valottaa Euroopan yhdentymisen historiaa viime vuosisadan alkupuoliskolla. Tuona aikana virolaiset näkivät yhdentymisessä keinon tehostaa kansallisvaltionsa itsenäisyyttä ja – vuodesta 1940 lähtien – palauttamista. Englanninkielinen