Insek 2018.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
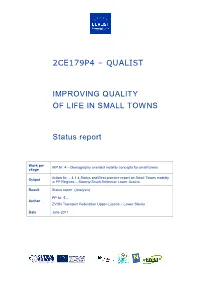
2Ce179p4 – Qualist Improving Quality of Life in Small
2CE179P4 – QUALIST IMPROVING QUALITY OF LIFE IN SMALL TOWNS Status report Work pa- WP Nr. 4 – Demography oriented mobility concepts for small towns ckage Action Nr. – 4.1.4 Status and Best practice report on Small Towns mobility Output in PP Regions – Saxony/South Bohemia/ Lower Austria Result Status report (Analysis) PP Nr. 5 – Author ZVON Transport Federation Upper-Lusatia – Lower Silesia Date June 2011 Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Preliminary remarks This “Small Towns Mobility Status Report in the PP-regions” grew out of two sub-reports: - Small towns mobility status Report (data collection, analysis of regional small towns mobility status reports, development of report for all RR regions incl. Best best practices) Responsible: Saxony Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport - Mobility Report (Status and Best practice report on Small towns in the PP regions) Responsible: Transport Federation Upper-Lusatia – Lower- Silesia (ZVON) The editorial process was carried out by the consulting engineers - LUB Consulting GmbH, Dresden - ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden 2CE179P4 - QUALIST Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Index 1 Introduction................................................................................ 1 2 Brief description of study area.................................................... 2 2.1 Saxon Vogtland .................................................................. -

Terminübersicht Schadstoffmobil
Terminübersicht Schadstoffmobil Die mobile Schadstoffsammlung erfolgt im Frühjahr und im Herbst. Hierbei ist zu beachten, dass die Standplätze nicht zweimal angefahren werden, sondern lediglich zeitlich versetzt. Dies ermöglicht eine mehrmalige Abgabe von Schadstoffen an nahe gelegenen Standplätzen. Zur besseren Übersicht wurde in der folgenden Auflistung auch auf Ortsteilnamen zurückgegriffen. Frühjahrstour Ort Standort Datum Standzeit Adorf Parkplatz am Schützenhaus 04.05.2021 14:30 – 15:30 Adorf Bahnhof 04.05.2021 15:45 – 16:30 Altmannsgrün Standplatz Wertstoffcontainer, gegenüber Betriebsheim 16.04.2021 13:45 – 14:15 Auerbach Parkplatz Zeppelinstraße 17.04.2021 08:30 – 09:15 Auerbach Standplatz Werstoffcontainer, A.-Schweitzer-Str. 17.04.2021 09:30 – 10:15 Auerbach Standplatz Werstoffcontainer, Siegelohplatz 17.04.2021 10:30 – 11:00 Bösenbrunn Gutshofschenke Parkplatz 03.05.2021 14:30 – 15:00 Breitenfeld Standplatz Wertstoffcontainer, Feuerwehr / Sportplatz 06.05.2021 13:00 – 13:30 Brockau Kirchplatz 30.04.2021 17:30 – 18:00 Coschütz Standplatz Wertstoffcontainer, Friedensstraße 30.04.2021 16:00 – 16:30 Cunsdorf (bei Elsterberg) Standplatz Wertstoffcontainer 29.04.2021 13:00 – 13:30 Dehles Dorfring 27.04.2021 13:30 – 13:45 Demeusel Dorfplatz 28.04.2021 14:30 – 15:00 Dorfstadt Ziegengasse 15.04.2021 13:45 – 14:15 Drochaus Dorfplatz 28.04.2021 13:45 – 14:15 Droßdorf Standplatz Wertstoffcontainer 05.05.2021 14:30 – 15:00 Elsterberg Parkplatz ehem. Lederfabrik / Bahnhofstraße 29.04.2021 15:15 – 16:00 Elsterberg Standplatz Wertstoffcontainer, -

Haus in Klingenthal Zu Verkaufen Aus Altersgründen Verkaufen Wir Unser Eigenheim Mit Dem Dazugehörigen Nebengebäuden
10. Juli 2019 Adorfer Seite 1 Stadtbote Monatlich kostenlos für jeden Haushalt Nummer 7 · 10. Juli 2019 Redaktion: Frau Schmidt 03 74 23/5 75 14 · [email protected] · Anzeigen: 03 74 67/289823 · [email protected] Danke an das Ehrenamt Ehrung „Verdienter Bürger der Stadt fert-Schmidt im Rathaus während Zum Beispiel bei der Mithilfe in auf diesem Wege allen Engagier- Adorf/Vogtl.“ Frist für Einreichung der der allgemeinen Öffnungszeiten Heimatvereinen, bei der Behinder- ten, die ihre Zeit und Energie Vorschläge läuft noch bis 31.07.2018 eingesehen oder unter www.adorf- ten- und Altenpflege, als Trainer ohne Vergütung zum Wohle an- Auch in diesem Jahr wollen wir vogland.de abgerufen werden. in Sportmannschaften, als Natur- derer einbringen gedankt und wieder bürgerschaftliches Engage- Alle Bürger Adorfs und den Orts- schutz- oder Nachbarschaftshelfer, Wertschätzung entgegengebracht ment, Bürger/ Bürgerinnen, die sich teilen sind daher aufgerufen, Vor- als Helfer bei der Unterstützung werden. Sie habenBild einen 1 Anspruch um unsere Stadt verdient gemacht schläge einzureichen. Diese sind in von schulischer Bildung und Erzie- auf die Sächsische Ehrenamtskarte, haben, ehren. Es sollen wieder ein wenn Sie bereits mindestens 1 Jahr bis zwei Bürger/Bürgerinnen diese regelmäßig ehrenamtlich tätig Auszeichnung erhalten. sind, mindestens 14 Jahre alt sind Vorschläge für die Auszeichnung und Ihren Wohnsitz, gewöhnlicher können sowohl von Vereinen, In- Aufenthalt oder den Ehrenamts- stitutionen und Privatpersonen, als Einsatzort im Freistaat Sachsen auch dem Bürgermeister oder dem haben. Ehrenamtliches Engage- Stadtrat eingereicht werden. ment kann z.B. die Tätigkeit in Die Kriterien bzw. die Leitlinien für Sportvereinen, als Bürgerbusfahrer, die Ehrung können bei Ulrike-Sei- bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Kirchgemeinde oder in der SOMMER-HITS! Landschaftspflege bedeuten. -

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Master’s Thesis Breaking Down Barriers: Euroregional Cooperation of the Czech Republic Author: Bc. Karen Benko Subject: IEPS Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D Academic Year: 2013/2014 Date of Submission: May 14, 2014 Declaration of Authorship I hereby declare that this thesis is my own work, based on the sources and literature listed in the appended bibliography. The thesis as submitted is 130,962 keystrokes long including spaces, i.e. 51 manuscript pages excluding the initial pages, the list of references and appendices. Prague, 14.05.2014 Bc. Karen Benko 2 Acknowledgement I would like to express my gratitude to my supervisor, PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D, for her guidance during the writing process. 3 Abstract: Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four – Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech- Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) – have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. -

541 / 544 Gera Hbf
Gera Hbf. - Greiz - Weischlitz -Bad Brambach - Cheb 541 / 544 Plauen ob. Bf. Zug RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RE RB 82851 82751 82401 82601 82753 82901 82403 82603 82903 82755 82405 82605 82905 4504 82757 km … … … … … … … … … … … … … … … 0,0 Gera Hbf. ... ... ... ... 5.00 ... 6.00 ... 7.00 8.00 ... ... 9.00 10.00 ... ... ... 1,7 Gera Süd ... ... ... ... 5.03 ... 6.03 ... 7.03 8.03 ... ... 9.03 10.03 ... ... ... 4,4 Gera Ost ... ... ... ... 5.07 ... 6.07 ... 7.07 8.07 ... ... 9.07 10.07 ... ... ... 5,9 Gera-Liebschwitz ... ... ... ... 5.10 ... 6.10 ... 7.10 8.10 ... ... 9.10 10.10 ... ... ... 8,4 Wünschendorf (E) Nord ... ... ... ... 5.13 ... 6.13 ... 7.13 8.13 ... ... 9.13 10.13 ... ... ... 11,3 Wünschendorf (Elster) ... ... ... ... 5.16 ... 6.16 ... 7.16 8.16 ... ... 9.16 10.16 ... ... ... 20,1 Berga (Elster) ... ... ... ... 5.29 ... 6.29 ... 7.29 8.29 ... ... 9.29 10.29 ... ... ... 25,9 Neumühle (Elster) ... ... ... ... 5.35 ... 6.35 ... 7.35 8.35 ... ... 9.35 10.35 ... ... ... o ... ... ... ... 5.41 ... 6.41 ... 7.41 8.41 ... ... 9.41 10.41 ... ... ... 32,5 Greiz ... ... ... ... 5.43 ... Þ6.43 ... 7.43 ... ... ... 9.43 ... ... ... ... 35,4 Greiz-Dölau ... ... ... ... 5.46 ... å6.46 ... 7.46 ... ... ... 9.46 ... ... ... ... 37,7 Elsterberg ... ... ... ... 5.50 ... å6.50 ... 7.50 ... ... ... 9.50 ... ... ... ... 38,8 Elsterberg Kunstseidenw. ... ... ... ... 5.52 ... å6.52 ... 7.52 ... ... ... 9.52 ... ... ... ... 42,6 Rentzschmühle ... ... ... ... 5.56 ... å6.56 ... 7.56 ... ... ... 9.56 ... ... ... ... 44,8 Barthmühle ... ... ... ... 5.58 ... å7.00 ... 7.58 ... ... ... 9.58 ... ... ... ... 51,5 Plauen (V)-Chrieschwitz ... ... ... ... 6.05 .. -

Sitzungsberichte Und Abhandlungen Der Naturwissenschaftlichen
! © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at 126 Nachträge zu dem Standorts -Verzeichnisse der 1875/1876 bekannt gegebenen Arten. 3. Pinus montana Mill. a. obliqua Saut. (P. uncinata Bam.) Mooriges Haide- land bei Breitenfeld und bei Hermsgrün bei Adorf (Beck). Bei Adorf auch angepflanzt (Beck), ebenso im Staatswalde bei Mehltheuer!! (c.) — Strobus L. Starke Exemplare im Schlossgarten zu Schilbach (Schneider). 8. Lemna polyrrliiza L. Bei Greiz, Schönfeld und Gottesgrün (Ludwig). Bei der Tennera bei Plauen!! 11. Potamogeton alpinus Balb. (P. rufescens Schrad.) Zwischen Bodau und Schönberg bei Mühltrofiü Im alten Elsterbette bei Weischlitzü In der Weida bei Oberreichenau!! In einem Teiche an der Strasse von Haltestelle Neundorf nach Unterneundorf!! Im Grenzbach zwischen Sachsen und Beuss bei Cunsdorf bei Elsterberg!! Kommt in zwei Formen vor: a. fluviatilis m. in fliessenden "Wässern, b. stagnatilis m. in Teichen. Beide Formen unterscheiden sich im Habitus wesentlich. .Die erste Form ist schlanker, besitzt längere Internodien und schmälere Blätter und sind die lederartigen, schwimmenden Blätter vorhanden, welche bei der Teichform vollständig fehlen. Diese erscheint viel robuster und erhält insbesondere in Folge der lange Zeit erhaltenen, stark entwickelten Gelenkscheiden ein ganz anderes Aussehen wie die Flussform. 12. — gramineus L. In Mühlhausen bei Markneukirchen (Vogel). 13. — lucens L. Zwischen Oelsnitz und Schönbrunn (Simon). 14. — crispus L. In Teichen in und bei Unterneundorf!! Im Wiesenbach vor Mühltroffü In der Elster bei Barthmühle!! Greiz: bei Unter- Grochlitz (Ludwig). 15. — pusülus L. Im Triebitzbach bei Elsterberg ! 16. Triglochih palustris L. Bei Dröda (Weise)!! 18. Sagittaria sagittifolia L. In einem Teiche und in der Elster bei Mösch- witz!! Greiz: in der Elster bei Dölau, Bothenthal, Neumühle und Lehnamühle (Ludwig). -

Bekanntmachung Der Beschlüsse Des Stadtrates Bad Elster
Jahrgang 2016 Montag, den 18. Januar Nummer 1 Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates Bad Elster Der Stadtrat der Stadt Bad Elster fasste in seiner Sitzung am Beschluss Nr. 126/2015: 1. Der Stadtrat der Stadt Bad Elster beschließt die Einrichtung eines Mittwoch, dem 16. Dezember 2015 Jugendtreffs im Vereinsheim des Kleintierzüchtervereins Bad Els- ter e.V. folgende Beschlüsse: 2. Hierzu beschließt der Stadtrat mit dem Kleintierzüchterverein Bad Elster e.V. vorliegende Nutzungsvereinbarung abzuschließen. Öffentliche Sitzung: Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen Beschluss Nr. 124/2015: 4. Stadtrat Sally Alexander Saling (SPD) Bestätigung der Tagesordnung der 24. öffentlichen Sitzung am - Niederlegung des Mandats 16.12.2015. Beschluss Nr. 127/2015: Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen Der Stadtrat der Stadt Bad Elster stimmt dem Antrag auf Niederle- gung des Mandats aus beruflichen Gründen von Herrn Stadtrat Sally 1. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse Alexander Saling (SPD) mit sofortiger Wirkung gemäß § 18 Abs. 1 • In der 23. Sitzung am 25.11.2015 wurden folgende Beschlüsse in und 2 SächsGemO zu. nichtöffentlicher Sitzung gefasst: Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen - Bestätigung der Tagesordnung 1 x befangen (Herr Saling, SPD) - Ablehnung der Vereinbarung über die Umsetzung der Richtlinie Digitale Offensive Sachsen mit dem Vogtlandkreis 5. Sonstiges - Beschluss zum eigenverantwortlichen Ausbau im Bereich Breit- Unter -

Weihnacht! Licht, Freude Und Hoffnung – Nicht Nur
12. Dezember 2018 Adorfer Seite 1 Stadtbote Monatlich kostenlos für jeden Haushalt Nummer 12 · 12. Dezember 2018 Redaktion: Frau Geipel 03 74 23/5 75 28 · [email protected] · Anzeigen: 03 74 67/289823 · [email protected] Nächster Stadtbote: 16. Januar 2019 Weihnacht! Licht, Freude und Hoffnung – Redaktionschluss: 9. Januar 2019 nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern auch für das neue Jahr. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Adorf allen Helfern und Spendern recht und unserer Ortsteile, liebe Gäste! herzlich danken. Damit konnte Die Adventszeit stimmt uns auf manchem Betroffenen ein Stück Weihnachten ein. Die tägliche Hek- Lebensqualität zurückgegeben tik lässt es uns bisweilen schwerfal- werden. Aber auch viel Neues ist in len, vom anstrengenden Arbeitsall- diesem Jahr wieder entstanden. Der tag abzuschalten. Anbau an das Feuerwehrdepot für Dennoch, Weihnachten ist die unser neues Fahrzeug, der grund- Zeit der Ruhe und Besinnung, hafte Straßenausbau am Hangweg, des Innehaltens, des Rückblickens die Renaturierung des Dorfbaches und der Einstimmung auf die in Freiberg, die Neugestaltung der schönste Zeit des Jahres. Die Fa- Pflaumenallee, der Kunstrasenplatz milien rücken näher zusammen mit Kurzstreckenlaufbahn und und genießen die Besinnlichkeit. Weitsprunganlage an der Elster- In meiner Person als Bürgermeister straße sind nur einige erkennbare und für meine Verwaltung kann Beispiele. Einen weiteren Dank ich sagen, das Jahr 2018 wird mit möchte ich an dieser Stelle an alle seinen Höhen und Tiefen sicher in unsere Sponsoren, ehrenamtlich tä- die Geschichte Adorfs eingehen. tigen Bürgerinnen und Bürger und Die Höhepunkte des Jahres wa- natürlich an unsere Vereine für ihr ren mit Sicherheit unser Tag der tatkräftiges Zusammenwirken zum Vogtländer und die 725-Jahr-Feier. -

Hallenfußball-Pokal
FSV BAU Weischlitz Saisonbilanz 2018/19 Sparkassen-Vogtlandklasse 5. Platz – Sparkassenvogtlandklasse (Kreisliga A) Zuschauer: 2025 / Ø 78 – Heim: 1113/ Ø 86 – Auswärts: 912 / Ø 70 26 Spiele – 12 Siege – 5 Remis – 9 Niederlagen – 48:39 Tore – 41 Punkte. Fair-Play-Wertung: 5. Rang – 51 Punkte (Karten: gelb 45; gelb-rot 2; rot 0) Abschlusstabelle Pl. Verein Sp g u v T Diff. Pkt. 1. BC Erlbach 26 18 5 3 78:25 53 59 2. SG Jößnitz 26 18 4 4 72:26 46 58 3. VFC Adorf 26 14 5 7 42:36 6 47 4. SG Stahlbau Plauen 26 14 4 8 52:41 11 46 5. FSV BAU Weischlitz 26 12 5 9 48:39 9 41 6. SpVgg 1862 Neumark 26 12 5 9 42:43 -1 41 7. SV Concordia Plauen 26 10 5 11 59:56 3 35 8. SV Merkur Oelsnitz 2 (N) 26 10 5 11 48:54 -6 35 9. SpVgg Grünb./Falkenst. 26 9 8 9 32:29 3 34 10. SG Kürbitz (N) 26 9 5 12 42:43 -1 32 11. SpVgg Heinsdorfergrund (N) 26 9 5 12 45:48 -3 32 12. VfL Reumtengrün 26 6 3 17 31:72 -41 21 13. SV Coschütz (N) 26 6 2 18 36:75 -39 20 14. Reichenbacher FC 2 26 2 3 21 27:67 -40 9 Wernesgrüner Kreispokal 2. Hauptrunde: 1 Spiel – 1 Niederlage – 1:3 Tore Freie Presse – Hallenfußball-Pokal Vorrunde, Gr. A: 41. Platz von 48 Mannschaften 4 Spiele – 1 Sieg – 0 Remis – 3 Niederlagen – 3:14 Tore – 3 Punkte Trainer: Enrico Kiefl; Co-Trainer: Andreas Schaller Mannschaftsbetreuer: Benjamin Deeg Weischlitz in der Vogtlandklassen-Saison 2018/19 Mit Platz fünf die Erwartungen übertroffen Trainer Enrico Kiefl ist stolz auf sein Team – sein Resümee Bombastische Hinrunde war der Grundstock „Als ich mit Saisonbeginn den FSV übernahm, konnte ich mich vorher in zwei Spielen meines damaligen Vereins Fortuna Plauen gegen den FSV (Saison 2017/2018) schon vom Potenzial der Mannschaft überzeugen (Anmerkung: die Mannschaft des Aufstiegstrainers gewann mühevoll das Heimspiel 1:0/91. -

Waldbad Adorf/Vogtl
A72 169 Auerbach/V. PLAUEN 169 EINTAUCHEN IN DIE NATUR Ponoření se do Přírody Falkenstein Das Waldbad Adorf/Vogtl. liegt Lesní koupaliště Adorf/Vogtl. se idyllisch am Waldrand, unmit- nachází idylicky na okraji lesa A72 283 Oelsnitz/V. telbar neben den beliebten Aus- v bezprostřední blízkosti dvou Schöneck/V. Klingenthal flugszielen „Miniaturschauanlage oblíbených výletních cílů „Parku B92 Klein-Vogtland“ und „Botanischer miniatur Klein-Vogtland“ a „Bota- Garten“. nické zahrady“. ADORF/V. Kraslice Nach der umfassenden Sanierung Po rozsáhlé rekonstrukci v letech Markneukirchen HOF 2019/2020 verwöhnt das Wald- 2019/2020 nabízí lesní koupaliště Hranice Bad Elster bad seine Besucher mit einer svým návštěvníkům plavecký Luby erstklassigen Wasserqualität in bazén s prvotřídní kvalitou Doubrava einem Schwimmbecken, einem vody, solárně vyhřívaný bazén Plesná A72 solarbeheizten Nichtschwimmer- pro neplavce a brouzdaliště pro Aš becken und einem Babybecken. nejmenší. TSCHECHIEN Skalná Eine große Rutsche, ein Sprung- Velká skluzavka, skokanská věž, Vojtanov turm, Strömungskreisel, Massage- divoká řeka, masážní trysky a Anschrift | adresa: düsen und ein toller Wasserspiel- skvělé vodní hřiště zvou naše Hazlov Waldbad Adorf/Vogtl. platz laden unsere großen und malé i velké návštěvníky na ne- Františkovy Lázně Waldbadstraße 5 kleinen Badegäste zu unvergessli- zapomenutelnou zábavu při hraní 08626 Adorf/Vogtl. chem Spiel- und Badespaß ein. a koupání. Sportliche Naturen vergnügen Sportovní nadšenci si mohou po CHEB WaldbadADORF/VOGTL. sich nach dem Schwimmen beim plavání zahrát plážový volejbal Beachvolleyball oder an den nebo stolní tenis. Ti nejmenší se B ade Tischtennisanlagen. Die Kleinsten mohou vyřádit na atraktivním ÖFFNUNGSZEITEN OTEVÍRACÍ DOBA spa ß f ür d ie können sich auf dem attraktiven dětském hřišti. ie ganze Famil Das Waldbad ist von Lesní koupaliště je otevřeno od Kinderspielplatz austoben. -

Aus Der Geschichte Des Vogtlandkreises
Aus der Geschichte des Vogtlandkreises Das Vogtland ist ein geographischer Begriff und war nur für kurze Zeit ein politisches Gebilde. Es war unmittelbarer Teil des mittelalterlichen deutschen Reiches. Die Herren von Weida, Plauen und Gera (später "Vögte") konnten sich von Reichsministerialen zu eigenständigen Landesherren entwickeln. Spätestens seit Mitte des 16. Jahrhunderts aber gehören Teile des Vogtlandes zu Thüringen, Böhmen, Bayern und der größte Teil des Vogtlandes (entspricht etwa dem heutigen Vogtlandkreis) zu Sachsen. seit dem 8. Jahrhundert Slawische Besiedlung des Vogtlandes 919 Königswahl Heinrichs I. Gründung des Ersten Deutschen Reiches ; das Vogtland lag noch außerhalb des Reiches, dessen Ostgrenze Saale und Elbe bildeten. 12. Jahrhundert Ausbau des Reichsterritoriums zwischen Altenburg, Eger (Cheb) und Nürnberg durch Stauferkönig Konrad III. und vor allem Friedrich I., Barbarossa - Entstehung des Pleißen-, Eger- und Vogtlandes sowie des Reichslandes um Nürnberg als Reichslehen - Einsatz von Reichsministerialen, wie die Herren von Weida, welche die bäuerliche Besiedlung im Vogtland maßgeblich förderten 1209 Teilung der Herren von Weida in drei Linien (Weida, Greiz, Gera-Plauen); Diese und spätere Teilungen führten zu gegenseitiger Zerrüttung und Schwächung, woraufhin Herrschaftsteile verpfändet oder verkauft werden mussten. Erstmalige Nennung des Titels "advocatus" (Vogt). um 1250 Niedergang der Staufer und Verfall der Reichsgewalt, wodurch bisher abhängige Lehnsleute (Reichsministeriale) zu selbständigen Landesherren -

125 JAHRE STRASSENBAHN 1894–2019 Die Geschichte Der Straßenbahn in Plauen
[vischelant: schlau seine Das Magazin des Verkehrsverbundes Vogtland Chance entdecken und nutzen, wach sein und wachsam, eifrig, vor- wärtsstrebend, clever] NR.15 ISCHELANTDAS VOGTLAND ERFAHREN SOMMER 2019 GEWINNEN! zwei Chroniken der EGRONET Plauener Straßenbahn und fünf vcm+-Chipkarten Auf zum Dreischienengleis mit je 10 € Guthaben Mit dem EgroNet-Ticket in die Robert-Schumann-Stadt Zwickau 125 JAHRE STRASSENBAHN 1894–2019 Die Geschichte der Straßenbahn in Plauen SERVICETELEFON: 03744·19449 1 SERVICE vcm+ Letzte Möglichkeit zum Tauschen Wo kann die alte Nur noch bis zum 30.06.2019 können die alten kontakt- vcm+-Karte getauscht behafteten vcm-Chipkarten werden? getauscht bzw. zurück- gegeben werden. Der Chipkarten-Tausch ist bei folgenden neue vcm+-Chipkarte Fahrscheinverkaufsstellen, Agenturen und Verkehrsunternehmen möglich: Holen Sie sich die neue vcm+-Chipkarte und profitieren Sie von unserem attraktiven Rabatt. Denn mit der vcm+ erhalten Sie bis zu 28 % Rabatt • Informations- und Servicecenter auf den Einzelfahrschein Erwachsener. der Tourismus- und Verkehrszentrale Auch Einzelfahrscheine für Kinder oder Vogtland in Auerbach, Göltzschtal- Tiere sowie die Tageskarte für eine straße 16 Person können Sie mit der vcm+ bezahlen. • Informations- und Servicecenter der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland in Plauen im oberen Bahnhof • Servicepunkt der Plauener Straßenbahn alte vcm- in Plauen am Tunnel Karten- generation • Reisebüro Herold’s Reisen ! in Klingenthal, Auerbacher Straße 11 Die alten kontaktbehafteten vcm-Chipkarten können • Reisebüro RVB-Touristik Gerlach GmbH zukünftig nicht mehr für den in Reichenbach, Albertistraße 11 Fahrscheinerwerb genutzt werden. • Plauener Omnibusbetrieb, Betriebshof in Plauen, Friedrich-Eckert-Straße 3 2 VISCHELANT I SOMMER 2019 2 EDITORIAL INHALT SERVICE ........................................................................................... 2 Liebe Leserinnen und Leser, NEUES aus den Verkehrsbetrieben ..................................