Irene Asplin Matrikelnummer: 0210061002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kärnten Vielseitig | Pestra Koroška Carinzia VERSATILE | Carinthia DIVERSE
EDWIN STRANNER CHRISTIAN LEHNER KÄRNTEN VIELSEITIG | Pestra KORoška CARINZIA VERSATILE | CARINTHIA DIVERSE Edwin Stranner (Fotos | Fotografije | Foto | Images) Christian Lehner (Texte | Besedila | Testi | Texts) Kärnten vielseitig Pestra Koroška Carinzia versatile Carinthia diverse Titelbild | Slika na naslovni strani | Illustrazione di copertina | Cover picture: Pörtschach am Wörthersee | Poreče ob Vrbskem jezeru | Pörtschach am Wörthersee | Pörtschach am Wörthersee Dom zu Gurk | Bazilika v Krki | Duomo di Gurk | Gurk Cathedral Übersetzungen | Prevodi | Traduzioni | Translations: Schweickhardt Das Übersetzungsbüro, Klagenfurt/Celovec Lektorat | Urednik | Redazione | Editing: Susanne Gudowius-Zechner Grafik, Layout & Satz | Grafična priprava in prelom | Grafica, layout & impaginazione | Graphics, layout & typesetting: typedesign Grimschitz, Klagenfurt/Celovec Druck | Tisk | Stampa | Printing: BUCH THEISS GmbH, St. Stefan i. Lavanttal © Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt/Celovec 2020 ISBN 978-3-7084-0638-1 Printed in Austria Inhalt | Kazalo | Contenuto | Content 6 Einleitung | Uvod | Introduzione | Introduction 9 Oberkärnten | Zgornja Koroška | Alta Carinzia | Upper Carinthia 64 Mittelkärnten | Srednja Koroška | Carinzia centrale | Central Carinthia 114 Zentralraum Kärnten | Osrednja Koroška | Area centrale della Carinzia | Carinthian central region 174 Unterkärnten | Spodnja Koroška | Bassa Carinzia | Lower Carinthia 228 Die Autoren | Avtorja | Gli autori | The authors Zentralraum Kärnten Osrednja Koroška Area centrale della Carinzia Carinthian -

Zur Biotopausstattung Des Kärntner Zentralraumes 479-486 Carinthia II N 206./126
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 206_126 Autor(en)/Author(s): Kirchmeir Hanns, Jungmeier Michael, Köstl Tobias Artikel/Article: Zur Biotopausstattung des Kärntner Zentralraumes 479-486 Carinthia II n 206./126. Jahrgang n Seiten 479–486 n Klagenfurt 2016 479 Zur Biotopausstattung des Kärntner Zentralraumes Von Hanns KIRCHMEIR, Michael JUNGMEIER & Tobias KÖSTL Zusammenfassung Schlüsselwörter In den Jahren 2009 bis 2013 wurde für die 40 Gemeinden der Bezirke Klagenfurt, Vegetation, Bio top- Klagenfurt-Land, Villach und Villach Land ein Biotopkataster nach den Richtlinien der erfassung, Natur- Kärntner Landesregierung erstellt. Damit kann erstmals ein vollständiges Bild der schutz, Kärnten, Biotopausstattung der offenen Kulturlandschaften des Zentralraumes gezeichnet Österreich werden. Insgesamt sind 25.324 Biotope mit einer Gesamtfläche von 18.500 ha erfasst und im Kärnten Atlas verfügbar gemacht. Der hohe Anteil schützenswerter Flächen Keywords stellt in Anbetracht der hohen Entwicklungsdynamik des Zentralraumes eine beson- Vegetation, biotop dere naturschutzfachliche Herausforderung dar. Als erster Schritt soll die Auswer- mapping, nature tung der Datensätze vorgenommen werden. conservation, Carinthia, Austria Abstract During the years 2009 to 2013 a habitat register referring to the standards of the Government of Carinthia was elaborated for 40 municipalities of the districts Klagen- furt, Klagenfurt Land, Villach und Villach Land. For the first time this allows for drawing a comprehensive picture on the distribution of habitats in the open landscapes of the Carinthian central region (“Zentralraum”). All in all, 25.324 habitats with an overall acreage of 18.500 ha were mapped and made available in the digital atlas of Carinthia. -

Gebietsaufteilung Bauleiter Ab 2018
Gebietsaufteilung Bauleiter ab 2018 Heiligenblut Rennweg am Katschberg Mallnitz Malta Reichenfels Friesach Metnitz Grosskirchheim Flattach Bad St.Leonhard Preitenegg Hüttenberg im Lavantal Obervellach Krems in Kärnten Micheldorf Mörtschach Strassburg Guttaring Glödnitz Trebesing Stall Reisseck St.Veit an der Glan Gmünd Deutsch- Frantschach - Sankt Weitensfeld Althofen Wolfsberg Reichenau Griffen Klein St.Paul Gertraud Winklern im Gurktal Spittal an der Drau Lurnfeld Gurk Mölbling Rangersdorf Mühldorf Kappel Lendorf Bad Seeboden Albeck am Kleinkirchheim Krappfeld Sachsenburg Millstatt Radenthein Wolfsberg Feldkirchen Frauenstein Baldramsdorf Eberstein Gnesau Steuerberg Kleblach - Lind Spittal an St.Georgen am Steinfeld Feld am See St.Urban St.Andrä der Drau Längsee St.Georgen Irschen Berg/i.D. Liebenfels Ferndorf im Lavantal Oberdrauburg Diex Himmelberg St.Veit an der Glan Arriach Brückl Greifenburg Griffen Afritz Glanegg Dellach/i.D. Stockenboi Fresach St.Paul Feldkirchen im Steindorf am in Kärnten Weissensee Magdalens- Lavantal Ossiachersee Lesachtal Villach Land Maria Saal berg Treffen Ossiach Völkermarkt Gitschtal Lavamünd Dellach/i.G. Paternion Weissenstein Moosburg Poggersdorf Ruden Kirchbach Techelsberg Kötschach-Mauthen Velden am W.S. Pörtschach Neuhaus am W.S. am W.S. Krumpendorf Klagenfurt Bad Bleiberg Wernberg am W.S. Grafenstein Hermagor- Hermagor Villach St.Kanzian am Bleiburg Presseger Maria Wörth Eberndorf St.Stefan Stadt Klopeiner See See Nötsch im im Gailtal Stadt Schiefling Gailtal Keutschach am Ebental Rosegg am See Feistritz/G. See Völkermarkt Köttmannsdorf Maria Rain Hohenturn Finkenstein Ludmannsdorf Gallizien Sittersdorf Globasnitz Feistritz ob Bleiburg Arnoldstein St.Magareten St.Jakob/i.R. im Feistritz/i.R. Rosental Ferlach Klagenfurt Land Eisenkappel - Zell Vellach Leiter UA Agrartechnik Legende Bauleiter: Dipl. Ing. (FH) Hebein - Tel.: 0664 / 80536 - 11501 Ing. -

20210606 ARBÖ Kärnten Radmarathon Bad Kleinkirchheim 2021 Strecke a -Kronen Zeitung-Nockalmrunde
ARBÖ Kärnten Radmarathon Bad Kleinkirchheim 2021 Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen Results by Gender 06.06.2021 Rk No Name NOC City Club Cat | Rk Time Diff Pace Female 1 41 TAZREITER Angelika AUT Althofen KTM MTB Factory Team WU40 | 1 1:38:17.21 16.6 km/h 2 29 FREI Stefanie AUT Nüziders Skinfit Family WU40 | 2 1:39:57.61 +1:40.39 16.3 km/h 3 317 ZIPPER Evelyn AUT Niederwölz BikeZeit by Stephan Mattersberger WU40 | 3 1:43:06.54 +4:49.32 15.8 km/h 4 26 NOVAK Katarina SLO Kamnik TUS T.E.A.M. WU40 | 4 1:43:14.42 +4:57.21 15.8 km/h 5 444 BISCHOF Barbara AUT Klagenfurt WU40 | 5 1:49:33.25 +11:16.03 14.9 km/h 6 620 PENKER Marlies AUT Klagenfurt RC-MTB ASKÖ ARBÖ Möllbrücke WU50 | 1 1:53:28.95 +15:11.73 14.4 km/h 7 543 ZUDER Franziska AUT Arriach SC Mirnock WU40 | 6 1:53:36.99 +15:19.77 14.4 km/h 8 123 ZERKHOLD Irene AUT Scheibbs TV Scheibbs WU50 | 2 1:55:37.46 +17:20.25 14.1 km/h 9 217 BARTH Michaela AUT Neumarkt LAND-LEBEN Radteam ARBÖ Salzburg WU50 | 3 1:57:45.71 +19:28.49 13.9 km/h 10 211 CAIS Tanja AUT Oberalm WU40 | 7 1:58:01.77 +19:44.55 13.8 km/h 11 233 REDTENBACHER Claudia AUT Wien Radcore WU50 | 4 2:04:12.24 +25:55.02 13.1 km/h 12 311 BERGER Melanie AUT Göstling An Der Ybbs WU40 | 8 2:07:57.42 +29:40.20 12.8 km/h 13 508 MOSER Veronika AUT Salzburg RadUNION Salzburg WU50 | 5 2:10:31.56 +32:14.35 12.5 km/h 14 325 WEISS, MAG. -

Feld Am See Aktuell Amtliche Mitteilung April 2017
Zugestellt durch Post.at www.feld-am-see.gv.at Feld am See Aktuell Amtliche Mitteilung April 2017 Aus dem Inhalt: 2. Gegendtaler Gemeindeschitag 2017 • Bürgermeisterbrief • Die e5-Energiegemeinde • Die Klima- und Ener- giemodellregion • Lebensbewegungen • Aus dem Kindergarten • Aus der Volksschule • Fasching in Föld – Viele waren dabei! • Feuerwehr Feld am See • Konfirmation • Straßensperre Klamm • Kärntner Heizungsanlagenverordnung • Veranstaltungen 2. Gegendtaler Gemeindeschitag 2017 Mit den Gemeinden Treffen am Ossiacher See, Afritz am See, Feld am See und Arriach wurde heuer der 2. Gegendtaler Gemeindeschitag mit Schimeisterschaft und einem Jedermann – Hobbylauf auf der Gerlitze abgehalten. Bgm. Klaus Glanznig (Treffen), GV Otto Steiner (Treffen), Bgm. Gerald Ebner (Arriach), 2. Gegendtaler Schimeister Manfred Töplitzer und Barbara Winkler, GR Hans Neuwirth (Feld am Elena Winkler freute sich riesig über den 3. Platz See), Vzbgm. Wolfgang Pirker (Afritz am See) Fit für den Start: Gunnar Gasser, Barbara Winkler, Elena Der jüngste Teilnehmer: Tim Röhl aus Feld am See, Winkler, Hans Schneeweiß, Gerhard Trattnig 2. in der Bambini-Klasse Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren wieder begeistert fand am 11. März 2017 der 2. Gegendtaler Gemeindeschitag von der Organisation und Abhaltung der Veranstaltung. Je- statt. Über den Titel „2. Gegendtaler Schimeisterin“ darf sich denfalls wird bereits an der Weiterführung des Gegendtaler Daniela Unterwandling aus Arriach freuen. Bei den Herren geht Gemeindeschitages im nächsten Jahr gearbeitet. Insgesamt der Titel „2. Gegendtaler Schimeister“ in der Klasse Herren I an besteht das Bemühen, dass die angeführten Gemeinden in Zu- Manfred Töplitzer aus Feld am See und in der Klasse Herren II kunft Familien- und Sportveranstaltungen dieser Art gemein- an Peter Wirtitsch aus der Marktgemeinde Treffen. -

Einen Schönen Sommer Wünschen Bgm
AMTLICHE MITTEILUNG | Jahrgang 18 | Ausgabe 01 | Juli 2020 Partnergemeinde Moimacco „Guten Morgen Österreich“ zu Gast in der Gemeinde Hohenthurn Einen schönen Sommer wünschen Bgm. RR Ing. Florian Tschinderle, der Gemeinderat und die Gemeindebediensteten Bürgermeisterbrief 03 Geschätzte Gemeinde bürgerInnen, liebe Jugend! Nach einem sehr positiven Jahresbeginn in der Gemeinde mit ganz tollen und beeindruckenden Veranstaltungen hat uns Mitte März ein Virus weltweit die Grenzen der Menschheit aufgezeigt und in die Schranken gewiesen. Wir durften im Jänner noch die Special Olympics, gemeinsam mit der Gemeinde Feistritz an der Gail, am Hrastlift ausführen. Es war eine sehr beeindruckende und von allen Vereinen der Gemeinde Hohenthurn, dem ASKÖ Göriach, SV Draschitz, SV Achomitz/ŠD Zahomc, den Feuerwehren Achomitz, Dra- schitz-Dreulach, Göriach, Hohenthurn und auch von der Ge- meinde zu 100 % unterstützte Veranstaltung. Mit aller Kraft und Leidenschaft haben sich alle in den Dienst der Sache ge- stellt und wir können stolz sein, diesen Menschen mit besonde- ren Bedürfnissen tolle Rahmenbedingungen gewährt zu haben. Auch die Veranstaltung Guten Morgen Österreich war ein voller Erfolg. Ein sehr gut besuchtes Fest mit tollen Darbietun- gen. Die Gemeinde Hohenthurn hat sich österreichweit bestens präsentiert. Ein großes Dankeschön an alle, die sich für das Ge- lingen dieser Veranstaltung eingebracht haben und auch für die vielen Besucher, die daran teilgenommen haben. Ich darf an dieser Stelle persönlich und auch als Bürgermeister, dem Mo- deratorenteam, an der Spitze unseren ehemaligen Gemeinde- bürger Marco Ventre, ein großes Lob aussprechen. Er hat ganz meindeamt selbst, Vorbeugemaßnahmen, Verhaltensregeln, … toll durchs Programm geführt und man konnte auch feststellen, Krisenstab. Eine tägliche Gesetzesflut stellte sich ein. -
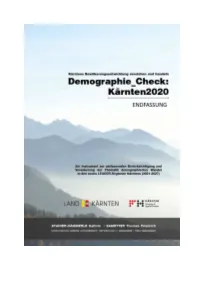
Demographie Check:Kärnten 2020 Endbericht
Demographie_Check: Kärnten 2020 Villach, Juni 2021 Im Auftrag des Landes Kärnten Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Mag. Christian Kropfitsch Dr. Kurt Rakobitsch Unterabteilungsleiter Sachgebietsleiter Leitung UA Orts- und Regionalentwicklung Landesstelle LEADER Kärnten Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Ländlicher Raum Tel.: 050 536-11071 Tel.: 050 536-11073 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Autor*in Fachhochschule Kärnten – Studienbereich Wirtschaft und Management – Public Management FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle Mag. Dr. Thomas Friedrich Zametter FH-Professorin für Politikwissenschaft Senior Researcher/Lecturer Leitung BA und MA Public Management Public Management FH-Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung FH-Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung Tel.: 05 90500-2416 Tel.: 05 90500-2459 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Kartenmaterial 1 Mag. Birgit Doiber Sachbearbeiterin Regionalentwicklung und GIS Programmmanagement und Projektkoordination Landesstelle LEADER Kärnten Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Tel.: 050 536-11077 Mail: [email protected] Datenlieferung und unterstützende Informationen Mag. Dr. Angelika Sternath, MSc Dipl.-Ing. Thomas Graf, Bakk. Sozialstatistik Wirtschaftsstatistik Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 1 - Amt der Kärntner Landesregierung Landesamtsdirektion Abteilung 1 - Landesamtsdirektion Landesstelle -

Kärntner Ortsverzeichnis
KÄRNTNER ORTSVERZEICHNIS Gebietsstand 1.1.2014 AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG L a n d e s s t e l l e f ü r S t a t i s t i k KÄRNTNER ORTSVERZEICHNIS Gebietsstand 1. 1. 2014 Auszugsweiser Abdruck nur mit Quellenangabe gestattet Herausgegeben: AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG Landesstelle für Statistik Zusammenstellung: Winfried VALENTIN EDV-technische Durchführung: Winfried VALENTIN Wolfgang WEGHOFER Titelgraphik: DI Wilfried KOFLER Redaktion und für den Inhalt verantwortlich: Dr. Peter IBOUNIG V O R W O R T 2.823 Ortschaften gibt es insgesamt in unseren 132 Gemeinden. Das vorliegende „Kärntner Ortsverzeichnis“ bildet nicht nur diese Vielfalt und Vielseitigkeit ab, sondern schafft auch zahlreiche Orientierungspunkte. Der Band kann Politik und Verwaltung als Planungsgrundlage dienen und stellt darüber hinaus ein nützliches Nachschlagewerk für Bürgerinnen und Bürger dar. Das Ortsverzeichnis hat eine bereits vier Jahrzehnte lange Tradition. Man startete damit 1973, als das Land Kärnten mittels Gemeindestrukturreform die kommunale Landschaft wesentlich verbessert und die Zahl der ehemals 203 Gemeinden nahezu halbiert hatte. Seither wird es von der Landesstelle für Statistik in gewissen Zeitabständen neu aufgelegt. Die aktuelle Publikation ist bereits die zehnte dieser Reihe. Nachlesen kann man in ihr auch die aus der Registerzählung 2011 zur Verfügung stehenden Eckdaten für die einzelnen Ortschaften. Natürlich werden gemäß der jüngsten Änderung des Volksgruppengesetzes vom 26. Juli 2011 die entsprechenden Ortschaften im gemischtsprachigen Gebiet Kärntens sowohl in deutscher als auch in slowenischer Sprache ausgewiesen. An dieser Stelle möchte ich aber auch betonen, dass wir seitens der Kärntner Landesregierung die Entwicklung der Regionen, insbesondere des ländlichen Raumes, fördern und unterstützen wollen. -

TO SERVE Six Reports from Across Our Group of Companies Demonstrate What Corporate Responsibility Really Means
Our commitment to … CSRCASINOS AUSTRIA AG AND ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN GMBH HAPPY TO SERVE Six reports from across our group of companies demonstrate what corporate responsibility really means. Facts & Figures FACTS & FIGURES CASINOS AUSTRIA in millions euro 2011 2012 2013 Total revenues (inland) 279.7 273.9 263.1 Tax payments (inland) 102 98 96 Employees* 1,580 1,562 1,575 Casino guests (in millions) 2.36 2.32 2.36 Gaming tables 233 233 234 Gaming machines 1,933 1,955 1,968 * Annual average full-time equivalent (FTE), incl. Casinos Austria Gastronomie Betriebs Ges.m.b.H. (CAGAST), Casinos Austria Sicherheitstechnologie GmbH (CAST), Congress Casino Baden Betriebsges.m.b.H. (CCB) and Casinos Austria Liegenschaftsverwaltungs- und Leasing GmbH (CALL). FACTS & FIGURES AUSTRIAN LOTTERIES in millions euro 2011 2012 2013 Total sales 2,899.60 2,955.32 3,049.11 Tax payments (incl. gaming related taxes as well as taxes from ordinary income and other taxes and duties) 459.21 454.51 433.83 Sports sponsoring in acc. with Section 20 of the Austrian Gaming Act 80.00 80.00 80.00 Employees* 491 507 532 * Annual average full-time equivalent (FTE). FACTS & FIGURES CASINOS AUSTRIA AND AUSTRIAN LOTTERIES 2011 2012 2013 Electricity consumption in kWh 6,401,823* 6,164,225 5,729,746 Heat consumption in kWh 2,336,436 2,613,000 2,397,160 3 HAPPY Water consumption in m 10,494 11,506 11,190 * Consumption in our test labs 1 and 2 (transformer 4) has been added to electricity consumption for the “RW44 Office Building” (transformers 1-3). -

Verteilung "Selbsttests" Für Betriebe
Dienststelle Adresse Zugeteilte Betriebe aus den Gemeinden Straßenbaumt Klagenfurt Josef Sablatnig Straße 245 Klagenfurt am Wörthersee 9020 Klagenfurt Krumpendorf am Wörthersee Maria Wörth Moosburg Poggersdorf Pörtschach am Wörther See Techelsberg am Wörther See Straßenmeisterei Rosental Klagenfurter Straße 41 Feistritz im Rosental 9170 Ferlach Ferlach Keutschach am See Köttmannsdorf Ludmannsdorf Maria Rain Rosegg Schiefling am Wörthersee St. Jakob im Rosental St. Margareten im Rosental Zell Straßenmeisterei Eberstein Klagenfurter Straße 7-9 Brückl 9372 Eberstein Eberstein Klein St. Paul Straßburg Weitensfeld im Gurktal Straßenmeisterei St. Ruprechter Straße 20 Albeck Feldkirchen 9560 Feldkirchen Feldkirchen in Kärnten Glanegg Gnesau Himmelberg Ossiach Reichenau St.Urban Steindorf am Ossiacher See Steuerberg Straßenmeisterei Friesach Industriestraße 44 Althofen 9360 Friesach Friesach Glödnitz Gurk Guttaring Hüttenberg Kappel am Krappfeld Metnitz Micheldorf Straßenmeisterei Klagenfurter Straße 51a Deutsch-Griffen St.Veit/Glan 9300 St.Veit/Glan Frauenstein Liebenfels Magdalensberg Maria Saal Mölbling St. Georgen am Längsee St.Veit an der Glan Straßenbauamt Villach Werthenaustraße 26 Arnoldstein 9500 Villach Arriach Feistritz an der Gail Finkenstein am Faaker See Hohenthurn Treffen am Ossiacher See Velden am Wörther See Villach Wernberg Straßenmeisterei Dueler Straße 88 Afritz am See Feistritz/Drau 9710 Feistritz/Drau Bad Bleiberg Feld am See Ferndorf Fresach Nötsch im Gailtal Paternion Stockenboi Weissenstein Straßenmeisterei Hermagor Egger -

ANLAGE Zu § 1 Der Politische Bezirk Feldkirchen Umfasst Folgende Gemeinden: Albeck, Feldkirchen in Kärnten, Glanegg, Gnesau, Himmelberg, Ossiach, Reichenau, St
ANLAGE zu § 1 Der politische Bezirk Feldkirchen umfasst folgende Gemeinden: Albeck, Feldkirchen in Kärnten, Glanegg, Gnesau, Himmelberg, Ossiach, Reichenau, St. Urban, Steindorf am Ossiacher See, Steuerberg. Der politische Bezirk Hermagor umfasst folgende Gemeinden: Dellach, Gitschtal, Hermagor-Pressegger See, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Lesachtal, St. Stefan im Gailtal. Der politische Bezirk Klagenfurt-Land umfasst folgende Gemeinden: Ebenthal in Kärnten, Feistritz im Rosental, Ferlach, Grafenstein, Keutschach am See, Köttmannsdorf, Krumpendorf am Wörthersee, Ludmannsdorf, Magdalensberg, Maria Rain, Maria Saal, Maria Wörth, Moosburg, Pörtschach am Wörther See, Poggersdorf, St. Margareten im Rosental, Schiefling am Wörthersee, Techelsberg am Wörther See, Zell. Der politische Bezirk St. Veit an der Glan umfasst folgende Gemeinden: Althofen, Brückl, Deutsch-Griffen, Eberstein, Frauenstein, Friesach, Glödnitz, Gurk, Guttaring, Hüttenberg, Kappel am Krappfeld, Klein St. Paul, Liebenfels, Metnitz, Micheldorf, Mölbling, St. Georgen am Längsee, St. Veit an der Glan, Straßburg, Weitensfeld im Gurktal. Der politische Bezirk Spittal an der Drau umfasst folgende Gemeinden: Bad Kleinkirchheim, Baldramsdorf, Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Flattach, Gmünd in Kärnten, Greifenburg, Großkirchheim, Heiligenblut am Großglockner, Irschen, Kleblach-Lind, Krems in Kärnten, Lendorf, Lurnfeld, Mallnitz, Malta, Millstatt am See, Mörtschach, Mühldorf, Oberdrauburg, Obervellach, Radenthein, Rangersdorf, Reißeck, Rennweg am Katschberg, Sachsenburg, Seeboden -

Verditz Lassen Sie Sich Vom GO-MOBIL® Bequem Zum Startpunkt Der Über Den Schattenberg Zur Unbewirtschafteten, Urigen Steinhauserhütte
STEINHAUSER RUNDWEG GO-MOBIL® Der Steinhauser Rundweg führt in einer kleinen und einfachen Runde Verditz Lassen Sie sich vom GO-MOBIL® bequem zum Startpunkt der über den Schattenberg zur unbewirtschafteten, urigen Steinhauserhütte. Wanderung oder zurück zur Unterkunft bringen! Forststraßen und angenehme Waldwege charakterisieren diese Runde. Die Kurzvariante eignet sich perfekt als Familienausflug oder Immer mit der Ruhe! Innerhalb der Gemeindegrenzen bietet das GO-MOBIL® kostengünstige Verdauungsspaziergang. Transportmöglichkeiten u.a. in Afritz am See, Treffen und Feld am See. Danach kann man bei der art-lodge den Skulpturenpark kostenlos Die GO-Fahrscheine sind zum Vorverkaufspreis bei den Mitgliedsbetrieben besichtigen. Kulinarische Köstlichkeiten werden im art-lodge Lokal um € 3,80/Stück oder im GO-MOBIL® um € 5,20/Stück zu erwerben. geboten und können im hoteleigenen Shop erworben werden. Information über die je nach Destination erforderliche Anzahl von Fahrscheinen erhalten Sie beim Lenker. Schwierigkeit: leicht Weg Nr.: Schattenbergstraße - Forststraßen - 28 - Verditzer Straße Betriebszeiten: Montag - Freitag: 8 - 24 Uhr Dauer: 2:00 Std. Länge: 5,2 km Höhenmeter: 240 m Samstag: 9 - 24 Uhr (Feld am See ab 8 Uhr) Sonntag: 9 - 22 Uhr (Feld am See ab 8 Uhr) GO-MOBIL® Afritz: +43 664 603 603 9542 WÖLLANER RUNDWEG GO-MOBIL® Feld am See: +43 664 603 603 9544 ® Eine kurze und schöne Wanderung führt von Afritz am See hinauf nach GO-MOBIL Treffen: +43 664 603 603 9521 Oberwöllan. Start ist beim Gasthof Linder, Ziel der Wanderung ist die ehemalige Wehrkirche Peter und Paul aus dem 14. Jahrhundert auf ca. 1.200 m am Südhang des Wöllaner Nocks. Diese Runde gibt dem Wanderer genussvolle Einblicke in die regionale Kulturlandschaft.