Hedingen 2006
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A-Welle–Zürcher Verkehrsverbund
A-Welle–Zürcher Verkehrsverbund ▲ Feuerthalen ▲ 116 Uhwiesen Schloss Laufen a. Rh. Dachsen ▲ Wildensbuch ▲ Benken ZH Neubrunn- Ulmenhof 162 ▲ Rheinau Rudolfingen Trüllikon Stammheim Marthalen Guntalingen Oerlingen Truttikon Waltalingen Ossingen Oberstamm- Waldshut Marthalen heim ▲ Full Felsenau ▲ 161 Koblenz Dorf Rafz 115 Oberneunforn Reuenthal Wil ZH Koblenz Rietheim Kleinandelfingen Schwaderloch Hüntwangen ▲ ▲ 563 Bad Zurzach Andelfingen Leibstadt Gippingen 114 Klingnau Adlikon Gütighausen Leuggern Wasterkingen Hüntwangen-Wil Rüdlingen 124 Thalheim 564 Rekingen AG Altikon Döttingen Fisibach 113 Flaach Volken Dorf Kaiserstuhl AG Buchberg 160 Thalheim-Altikon Mellikon Rümikon AG Ellikon Humlikon Henggart an der Thur Tegerfelden Zweidlen Berg am Böttstein Baldingen Böbikon Irchel Dägerlen Eglisau Dinhard Rickenbach ZH Buch am ▲ 562 Siglistorf Teufen Aesch bei Weiach Irchel Neftenbach 163 Mandach Glattfelden Endingen Hettlingen Seuzach PSI Windlach ▲ Würenlingen 118 Rickenbach-Attikon Bürersteig Freienstein Neftenbach 123 Gundetswil Rorbas Reutlingen Villigen Stadel Bülach Mönthal bei Niederglatt Hochfelden Dättlikon Wallrüti ▲ 565 Schneisingen Embrach-Rorbas Hagenbuch Lengnau ▲ Remigen Siggenthal-Würenlingen Wiesendangen ▲ Bachenbülach Oberwinterthur Niederweningen Bachs Neerach Pfungen Rüfenach Höri 561 Elsau Freienwil Embrach Wülflingen Grüze Hegi Elgg 550 Untersiggenthal NiederweningenSchöfflisdorf- Dorf Bözberg Oberweningen 112 Kirchdorf AG Ehrendingen Winterthur Räterschen Schottikon Riniken Turgi Winkel Lufingen Steinmaur Töss Effingen -

Nr. 159 September 2016 2 IMPRESSUM
Nr. 159 September 2016 2 IMPRESSUM Hediger Dorfzitig Nächste Ausgabe (DZ 160): Ende November 2016 Redaktionsschluss: 24. Oktober 2016 Beiträge für die nächste Nummer bitte an: [email protected] Katrin Toggweiler, Fliederstrasse 9, 8908 Hedingen, 044 761 83 66 Die Daten 2017 finden Sie in der nächsten Ausgabe hier. Redaktionsteam: Katrin Toggweiler (Leitung), Samuel Büchi, Käthy Elsener, Manuela Fusco, Jacqueline Grand, Corinne Gysling, Rolf Studer, Andrea Zank Illustrationen: Monika Studer Layout: Katrin Toggweiler, werbekueche.ch Druck: Albis-Offsetdruck INHALT 3 Gemeinde Aus dem Gemeindehaus 4 - 5 Urnengang vom 5. Juni 2016 6 Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2016 7 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 8 Primarschule Aus der Primarschule 9 - 10 Frühlingswanderung 11 Unsere ZVV-Reise 12 Generationen im Klassenzimmer 13 Abschied von Anna Molnar 14 Die neuen Kindergartenkinder und die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler 15 Sekundarschule Sportcamp Tenero 16 - 18 Sprachreise in die Romandie 19 - 20 Bibliothek Dieses Jahr stapelten wir hoch! 21 - 22 Reformierte Kirche Zum Rücktritt von Maya Schmit 23 Altersferien 2016 24 - 26 Konflager 2016 27 - 29 Chile a de Chilbi 30 Gemeindenachmittage 2016/2017 31 Katholische Kirche Informationen der katholischen Kirchgemeinde 32 - 34 Vereine MVH: Der MVH in Montreux und Dietikon 35 - 36 Jugi: Sportlager 2016 37 - 40 Chinderhuus Hedingen: Sommerlager 2016 41 - 42 Der neue Tambourenverein „Trümmlig“ 43 Naturnetz Unteramt: Pilzexkursion 44 Frauenverein: Kinoabend 45 Männerriege: Schnupperturnen 46 Damenturnverein: Schnuppertrainings 47 Gemeindeverein: Dänu Wisler 48 Räbeliechtliumzug 49 Samariterverein: Blutspenden und Martinischwimmen 50 SeniorInnen-Velogruppe: Winterprogramm 2016/2017 51 Frauenverein: Advents-Bazar 52 Gemeindeverein: Figurentheater für Gross und Klein 53 Kreuz & Quer Integrationsgruppe Hedingen 54 - 56 Pro Senectute: Armut im Alter 57 - 58 AJB: Elternbildung in Ihrer Region 58 Contact: Sport- und Freizeitaktivitäten 59 KJZ: Tag der Kinderrechte 60 Was wir schon immer wissen wollten über .. -

Zürich / Bonstetten / Wettswil
Gültig 10.12.17–8.12.18 ZVV-Ticket-App Der handlichste Ticketautomat. Infos auf www.zvv.ch Zürich / Bonstetten / Wettswil Linien 200 227 210 228 220 229 221 N23 ZVV-Contact 0848 988 988 Inhaltsverzeichnis Linie Strecke Seite 200 Zürich Enge–Bonstetten-Wettswil–Affoltern a. A. 3 210 Zürich Enge–Bonstetten-Wettswil–Bonstetten 9 220 Zürich Wiedikon–Wettswil–Bonstetten-Wettswil 11 221 Ortsbus Wettswil (Rundkurs) 15 227 Bonstetten-Wettswil–Stallikon–Birmensdorf ZH 22 228 Ortsbus Bonstetten (Rundkurs) 28 229 Bonstetten-Wettswil, Bahnhof–Wettswil, Heidenchilen 32 N23 Bonstetten-Wettswil–Stallikon–Landikon–Birmensdorf ZH 35 PostAuto Schweiz AG Region Zürich Als Sonntage gelten: Tel. 058 386 24 00 25. und 26. Dezember, 1. und 2. Januar, E-Mail: [email protected] Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, www.postauto.ch/zuerich Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August 200 Zürich Enge Bonstetten-Wettswil Affoltern a.A. Montag - Freitag Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. 6.20alle 8.50 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 - Saalsporthalle 6.2330 8.53 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 Wettswil a.A., Moosstrasse 6.32Min 9.02 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 - Saalsporthalle - Grund 6.33 9.03 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 Bonstetten-Wettswil, Bahnhof an 6.35 9.05 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 Zürich HB ab 6.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 Bonstetten-Wettswil an 6.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 Wettswil a.A., Moosstrasse - Bahnhof ab 6.36 9.06 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 Bonstetten, Dorfstrasse 6.38 9.08 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 Hedingen, Güpf 6.41 9.11 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 - Grund Affoltern a.A., Kronenplatz 6.45 9.15 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 - Bahnhof 6.47 9.17 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 Affoltern am Albis ab 7.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 Zug an 7.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 Bonstetten-Wettswil, Bahnhof Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. -

Abstimmungsempfehlung Kirchenpflege Rifferswil
Beschluss der Kirchenpflege Sitzung vom 30. Juni 2020 KirchGemeindePlus Bezirk Affoltern. Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag. Abstimmungsempfehlung ________________________________________________________________________________ Ausgangslage Bereits 2014 hat die Reformierte Kirchenpflege Rifferswil intensive Gespräche mit den Kirchenpfle- gen von Kappel und Hausen am Albis durchgeführt, um einen Zusammenschluss im Oberamt zu prüfen. Dabei wurde festgestellt, dass die strukturellen Probleme der drei Kleingemeinden bei ei- nem Zusammenschluss im Oberamt nicht nachhaltig gelöst werden könnten. Eine Kirchgemeinde Oberamt würde immer noch über sehr wenige Mitglieder, damit verbunden über geringe Pfarram- tressourcen und auch über sehr knappe finanzielle Mittel verfügen. Die drei Kirchenpflegen haben anschliessend gemeinsame Gespräche mit Mettmenstetten, Aeugst, Knonau und Maschwanden ge- führt. Das Interesse an einem Zusammenschluss mit dem Oberamt war aber nicht bei allen Gemein- den vorhanden, da sich einige Orte eher nach Affoltern ausrichten wollten. In der Folge wurde 2016 die Initiative gestartet, einen Zusammenschluss auf Bezirksebene anzustreben. Die damalige Rif- ferswiler Kirchenpflege priorisierte jedoch weiterhin eine Lösung mit zwei oder drei neuen Kirchge- meinden. Leider blieb Rifferswil mit dieser Absicht alleine und fand bei den Nachbargemeinden kaum Unterstützung. Im Juni 2017 hat die Kirchgemeindeversammlung die Kirchenpflege beauftragt, Verhandlungen mit anderen Kirchgemeinden im Bezirk Affoltern im Hinblick auf -

Schlussbericht AG 2 Finanzen Und Liegenschaften
Vorprojekt KG+ Bezirk Affoltern Arbeitsgruppe 2 Finanzen und Liegenschaften Zusammensetzung der Arbeitsgruppe: Name Vorname Kirchgemeinde Funktion Engeli Ursula Stallikon-Wettswil ehem. Kirchenpflegerin, Finanzen Hauser Michael Kappeln a. Albis Finanzen u. Gutsverwalter Huber Iris Aeugst Kirchenpflegerin Ilg Yvonne Maschwanden Finanzvorsteherin Lienhart Hanspeter Leitung AG Finanzen u. Liegenschaften Ott Peter Hedingen Präsident Kirchenpflege Rosenberger Markus Knonau Präsident Kirchenpflege Sauder Urs Peter Bonstetten RPK-Präsident Schild Erich Affoltern Gutsverwalter Schmidheiny Hanno Aeugst ehem. Präsident Kirchenpflege Schmit Jan Bonstetten Synodaler, Mitglied Finanzkommission Schneiter Paul Hedingen ehem. Gemeindepräsident Schütz Kurt Mettmenstetten Finanzen von Ah Silvio Obfelden Gutsverwalter Voûte Carl-Heinz Ottenbach Mitglied Kirchenpflege, Liegenschaften Antrag an Lenkungsausschuss: Zusammenschlussvarianten mit weniger als 4‘800 Mitglieder wurden von der Arbeitsgruppe zum vornherein ausgeschlossen, da diese von der Grösse her keinen Sinn machen. Folgende Priorisierung für das Führen von Zusammenschlussgesprächen wurde beschlossen: Variante A 1 Kirchgemeinde 11 Punkte Priorität 1 7 Punkte Variante F 3 Kirchgemeinden 11 Punkte Priorität 2 6 Punkte Variante G 3 Kirchgemeinden 8 Punkte Priorität 3 0 Punkte Begründung a aus finanzieller Sicht 1. Priorität hat Variante a eine Kirchgemeinde für den ganzen Bezirk Affoltern 1 Der Steuersatz beträgt bei beträgt bei dieser Variante neu 12%. Für Stallikon/Wettswil würde dies einen erheblichen Anstieg des Steuerfusses gegenüber heute bedeuten (+4%). 2. Priorität hat Variante f mit insgesamt 3 Kirchgemeinden für den Bezirk. Unterer Bezirk: Bonstetten/Hedingen und Stallikon-Wettswil (Steuerfuss 10%) Mittlerer Bezirk: Aeugst/Affoltern /Obfelden und Ottenbach (Steuerfuss 13%) Oberer Bezirk: Hausen/Kappel/Knonau/Maschwanden/Mettmenstetten und Rifferswil (Steuerfuss 14%). 3. Priorität hat Variante g mit ebenfalls 3 Kirchgemeinden für den Bezirk. Unterer Bezirk: Bonstetten und Stallikon-Wettswil (Steuerfuss 10%). -

Tarifzonen | Fare Zones
Tarifzonen | Fare zones ▲ Feuerthalen ▲ Flurlingen 116 Schloss Laufen a. Rh. Dachsen Wildensbuch ▲ ▲ ▲ Benken ZH Rheinau Trüllikon Stammheim Marthalen Truttikon Oerlingen Ossingen 162 Oberstamm- ▲ ▲ 115 161 heim Wil ZH Oberneunforn Rafz Kleinandelfingen Hüntwangen 114 Andelfingen Rüdlingen Adlikon Wasterkingen Hüntwangen- Wil 124 160 Flaach Thalheim- Kaiserstuhl AG 113 Buchberg Altikon Altikon Ellikon Henggart an der Thur Zweidlen Weiach Eglisau Buch Dinhard Teufen am Irchel 163 ▲ Hettlingen Glattfelden Seuzach 118 Windlach Rickenbach-Attikon Freienstein Neftenbach f Stadel Reutlingen Gundetswil bei Niederglatt Bülach Rorbas n Dättlikon Wallrüti Hagenbuch n Bachs Oberwinterthur Wiesendangen Embrach-Rorbas Pfungen höfflisdorf- Höri Hegi Elgg NiederweningeNiederweningenSc Dor Grüze ▲ Oberweninge 112 Wülflingen ▲ 123 Winterthur Räterschen Steinmaur Schottikon Niederglatt Töss Schleinikon Oberembrach Seen Elgg Dielsdorf 164 117 Regensberg Niederhasli Brütten 120* Schlatt bei Winterthur 121 Oberwil Sennhof-Kyburg Boppelsen Zürich Buchs- Flughafen Kloten Oberglatt Kollbrunn Strandbad ▲ Dällikon Nürensdorf Kyburg Bichelsee Otelfingen Rämismühle- ▲ Rümlang Kemptthal Zell Hüttikon Turbenthal Otelfingen 111 Balsberg Rikon Neubrunn Golfpark Lindau Glattbrugg Weisslingen Regensdorf- Bassersdorf Oetwil Watt Affoltern Opfikon 170 171 a. d. Limmat Dietlikon 122 ▲ Sitzberg Seebach Wallisellen Wildberg Spreitenbach ▲ Geroldswil Effretikon Shopping Center Wila Oberengstringen Illnau Dietikon 110* Oerlikon 121 184 Schlieren Altstetten Volketswil 135 Stelzenacker -

Anlagenverzeichnis GWVA Anhang 1 Zum GWVA-Vertrag
Anlagenverzeichnis GWVA Anhang 1 zum GWVA-Vertrag Obj. Name / Lage Objekt Funktion / Bemerkung Eigentum Unterhalt Werterhalt/Erneuerung Nr. Dimension Grundwasserpumpwerk Maschwanden Grundwasserpumpwerk, Gebäude - Pumpwerk Maschwanden 3 Pumpen, 61 l/s, - GWV Amt GWV Amt GWV Amt Pumpwerk inkl. Trafostation Parallel-Lauf 111-115 l/s Förderleitung PW Maschwanden - Reservoir Bernhau - - Leitung und Kathodenschutz Transportleitung 400 / 350 GWV Amt GWV Amt GWV Amt Transportleitung und Stahlrohrstutzen 400 GWV Amt GWV Amt GWV Amt - Notbezug Maschwanden Notbezug Maschwanden Versorgungsleitung 125 / 100 Maschwanden Maschwanden Maschwanden Transportleitung und Stahlrohrstutzen 400 GWV Amt GWV Amt GWV Amt - Weid Löschwasserversorgung Hydrant inkl. Zuleitung Maschwanden Maschwanden Maschwanden 1 Eingang Maschwanden Schacht Spülschacht 125 / 2" GWV Amt GWV Amt GWV Amt 2 Wolserholz Schacht Absperrklappe, Be-/Entl. 400 GWV Amt GWV Amt GWV Amt 3a Dachlissermoos Schacht Be-/Entlüftung Spülen 125 / 2" GWV Amt GWV Amt GWV Amt 3b Dachlissermoos Absperrklappe Erdverlegt 400 GWV Amt GWV Amt GWV Amt 3c Dachlissermoos Entleerungsklappe Erdverlegt 200 GWV Amt GWV Amt GWV Amt Schacht allgemein, Transportleitung mit T-Stück, Absperrklappe, Absperrklappe Be-/Entl. 400 GWV Amt GWV Amt GWV Amt Be-/Entl., elektrische Installation 4a Eigi Klappenschacht Gmde. Obfelden und WVG Gmde. Obfelden und WVG Schieber, Druckreduzierventil Abgabe Obfelden und Dachlissen 150 Gmde. Obfelden und WVG Mettmenstetten Mettmenstetten Mettmenstetten Schieber, Druckreduzierventil, Wassermesser -

Lorzengezwitscher
Lorzengezwitscher Mitteilungsblatt der Gemeinde Maschwanden Herausgeber: Gemeinderat Maschwanden Erscheint sechsmal pro Jahr oder nach Bedarf Ausgabe Nr. 183 / Juni 2020 Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 31. Juli 2020 Bericht aus dem Gemeindehaus Bauwesen Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt: Bruno Dietrich, wohnhaft an der Dorfstrasse 23 in Maschwanden; Dorfstrasse 31, Umbau Reiheneinfamilienhaus, Kat.-Nr. 99. Patrick Vonwil, wohnhaft an der Ausserdorfstrasse 23 in Maschwan- den; Ausserdorfstrasse 25/27, Ersatzneubau Mehrfamilienhaus, Kat.-Nr. 1180. Chantal Nitschké als neue Gemeindeschreiberin Chantal Nitschké, aktuelle Gemeindeschreiberin von Niederwenin- gen, wird im August vom abtretenden Gemeindeschreiber Daniel Lehmann diese Aufgabe in Maschwanden übernehmen. Die 35-jährige Chantal Nitschké wird mit einem Arbeitspensum von 70% ihre Arbeit im August aufnehmen und kann so vom derzeitigen Stelleninhaber bestens eingeführt werden. Chantal Nitschké hat ihre Ausbildung zur Kauffrau in der Stadtver- waltung Schlieren erfolgreich abgeschlossen und sich zur HR Fach- frau mit eidgenössischen Fachausweis sowie mittels Nachdiplom- studium zur Personalleiterin weitergebildet. Ausserdem erwarb sie im Jahr 2008 das Diplom als Gemeindeschreiberin. Sie kennt das Knonaueramt bestens, war sie doch in der Zeit von 2006 bis 2011 auf der Gemeindeverwaltung Ottenbach tätig, wo sie zum Einstieg als Leiterin Einwohnerkontrolle und danach vier Jahre als stellver- tretende Gemeindeschreiberin arbeitete. Mit ihrer Familie wohnt sie in Rudolfstetten (AG). Der Gemeinderat freut sich, eine fachlich und persönlich überzeu- gende Gemeindeschreiberin gefunden zu haben und wünscht ihr ei- nen erfolgreichen Start in Maschwanden. Jahresrechnung 2019 In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 3‘724‘113.94 ein Ertrag von Fr. 3‘714‘351.87 gegenüber, woraus ein Aufwandüber- schuss von Fr. 9‘762.07 resultiert. -

Jahresbericht 2019 °° Weil Die Familie Unsere Grösste Verantwortung Und Unser Ganzer Stolz Ist
°° Jahresbericht 2019 °° Weil die Familie unsere grösste Verantwortung und unser ganzer Stolz ist. Das Familienzentrum wurde im Jahr 2019 von der Stadt Affoltern, den Gemeinden Aeugst am Albis, Bonstetten, Hausen am Albis, Hedingen, Knonau, Maschwanden, Mettmenstetten, Obfelden, Ottenbach, Stallikon, und Wettswil am Albis, dem Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich und der Fachstelle für Integrationsfragen Zürich unterstützt. ° ° Aus dem Vorstand über das Vereinsjahr ° ° ° ° Liebe Leserin, lieber Leser 2019 wird mir in vielerlei Hinsicht als Wendepunkt für das Familienzentrum in Erinnerung bleiben. Das erste Jahr Leistungsvereinbarung mit der Stadt Affoltern, ein neu zusammengestelltes Vorstandsteam, ab Sommer der Schülerhort im 1. Stock… Ich bin stolz, dass wir bei allen Veränderungen das Ziel – für die Familien im Bezirk attraktive Angebote anzubieten und wertvolle soziale Integrationsarbeit zu leisten – nie aus den Augen verloren und mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, die sich uns bietenden Chancen gepackt haben. Gleichzeitig (und das zeigt der vorliegende Jahresbericht wieder eindrücklich) hat der gesamte Betrieb mit viel Einsatz und Kreativität Wege gefunden, damit auch im anhaltend herausfordernden Umfeld ein vielseitiges, relevantes, förderndes und entlastendes Angebot für Kinder und Erziehende gewährleistet werden konnte. Unser tiefster Dank geht deshalb an alle Mitarbeiterinnen, allen voran die beiden Betriebsleiterinnen, Michèle Hasler und Michelle Furter, sowie Nadia Riedlinger, Leiterin Finanzen, für die geleistete Arbeit und das viele Herzblut, das sie in das Familienzentrum investieren, und ihren wahrlich unermüdlichen Einsatz. Seit dem 1. Januar 2020 ist das Familienzentrum nun - nach mehr als 15 Jahren - ohne die direkte finanzielle Unterstützung durch den Kanton Zürich unterwegs. Die 2019 durch den Kanton erstmals ausbezahlten Subventionsbeiträge an Gemeinden, die anerkannte Familienzentren finanziell unterstützen, werden wir die entstandene Lücke kurzfristig nicht schliessen können. -

Geschichte Des Vereins Kloster Kappel Gegründet 1835
Geschichte des Vereins Kloster Kappel Gegründet 1835 Kauf und Gründung der Anstalt Die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Affoltern ersteigerte 1834 die Staatsdomäne Kappel und erhielt den Zuschlag mit der Auflage, darin eine Armenanstalt einzurichten. Die Kirchgemeinden, welche bis 1929 für das Armenwesen zuständig waren, wurden eingeladen, sich innert drei Wochen zu entscheiden, ob sie sich an der Gründung einer Bezirksarmenanstalt beteiligen wollten. Die 12 Kirchgemeinden des Bezirks schlossen sich am 7. Januar 1835 zum Trägerverein „Anstalt Kappel am Albis“ zusammen. Eröffnung der Anstalt 1836 Zu Beginn umfasste die Anstalt das Amtshaus, das Konventgebäude, die Pfisterei (heute „Haus am See“), die Ziegelei und den Landwirtschaftsbetrieb mit rund 60 Hektaren Land. Durch den günstigen Weiterverkauf von 89 Jucharten Land (32 ha) konnten die nötigen Mittel bereitgestellt werden, um den Umbau der alten "Schütte" (Vorratshaus für Getreide) neben der Kirche in eine Armenanstalt zu finanzieren. Architekt Locher aus Zürich erstellte die Pläne und Ende 1835 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Am 11. November 1836 wurde die Anstalt eröffnet und bot für 150 Personen Unterkunft. Bereits am 1. Juli 1837 lebten 97 Insassen, davon 50 Waisenkinder in der Anstalt. Lehrer Chr. Stucki, welcher in der Armenschule Hofwil bei Bern bei Fellenberg und Wehrli seine Ausbildung genossen hatte, wurde angestellt. Um die grosse Kinderschar unterzubringen, baute man zwischen 1841 und 1842 die alte Pfisterei (Bäckerei) in ein Waisenhaus um. Die Rolle der Anstalt Kappel im Bezirk Die Anstalt hatte im Bezirk eine doppelte Rolle: einerseits war sie ein Asyl für Waisen, Alte und Kranke, andrerseits eine Korrektionsanstalt für Randständige. Armengenössige Ledige, die ihren Lebensunterhalt z.B. -
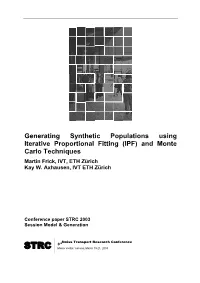
Generating Synthetic Populations Using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W
Generating Synthetic Populations using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick, IVT, ETH Zürich Kay W. Axhausen, IVT ETH Zürich Conference paper STRC 2003 Session Model & Generation Swiss Transport Research Conference 3 rd STRC Monte Verità / Ascona, March 19-21, 2003 Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Generating Synthetic Populations using Itera- tive Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques Martin Frick IVT ETH Zürich 8093 Zürich Phone: 01-633 37 13 Fax: 01-633 10 57 e-Mail: [email protected] I Swiss Transport Research Conference _______________________________________________________________________________ March 19-21, 2003 Abstract The generation of synthetic populations represents a substantial contribution to the acquisition of useful data for large scale multi agent based microsimulations in the field of transport plan- ning. Basically, the observed data is available from censuses (microcensus) in terms of simple summary tables of demographics, such as the number of persons per household for census block group sized areas. Nevertheless, there is a need of more disaggregated personal data and thus another data source is considered. The Public Use Sample (PUS), often used in transportation studies, is a 5% representative sample of almost complete census records for each individual, missing addresses and unique identifiers, including missing items. The problem is, to generate a large number of individual agents (~ 1Mio.) with appropriate characteristic values of the demo- graphic variables for each agent, interacting in the microsimulation. Due to the fact that one is faced with incomplete multivariate data it is useful to consider multiple data imputation tech- niques. In this paper an overview is given over existing methods such as Iterative Proportional Fitting (IPF), the Maximum Likelihood method (MLE) and Monte-Carlo (MC) techniques. -

Sport Garage Wettswil Tel
FC WETTSWI L- BONSTETTEN AUSGABE NR . 78 – 8/ 2012 CLUB NEWS gg !! s tt ii ee AA uu ff s Aufstieg in die 1. Liga Classic, Saison 2011/2012 FFCC WWeettttsswwiill--BBoonnsstteetttteenn Redaktion WB 1 Herzliche Gratulation ... ... und vielen Dank an meine Berichte-Schreiberlinge! Einfach toll, wie die amüsanten News mir jeweils zufliegen ... Was für eine Saison 2011/2012 durften wir WB’ler erleben! Aufstieg, Feste, Ligaerhalt, Juniorenerfolge, Schirierfolge und vieles mehr. Der FCWB steigt in neue Sphären auf. Die Junioren haben Hochs und Tiefs, wie es so ist im Wachstum. Es braucht viel Geduld von den Trainern. Die Ausbildung muss im Vordergrund stehen, dann wer - den die jungen Spieler ganz grosse Spieler. Speziell erwähnen möchte ich den Be - richt der Junioren Db von Frederic auf Seite 29. Klein aber fein. Einfach herrlich. Danke! Unsere Schiedsrichter-Gilde wächst und auch Raphi Gentile ist am Aufsteigen. Lei - der ist auch ein Abgang zu vermelden. Der Schreibende hat es ins Berner Oberland verschlagen. Darüber können wir in einer späteren Ausgabe lesen. Wie immer nicht vergessen dürfen wir die Oldies. Es geht inzwischen einfach alles ein bisschen länger ... Erfreuliches können wir jedoch auch von diesen Herren lesen. Freude habe ich immer an den Supportern, welche es sich nicht nehmen lassen, auch was zu schreiben. Danke! So wünschen wir allen eine spannende Lektüre, wo auch immer gerade Sie sind ... Schöne Ferien ... und hoffentlich sehen wir uns bald 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 / / / / 1 n 8 8 8 8 n n n n – – – – 0 8 8 8 8 2 wieder auf dem Sportplatz Moos.