4. Band, 1. Teil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
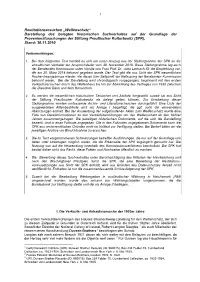
Welfenschatz
1 Restitutionsersuchen „Welfenschatz“ Darstellung des belegten historischen Sachverhaltes auf der Grundlage der Provenienzforschungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Stand: 30.11.2010 Vorbemerkungen: 1. Bei dem folgenden Text handelt es sich um einen Auszug aus der Stellungnahme der SPK an die anwaltlichen Vertreter der Anspruchsteller vom 30. November 2010. Diese Stellungnahme lag auch der Beratenden Kommission unter Vorsitz von Frau Prof. Dr. Jutta Limbach für die Empfehlung vor, die am 20. März 2014 bekannt gegeben wurde. Der Text gibt die aus Sicht der SPK wesentlichen Rechercheergebnisse wieder, die dieser zum Zeitpunkt der Befassung der Beratenden Kommission bekannt waren. Bei der Darstellung wird chronologisch vorgegangen, beginnend mit den ersten Verkaufsversuchen durch das Welfenhaus bis hin zur Abwicklung des Vertrages von 1935 zwischen der Dresdner Bank und dem Konsortium. 2. Es werden die wesentlichen historischen Tatsachen und Abläufe dargestellt, soweit sie aus Sicht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als belegt gelten können. Zur Erarbeitung dieser Stellungnahme wurden umfassende Archiv- und Literaturrecherchen durchgeführt. Eine Liste der ausgewerteten Aktenbestände wird als Anlage I beigefügt, die ggf. auch die verwendeten Abkürzungen enthält. Bei der Auswertung der aufgefundenen Akten zum Welfenschatz wurde eine Fülle von Detailinformationen zu den Verkaufsbemühungen um den Welfenschatz ab den 1920er Jahren zusammengetragen. Die jeweiligen historischen Dokumente, auf die sich die Darstellung bezieht, sind in einer Fußnote angegeben. Die in den Fußnoten angegebenen Dokumente kann die SPK aus archivrechtlichen Gründen nicht im Volltext zur Verfügung stellen. Bei Bedarf bitten wir die jeweiligen Archive um Einsichtnahme zu ersuchen. 3. Die im Text vorgenommenen Schwärzungen betreffen Ausführungen, die nur auf der Grundlage von Akten oder Unterlagen möglich waren, die die Erbenseite der SPK zugänglich gemacht hat. -

Haute Commission Interalliée Des Territoires Rhénans (HCITR) - Archives Du Haut-Commissariat Français (1918-1930)
Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR) - Archives du Haut-commissariat français (1918-1930) Répertoire numérique détaillé des articles AJ/9/2889 à AJ/9/6573 par Michèle Conchon, conservateur en chef aux Archives nationales, Matthias Nuding et Florence de Peyronnet-Dryden, archivistes à l’Institut historique allemand de Paris, avec la collaboration de Christelle Gomis et, pour l'édition électronique de Brigitte Lozza. Cet instrument de recherche a été réalisé avec le soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Deuxième édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2015 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054079 Cet instrument de recherche a été réalisé avec le soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Il a été rédigé sur la base de l'inventaire établi en 1934 par Jean Couprie, secrétaire-archiviste de la HCITR, complété et corrigé par une analyse précise de toutes les unités de descriptions. Il a été élaboré avec le logiciel XMetaL et édité pour sa première édition électronique en 2011 avec le concours de Brigitte Lozza, chargée d'études documentaires aux CeArchives document nationales. est écrit en françaisallemand. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Mentions de révision : • Juillet 2015: Cette édition correspond à la publication dans la SIV des fichiers Xml produits en 2011. 3 Archives nationales (France) Préface Le travail d'inventaire a été réalisé grâce à la collaboration de trois institutions : les Archives nationales, l'Institut historique allemand de Paris, les Archives du ministère des Affaires étrangères. -

1923 Inhaltsverzeichnis
1923 Inhaltsverzeichnis 14.08.1923: Regierungserklärung .............................................................................. 2 22.08.1923: Rede vor dem Schutzkartell für die notleidende Kulturschicht Deutschlands ........................................................................................ 14 24.08.1923: Rede vor dem Deutschen Industrie- und Handelstag ........................... 18 02.09.1923: Rede anläßlich eines Besuchs in Stuttgart ........................................... 36 06.09.1923: Rede vor dem Verein der ausländischen Presse in Berlin .................... 45 12.09.1923: Rede beim Empfang des Reichspressechefs in Berlin ......................... 51 06.10.1923: Regierungserklärung ............................................................................ 61 08.10.1923: Reichstagsrede ..................................................................................... 97 11.10.1923: Erklärung im Reichstag ........................................................................119 24.10.1923: Rede in einer Sitzung der Ministerpräsidenten und Gesandten der Länder in der Reichkanzlei ..................................................................121 25.10.1023: a) Rede bei einer Besprechung mit den Vertretern der besetzten Gebiete im Kreishaus in Hagen ..........................................................................................147 b) Rede in Hagen .................................................................................................178 05.11.1923: Redebeitrag in der Reichstagsfraktion -

Bibliography
BIBLIOGRAPHY I. PRIMARY SOURCES A. Germany I) Bundesarchiv Koblenz Reichskanzlei, R 43 1 Reichsfinanzministerium, R 2 Reichsministerium fiir den Wiederaufbau, R 38 2) Politisches Archiv des Auswiirtigen Amts, Bonn a) Biiro des Reichsministers Reden des Reichskanzlers fiber auswartige Politik Reparationsfragen Reparationen 5 seer. MaBnahmen der Entente bei Nichterfiillung der Reparationen Intemationale Geschiiftsleutekonferenz Deutsch-Englische Industrie Cooperation Ruhrgebiet Frage des Abbruchs der Beziehungen Frage der Aufgabe des passiven Widerstandes b) Sonderreferat Wirtschaft Verhandlungen der Sechserkommission des bergbaulichen Vereins mit der MICUM Verhandlungen Krupp, Wolff, Becker, u.a. mit der MICUM Die Aktion der amerikanischen Handelskammer Wirtschaftliche Vereinigungen c) Wirtschaftsreparationen Organisation der Sachleistungen, Vorschlage, Seydoux: AbschluB von Ab kommen mit Frankreich fiber Sachleistungen und Lauf der Sachleistungen (Verhandlungen mit Tannery, Loucheur, Rathenau) Lieferungsabkommen zwischen de Lubersac und Stinnes Besetzung des Ruhrgebiets Sonderakte Kohle, Koks, usw. BIBLIOGRAPHY Plane bzw. Vorschlage zur Regelung der Reparationsfrage Allgemeine Reparationsfrage Vorarbeiten zum Memorandum v. 7.6.23 Kommissionsarbeiten zur Bereitstellung des Reparationsmaterials Die amerikanische Vermittlung in der Reparationsfrage d) Handakten, Direktoren Schubert Ha. Pol. Ritter 3) Historisches Archiv der Gutehoffnungshiitte (RA GRR) 4) Werksarchiv der MAN Augsburg 5) Westfiilisches Wirtscha!tsarchiv, Dortmund rvvw A) -
Information to Users
INFORMATION TO USERS While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. For example: • Manuscript pages may have indistinct print. In such cases, the best available copy has been filmed. • Manuscripts may not always be complete. In such cases, a note will indicate that it is not possible to obtain missing pages. • Copyrighted material may have been removed from the manuscript. In such cases, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, and charts) are photographed by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each oversize page is also filmed as one exposure and is available, for an additional charge, as a standard 35mm slide or as a 17”x 23” black and white photographic print. Most photographs reproduce acceptably on positive microfilm or microfiche but lack the clarity on xerographic copies made from the microfilm. For an additional charge, 35mm slides of 6”x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations that cannot be reproduced satisfactorily by xerography. 8703618 Stokes, Raymond George RECOVERY AND RESURGENCE IN THE WEST GERMAN CHEMICAL INDUSTRY: ALLIED POLICY AND THE I.G. FARBEN SUCCESSOR COMPANIES, 1945-1951 The Ohio Stale University Ph.D. 1986 University Microfilms International300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106 Copyright 1986 by Stokes, Raymond George All Rights Reserved RECOVERY AND RESURGENCE IN THE WEST GERMAN CHEMICAL INDUSTRY: ALLIED POLICY AND THE I.G. -
Declaralion of Fhe Professors of the Universities Andtechnical Colleges of the German Empire
Declaralion of fhe professors of the Universities andTechnical Colleges of the German Empire. * <23erltn, ben 23. Öftober 1914. (grfftfcung ber i)0d)fd)uttel)rer Declaration of the professors of the Universities and Technical Colleges of the German Empire. ^Btr £e£rer an ®eutfd)tanbg Slniöerjttäten unb iöod)= We, the undersigned, teachers at the Universities fcfyulen bienen ber <2Biffenfd^aff unb treiben ein <2Qett and Technical Colleges of Qermany, are scien be§ •Jrtebeng. 'tHber e3 erfüllt ung mit ©ttrüftung, tific men whose profession is a peaceful one. But bafj bie <5eittbe ©eutfcbjanbg, (Snglanb an ber Spttje, we feel indignant that the enemies of Germany, angeblich ju unfern ©unften einen ©egenfatj machen especially England, pretend that this scientific spirit wollen ättnfdjen bem ©elfte ber beutfd)en <2Biffenfct)aff is opposed to what they call Prussian Militarism unb bem, toag fte benpreufjif^enSOftlitariSmuS nennen. and even mean to favour us by this distinction. 3n bem beutfcfyen ioeere ift fein anberer ©eift als in The same spirit that rules the German army per- bem beutfd>en 93oKe, benn beibe ftnb eins, unb t»ir vades the whole German nation, for both are one gehören aucb, bagu. Slnfer £>eer pflegt aud) bie and we form part of it. Scientific research is culti- •JBiffenfcfyaft unb banft t^>r nicfyt gutn »enigften feine vated in our army, and to it the army owes £eiftungen. ©er ©tenft im &eere tnacfyt unfere Sugenb a large part of its successes. Military service tüct>tig aud) für alte "SBerfe be3 "JriebenS, aud) für trains the growing generation for all peaceful bie *3Biffenfd)aft. -

Restitution Request "Guelph Treasure" (Welfenschatz), Account of the Established Historical Facts on the Basis Of
1 Restitution Request "Guelph Treasure" (Welfenschatz) Account of the established historical facts on the basis of the provenance research carried out by the Prussian Cultural Heritage Foundation (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, SPK), As of 30.11.2010 - check against original text in German - Preliminary remarks: 1. The following text is an excerpt from the statement of the SPK sent to the legal representatives of the claimants on 30th November 2010. This statement was also presented to the Advisory Commission chaired by Professor Dr. Jutta Limbach (“Beratende Kommission”, or so-called “Limbach-Commission”), whose recommendation was announced on 20th March 2014. The text depicts what the SPK considers to have been the most important research results available to the foundation at that time. The account is in chronological order, beginning with the first sale attempts by the House of Guelph up to execution of the 1935 contract between the Dresdner Bank and the consortium. 2. The text presents the most important historical facts and processes considered verified by the SPK. In order to prepare this statement, extensive archive and literature research was carried out. A list of the evaluated files has been attached as Attachment 1, which explains – as far as applicable – the abbreviations used. During the evaluation of the procured files on the Guelph Treasure, a wealth of detailed information came together regarding the sales attempts since the 1920s. The respective historical document to which the account pertains is referenced in the footnotes. SPK cannot provide the full text version of the documents referred to in the footnotes due to archive right restrictions. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 25(1977) Heft 3
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von HANS ROTHFELS , THEODOR ESCHENBURG und HELMUT KRAUSNICK in Verbindung mit Theodor Schieder, Werner Conze, Karl Dietrich Erdmann, Paul Kluke, Walter Bußmann, Rudolf v. Albertini, Karl Dietrich Bracher, Dietrich Geyer, Hans Mommsen und Arnulf Baring Schriftleitung: Martin Broszat, Thilo Vogelsang, Hermann Graml Geschäftsführung: Hellmuth Auerbach Anschrift: Institut für Zeitgeschichte, 8 München 19, Leonrodstraße 46 b Tel. 0 89/180026 INHALTSVERZEICHNIS AUFSÄTZE Larry E. Jones Sammlung oder Zersplitterung? Die Bestrebungen zur Bildung einer neuen Mittelpartei in der Endphase der Wei marer Republik 1930-1933 .... 265 Ludolf Herbst Krisenüberwindung und Wirtschafts- neuordnung, Ludwig Erhards Beteili gung an den Nachkriegsplanungen am Ende des Zweiten Weltkrieges .... 305 Hans Günter Hockerts . Sozialpolitische Reformbestrebungen in der frühen Bundesrepublik, Zur Sozial reform-Diskussion und Rentengesetz gebung 1953-1957 341 DOKUMENTATION Die Entstehung und politische Bedeutung der „Neuen Blätter für den Sozialismus" und ihres Freundeskreises (Martin Martiny) . 373 NOTIZEN 420 BIBLIOGRAPHIE 41 Diesem Heft liegen ein Prospekt des Wilhelm Fink Verlages, München, sowie das Gesamtverzeichnis 1977 des Instituts für Zeitgeschichte, München, bei. Wir bitten um Beachtung. Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1, Neckarstr. 121, Tel. 2151-1. Preis des Einzelheftes DM 14.- = sfr. 16.80; die Bezugsgebühren für das Jahresabonne ment (4 Hefte) DM 42- = sfr. 50.40, zuzüglich Zustellgebühr. Für Studenten im Abonnement jährlich DM 34.-. Erscheinungsweise: Vierteljährlich. Für Abonnenten, die auch die „Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" im Abonnement beziehen (2 Bände im Jahr), beträgt der Abonnementspreis im Jahr DM 67.60; für Stu denten DM 59.60 (zuzüglich Versandspesen). Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und der Verlag entgegen. -

Der Weg Eines Monopols Durch Die Geschichte Zur Entstehung Und Entwicklung Der Deutschen Chemischen Industrie
Der Weg eines Monopols durch die Geschichte Zur Entstehung und Entwicklung der deutschen chemischen Industrie ... von Anilin bis Zwangsarbeit Eine Dokumentation des Arbeitskreises I.G.Farben der Bundesfachtagung der Chemiefachschaften Der Werg eines Monopols durch die Geschichte Zur Entstehung und Entwicklung der deutschen chemischen Industrie ... von Anilin bis Zwangsarbeit Eine Dokumentation der BundesFachTagung der Chemiefachschaften (BuFaTa Chemie) 2. korrigierte Auflage Juni 2007 (Printversion der online Ausgabe) Aachen, Bonn, Braunschweig, Freiburg, Karlsruhe, Würzburg 1994 Ulm, Darmstadt, Köln, Aachen 2007 ... von Anilin bis Zwangsarbeit Der Weg eines Monopols durch die Geschichte Zur Entstehung und Entwicklung der deutschen chemischen Industrie Eine Dokumentation der BundesFachTagung der Chemiefachschaften (BuFaTa Chemie) 1. Auflage September 1994 Herausgeber: AStA TU Berlin Druck: AStA TU Berlin 2. korrigierte Auflage Juni 2007 (Printversion der online Ausgabe) Herausgeber: BuFaTa Chemie Online-Ausgabe: http://www.bufata-chemie.de Druck und Vervielfältigung ausdrücklich erwünscht. Rückfragen können weiterhin über das BuFaTa Sekretariat (bufata- [email protected]) beantwortet werden. Die zu dem Reader gehörende Ausstellung kann ebenfalls über die gleiche Adresse bezogen werden. "Der Mann mit dem weißen Kittel schrieb Zahlen auf das Papier. Er machte ganz kleine zarte Buchstaben dazu. Dann zog er den weißen Kittel aus und pflegte eine Stunde lang die Blumen auf der Fensterbank. Als er sah, daß eine Blume eingegangen war, wurde er sehr traurig und weinte. Und auf dem Papier standen Zahlen. Danach konnte man mit einem halben Gramm in zwei Stunden tausend Menschen totmachen. Die Sonne schien auf die Blumen. Und auf das Papier." Wolfgang Borchert BuFaTaChemie ... von Anilin bis Zwangsarbeit Vorwort der 2. Auflage - online Ausgabe Nie wieder! zur Geschichte der I.G. -

President Pays Nation's Tribute to Soldier Dead
K ’-'r THE WEATHER Forecast by U. S. Weather Borean, NET vF R E S S r u n ^ H artford. a v r b a g e d a i l y circulation for the Month of October, 193§ M ostly cloudy tonlg^ht and Tues Conn. State Library—Comp day; rain Tuesday afternoon or night, not much change in tempera 5 , 5 2 2 ture. llembcrs of the Andit Bnrean of Circulatlona TWELVE PAGES PKICE rUKEE CENTS VOL. XLIV., NO. 36. The Mayor and the Manag’er Join the Red Cross SEN.ATETIE FOUR ARE DEAD, PROF.CDRTIUS PRESIDENT PAYS FIFTY HURT TAKES POST OF RAISES RATE NATION’S TRIBUTE IN RAIL CRASH DR.STRESEMANN ONTDNISTEN S jm m TO SOLDIER DEAD Absence of Vice-Pres. Curtis Four Day Coaches and Three j Appointed Minister of For- K Defeats G. 0. P. Finance Places Wreath at Tomb of Pulhnan Cars Leave the’ eign Affairs for Germany; PRICES S H IP Committee’s Amendment Unknown Soldier in Ar Tracks; Victims Are from i Has Brilliant Record; Not s WHENTRADBS s V of House Rate. lington Cemetery; Armis Ohio and Michigan. Well Known. Washington, Nov. 11— (AP) — !(EEP SELlINfi tice Day Observed All Berlin, Nov. i i .— (A P )— Professor j Vice P;-esident Curtis’ presence in Oakdale, Tenn., Nov. 11.— (AP.) Chicago today for an Armistice Day Julius Curtius, acting minister for Four persons were known to have address, prevented the breaking of Over State and Nation. foreign affairs, was appointed to been killed and over fifty passen : a 31 to 31 vote in the Sente and re- Scores of Active Stocks Car that portfolio today to succeed the I suited in the defeat of a Republican gers injured in the wreck near here late Dr. -

Katharina Von Kardorff-Oheimb (1879–1962) in Der Weimarer Republik Digitaler Anhang
Cornelia Baddack Katharina von Kardorff-Oheimb (1879–1962) in der Weimarer Republik Unternehmenserbin, Reichstagsabgeordnete, Vereinsgründerin, politische Salonnière und Publizistin Digitaler Anhang Bibliografie zu Katharina von Kardorff-Oheimb Biografische Zeittafel (1879–1962) Politische Bildungsveranstaltungen unter der Leitung Katharina von Kardorff-Oheimbs Personenlisten © 2016 Cornelia Baddack Bibliografie zu Katharina von Kardorff-Oheimb Das bibliografische Verzeichnis listet die aus verschiedenen Provenienzen zusam- mengetragenen Veröffentlichungen von und über Katharina von Kardorff-Oheimb auf. Dabei finden sich hier auch solche Beiträge erwähnt, aus denen in der Unter- suchung selbst nicht zitiert wurde, während unter den insgesamt recherchierten Veröffentlichungen über die Politikerin nicht zuletzt aus Gründen der Übersicht- lichkeit eine bewusste Auswahl vorgenommen wurde. Beiträge von Katharina von Kardorff-Oheimb (1919–1932/ 1965) Der erste Abschnitt stellt alle Publikationen von Kardorff-Oheimb zusammen, die für den Erscheinungszeitraum der Weimarer Republik (abgesehen von der erst 1965 erschienenen Auto/Biografie „Politik und Lebensbeichte“) recherchiert wer- den konnten. In je chronologischer Anordnung werden die folgenden Publikations- typen aufgelistet: – eigenständige Publikationen in Form von Buchveröffentlichungen, – Zeitungsartikel und – Vorträge. Buchveröffentlichungen (1928–1931/ 1965) Kardorff, Katharina von: Der Erfolg der Frau in unserer Zeit, in: Lewin, Ludwig (Hg.): Der erfolgreiche Mensch. Bd. 2: Der gesellschaftliche Erfolg: Men- schenkenntnis – Wirkung auf Menschen – Umgang mit Menschen, Berlin 1928, S. 353–370. Kardorff, Katharina von: Die Frau im modernen Staat, in: Zehn Jahre deutsche Geschichte 1918–1928, Berlin 1928, S. 525–534. Kardorff, Katharina von; Beil, Ada: Gardinen-Predigten, Berlin 1929. Kardorff, Katharina von: Brauchen wir eine Frauenpartei?, in: Schmidt-Beil, Ada (Hg.): Die Kultur der Frau. Eine Lebenssymphonie der Frau des XX. Jahrhun- derts, Berlin 1931, S. -

Work, Race, and the Emergence of Radical Right Corporatism in Imperial Germany Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Geoff Eley, Series Editor
Work, Race, and the Emergence of Radical Right Corporatism in Imperial Germany Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Geoff Eley, Series Editor Series Editorial Board Kathleen Canning, University of Michigan David F. Crew, University of Texas, Austin Atina Grossmann, The Cooper Union Alf Lüdtke, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Germany Andrei S. Markovits, University of Michigan Recent Titles After the Nazi Racial State: Difference and Democracy in Germany and Europe, Rita Chin, Heide Fehrenbach, Geoff Eley, and Atina Grossmann Work, Race, and the Emergence of Radical Right Corporatism in Imperial Germany, Dennis Sweeney The German Patient: Crisis and Recovery in Postwar Culture Jennifer M. Kapczynski Topographies of Class: Modern Architecture and Mass Society in Weimar Berlin, Sabine Hake Neither German nor Pole: Catholicism and National Indifference in a Central European Borderland, James E. Bjork Beyond Berlin: Twelve German Cities Confront the Nazi Past, edited by Gavriel D. Rosenfeld and Paul B. Jaskot The Politics of Sociability: Freemasonry and German Civil Society, 1840–1918, Stefan-Ludwig Hoffmann Work and Play: The Production and Consumption of Toys in Germany, 1870 –1914, David D. Hamlin The Cosmopolitan Screen: German Cinema and the Global Imaginary, 1945 to the Present, edited by Stephan K. Schindler and Lutz Koepnick Germans on Drugs: The Complications of Modernization in Hamburg, Robert P. Stephens Gender in Transition: Discourse and Practice in German-Speaking Europe, 1750 –1830, edited by Ulrike Gleixner and Marion W. Gray Growing Up Female in Nazi Germany, Dagmar Reese Justice Imperiled: The Anti-Nazi Lawyer Max Hirschberg in Weimar Germany, Douglas G. Morris The Heimat Abroad: The Boundaries of Germanness, edited by Krista O’Donnell, Renate Bridenthal, and Nancy Reagin Modern German Art for Thirties Paris, Prague, and London: Resistance and Acquiescence in a Democratic Public Sphere, Keith Holz The War against Catholicism: Liberalism and the Anti-Catholic Imagination in Nineteenth- Century Germany, Michael B.