Christoph Blocher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
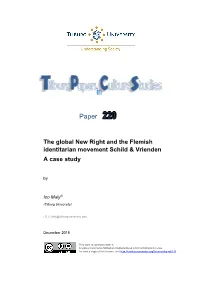
The Global New Right and the Flemish Identitarian Movement Schild & Vrienden a Case Study
Paper The global New Right and the Flemish identitarian movement Schild & Vrienden A case study by Ico Maly© (Tilburg University) [email protected] December 2018 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ The global New Right and the Flemish identitarian movement Schild & Vrienden. A case study. Ico Maly Abstract: This paper argues that nationalism, and nationalistic activism in particular are being globalized. At least certain fringes of radical nationalist activists are organized as ‘cellular systems’ connected and mobilize-able on a global scale giving birth to what I call ‘global nationalistic activism’. Given this change in nationalist activism, I claim that we should abandon all ‘methodological nationalism’. Methodological nationalism fails in arriving at a thorough understanding of the impact, scale and mobilization power (Tilly, 1974) of contemorary ‘national(istic)’ political activism. Even more, it inevitably will contribute to the naturalization or in emic terms the meta-political goals of global nationalist activists. The paradox is of course evident: global nationalism uses the scale- advantages, network effects and the benefits of cellular structures to fight for the (re)construction of the old 19th century vertebrate system par excellence: the (blood and soil) nation. Nevertheless, this, I will show, is an indisputable empirical reality: the many local nationalistic battles are more and more embedded in globally operating digital infrastructures mobilizing militants from all corners of the world for nationalist causes at home. Nationalist activism in the 21st century, so goes my argument, has important global dimensions which are easily repatriated for national use. -

The Political Economy of Right-Wing Populism and Euroscepticism in Switzerland
The Political Economy of Right-wing Populism and Euroscepticism in Switzerland. Abstract We provide an explanation for Euroscepticism in Switzerland – and for the rise of the political right throughout the decade of the nineties – by looking at the effects of fundamental changes in the economy in the context of globalization and Europeanization. These effects are measured by comparing two Federal referendums: the 1992 referendum on the European Economic Area (EEA) and the Schengen/Dublin referendum of the year 2005. Both referendums are used as a measure of attitudes in favour or against European integration. We use the cleavage of tradable/non-tradable goods as an indicator for globalization effects. Previous studies have identified several cleavages present in Swiss society, and their effects on referenda, but no in-depth study considers the impact of economic factors on foreign policy related referenda. This study reaches the conclusion that the structural changes induced by globalization are relevant throughout the decade of the nineties for explaining the results of the 1992 referendum and possibly also in the rise of the political right. As the economy has successfully – albeit slowly – adapted to new conditions, the cleavage seems to have faded away. March 2017 Stefan Collignon London School of Economics and Harvard University The Mindade Gunzburg Center for European Studies 27 Kirkland street at Cabot way, Cambridge, MA, 02138 Phone: +1 617 495 4303, ex.227 [email protected] Omar Serrano Graduate Institute of International Studies, Geneva. Rue de Lausanne 132, PO Box 36, CH 1211 Geneva 21 Phone : +41 (0)22 908 59 47 [email protected] Keywords Euroscepticism; EU integration; Globalization; Europeanisation; Right-wing populism; Political economy; Switzerland 1 The Political Economy of Right-wing Populism and Euroscepticism in Switzerland Introduction Europe has seen, since the late 1980s and early 1990s, the re-emergence of right- wing extremism and populism. -

Personenfreizügigkeit: Paketlösung Kommt Vors Volk
SVP-Klartext DIE ZEITUNG DES MITTELSTANDES SVP lehnt undemo- Die Finanzkrise – kratisches Personen- Folgen und notwendige freizügigkeits-Paket Massnahmen für die Ja zur Unverjährbarkeit ab! Schweiz. pornographischer Von Nationalrätin Von a. Bundesrat Straftaten an Kindern! Jasmin Hutter Christoph Blocher Von Nationalrat Oskar Freysinger! Seite 5 Seite 7 Seite 9 AZB Zofi ngen – Preis Fr. 35.– jährlich – erscheint monatlich – Aufl age 57 263 Expl. – www.svp.ch – [email protected] – Ausgabe Nr. 11/2008 Lehre aus der Krise: Mehr Schweiz Personenfreizügigkeit: Nationalrat Toni Brunner S. 3 Paketlösung kommt vors Volk SVP muss Gegensteuer geben Nationalrat Felix Müri S. 4 Am 8. Februar 2009 stimmt das Schweizer Volk über die beiden verknüpften Vorlagen zur Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit den bisherigen EU-Staaten und zur Ausdehnung dieses Abkommens auf Minister Steinbrück und die die neuen Mitglieder Rumänien und Bulgarien ab. Nachdem die SVP auf ein Referendum verzichtet hat- Peitsche – ein Trauerspiel te, weil sie das undemokratische Marco Duller S. 6 Vorgehen des Parlaments und des Die Kunst, die Realität zu Bundesrates, welches auf zwei Fra- negieren und das gesetzte gen nur eine Antwort zulässt, nicht Ziel zu verpassen mittragen konnte. Nationalrat Guy Parmelin S. 10 HarmoS fördert Zum heutigen Zeitpunkt stellt sich Parallelgesellschaft nun aber eine andere Frage, die Hermann Lei S. 12 Volksabstimmung kommt zustande und die SVP muss entscheiden, wie HarmoS: Verstaatlichung sie sich an der Urne verhält. Gerade der Erziehung und in der aktuellen Situation, mit dem Entmündigung der Eltern Andreas Bazzon und weltweiten Druck auf die Finanz- Roy Spahr S. 13 märkte und einer sich abzeichnen- den Rezession, ist die Öffnung unse- Die Integration geht nicht rer Grenzen für Abeitnehmer aus baden Rumänien und Bulgarien nicht im Nationalrat Thomas Hurter S. -

The State of Right-Wing Extremism in Europe
Policy Area: Focus on Right-Wing Extremism European Union Center of North Carolina EU Briefings, March 2012 The State of Right-Wing Extremism in Europe Since the 1980s, a family of political parties, often labeled “Extreme Right” or “Far Right”, has made significant inroads in Western Europe. Common to nearly all of these parties is a strong opposition to immigration (particularly non-European immigration), a willingness to exploit cultural tensions between Muslims and others, and a populist discourse pitting “the people”, who they claim to represent, against political elites. There are also significant differences. Some, like the Norwegian Progress Party, started out as anti-tax movements and promoted market liberal economics; others, like the French Front National, tend to adopt an anti-neoliberal stance. Some, such as the Austrian Freedom Party, have neo-Nazi or anti-Semitic histories; others, like the PVV in the Netherlands, are ostensibly motivated by a desire to protect “Enlightenment values”. But regardless of these distinctions, most of these so-called Extreme Right Parties (ERPs) have grown remarkably over the past three decades. Outside these party politics, a number of Extreme Right street movements have also flourished in the past decade. In the UK, France, and Italy these movements have been associated with civil disruption and violence. In addition, a small number of Extreme Right activists have recently carried out politically motivated atrocities. This brief focuses mainly on Western Europe, since ERPs in Central and Eastern Europe are significantly different in nature and operate in party systems that prevent straightforward comparisons across East and West – and, for the most part, appear to pose a lesser threat. -

Globalization Issue Debate Dataset, Version 1
PolDem – Globalization Issue Debate Dataset - Version 1 - poldem-debate_glob Please cite as: Kriesi, Hanspeter, Grande, Edgar, Dolezal, Martin, Helbing, Marc, Höglinger, Dominic, Hut- ter, Swen, and Wüest, Bruno. 2020. PolDem-Globalization Issue Debate Dataset, Version 1. Short version for in-text citations & references: Kriesi, Hanspeter et al. 2020. PolDem- Globalization Issue Debate Dataset, Version 1. www.poldem.eu 1 Introduction The codebook lists the variables in the PolDem Globalization Issue Debate dataset and ex- plains our strategy of data collection (also in case, you want to update the dataset yourself). This media-based dataset on debates over European integration, immigration, and economic liberalization has been collected in the framework of the project “National Political Change in a Globalizing World”, financed by the German Research Council DFG and the Swiss Nation- al Science Foundation SNF. The user of the dataset should check out the book Political Con- flict in Western Europe by Kriesi et al. (https://doi.org/10.1017/CBO9781139169219 ). It shows what can be done with the dataset. The countries covered are Austria, Britain, France, Germany, Switzerland, and the Nether- lands. The debates cover the years 2004 to 2006 – for the immigration debate, we also coded con- tent from the years 1999-2001. Variables in the Dataset Variable name Values core_ID 43,060 unique values [1,53686] cs_art_n 79 unique values [1,79] cs_art_N 38 unique values [1,79] 1 Europ. Integration debate 2 Immigration 3 Eco. Liberalization debate_str -

FDP Gegen SVP, Manager Gegen Unternehmer
IM GESPRÄCH «Eine Hodler- Ausstellung wäre schon interessant.» «Da können Sie auf mich zählen.» FDP gegen SVP, 345 Manager gegen NZZ FOLIO — NR. NZZ FOLIO Unternehmer, verhinderter Hotelier gegen verhinderten Knecht: Walter Kielholz trifft Christoph Blocher. 54 Sie gelten als Feinde. Als Alphatiere, die seit Jahr- zehnten ihre gegenseitige Abneigung pflegen. Walter Kielholz warf Christoph Blocher vor, aus der SVP eine «rechtsbürgerliche Kampfpartei» gemacht zu haben. Blocher sagte im vergangenen Jahr der «Weltwoche»: «Die NZZ ist zurzeit das Sprachrohr gegen die selbstbewusste Schweiz. Die treibenden Kräfte findet man im Epizentrum der Credit Suisse und deren Umgebung.» Damit meinte er Kielholz. Nun treffen sich die beiden Herren im getäfelten Komiteezimmer der «Neuen Zürcher Zeitung» zu ihrem ersten Doppelinterview. Christoph Blocher ist mit dem Zug gekommen, Walter Kielholz zu Fuss. Sie sprechen über die EU, das institutionelle Abkom- men, die eigene Herkunft, die Migros und ignorante ausländische Manager. Nach über zwei Stunden wird klar: Die alten Kontrahenten haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb sein kann. Wann sind Sie sich zum ersten Mal begegnet? Christoph Blocher: Keine Ahnung. Es scheint kein bleibendes Ereignis gewesen zu sein. Walter Kielholz: Ich weiss es noch. Das war nach der Abstimmung über die Bilateralen I vor 20 Jahren bei einer Tagung in Vevey bei Nestlé. Sie gelten als Antipoden: Walter Kielholz, Manager, graue Eminenz der FDP, Ex-Verwal- tungsratspräsident der Credit Suisse und Freund der EU. Christoph Blocher, Unterneh- mer, SVP-Patron, Ex-UBS-Verwaltungsrat und EU-Gegner. Wie stehen Sie zueinander? Kielholz: Diese Ambivalenz ist jetzt etwas kon- struiert. Ich bin übrigens nicht sicher, wie stark Herr Blocher wirklich Teil des UBS-Netzwerks war. -

KAS Auslandsinformationen 03/2012
3|2012 KAS INTERNATIONAL REPORTS 53 creaky concordance system Parliamentary and Governmental elections in switzerland: divided conservatives defeated by consensus-oriented centre-riGht Parties Burkard Steppacher Elections in Switzerland have become quite exciting in recent years. The cooperation between the traditional ruling parties, which have been in power in a grand coali- tion since the end of the 1950s, has clearly been thrown into crisis,1 new parties have entered parliament and the political concordance that has existed for decades has started to creak and shift. However, it appears that these changes have not yet found a permanent footing.2 Prof. Dr. Burkard Steppacher is a staff member of the Every four years there are federal elections to select a new Konrad-Adenauer- parliament in Switzerland, a country with one of the most Stiftung Scholarship constitutionally stable political systems, both in Europe Programme and Honorary Professor 3 and the world. The larger chamber (National Council) has of Political Science 200 members and the smaller chamber (Council of States) at the University of has 46 members, with two members per canton, although Cologne. six so-called “half cantons” only have one member each. Once the members of both parliamentary chambers have been chosen, the chambers, which together make up the Federal Assembly, then elect the country’s seven-member federal government (Federal Council). The elections were watched with great interest in 2011, as there was the real possibility of a change to the federal government. 1 | Cf. Burkard Steppacher, “Die Krise der Konkordanz‟, Blätter für deutsche und internationale Politik, 2/2008, 19-22; Michael Hartmann, Konkordanz in der Krise. -

The Party for Switzerland Publication Data
PARTY PROGRAMME 2015–2019 SVP – the party for Switzerland Publication data Party programme of the Swiss People’s Party 2015 – 2019 No. of copies: 70,000 Picture sources: Belmundo AG, Compagnia Rossini, Dreamstime, Ex-Press AG, Fotolia LLC, Goal AG, ImagePoint AG, iStockphoto, KEYSTONE AG, Marcus Gyger, Markus Hutter, Stefan Marthaler, REDOG, Remo Nägeli, Stadler Rail AG, VSMR SVP Schweiz, Generalsekretariat, Postfach 8252, 3001 Bern [email protected], www.svp.ch PARTY PROGRAMME 2015–2019 Contents 4 Our agenda 8 Preserve Swiss pillars of success 10 Foreign policy 16 Finances, taxes and levies 22 Switzerland as a workplace 26 Property 30 Policy on foreigners 36 Asylum policy 42 Security 46 Army 50 Education 54 Social security system 58 Health care 62 Agriculture 66 Transport 70 Energy 74 Environment 78 Media 82 Sport 86 Cultural policy 90 Religion 94 The individual, family and society 4 Our agenda for a free, independent and sovereign Switzerland – overview FOREIGN POLICY POLICY ON FOREIGNERS Independence and self-determination Limit immigration The SVP advocates the preservation of an independent and neutral Switzerland has always offered a generous but controlled welcome to Switzerland. The sale of Swiss sovereignty and self-determination by foreign workers, and provided them with job prospects. In various the political elite must be stopped. Therefore, our country must no votes, the Swiss electorate has demonstrated that it wishes controlled longer be insidiously integrated into international structures such as immigration, with clear rules that apply to all. Anyone who comes to the EU. On the basis of neutrality, the SVP commits to a credible pol- Switzerland is required to obey the local laws, integrate and earn their icy of good offices, mediation and humanitarian aid. -

Centre-Periphery Cleavage in Switzerland the Case of the Lega Dei Ticinesi
CHAPTER 9 Multi-Level Populism and Centre-Periphery Cleavage in Switzerland The Case of the Lega dei Ticinesi Oscar MAZZOLENIl Ever since its foundation in 1991, the Lega dei Ticinesi has been a significant feature of Swiss politics, particularly in Ticino, the Italian- speaking canton located at the south of the Alps. Today, the Lega dei Ticinesi is the only Swiss party to reflect a political centre-periphery cleavage, while promoting a dominant anti-establishment rhetoric. Over the last ten years, it has achieved significant electoral success. At its height, during the second half of the 1990s, the party could count on polling around 20% of the vote at cantonal level. Today, after the decline registered in the cantonal and federal elections of 2003, the Lega dei Ticinesi retains a share of around 8-10%. Until now, scholars have investigated the origins and the historical antecedents of the Lega dei Ticinesi (Knusel and Hottinger, 1994; Maz,- zoleni, 1995), its relationship with the political system in the canton Ticino (Mazzoleni, 1999) and its analogies and differences with regard to Christoph Blocher's Swiss People's Party (Schweizerische Volkspartei) (Mazzoleni, 2003a and 2003b; Betz, in this volume). However, the analysis of the Lega dei Ticinesi's rhetoric has yet to go beyond an essentially descriptive approach. It has been observed that it expresses a "populist" rhetoric on various levels, trom the national level through the regional and the local levels (Bohrer, 1993: 47 ff.). However, this rhetoric has not been analysed in terms of the opportunities offered by the cultural, economic, and political-institutional context. -

Right-Wing Populism in Austria and the United States —A Comparative View
Right-Wing Populism in Austria and the United States —A Comparative View by Eric Frey side associates with the right wing of the Republican Party Second Annual Botstiber Lecture on Austrian-American Affairs at the and its various aligned movements such as the Christian Austrian Embassy, Washington, D.C. on June 4, 2010. Right, the NRA, or, today, the Tea Party movement. Most I feel deeply honored by your invitation to give the Europeans cannot understand the motives of people who second annual Botstiber Institute Lecture on Austrian- despise the United Nations, reject gun control and oppose American Studies, especially to follow in the footsteps of providing basic health care. For them, the American right our former chancellor Alfred Gusenbauer. I believe that is a major threat to world peace, the principles of human you may have chosen me because of the central role that rights and even their personal futures. transatlantic relations played in my work and in my life. I see a similar deep-seated concern among American I studied and taught in the United States. I have close observers about signs of resurgence of far-right parties in family here. I have published extensively on American Austria, in Hungary or in Western European countries. politics. Sometimes I have been very critical but always Aware of the history of fascism, many Americans, and with a deep-felt love for this country. particularly American Jews, are deeply unsettled by In fact, my emotional ties to the US go deeper than that, ideologies and political forces that look like a throwback and they have to do with my family history. -

In Den Bundesrat Geprügelt Noch Grösser
180 Musterbeispiel für einen Leserbrief 181 Musterbeispiel für einen Leserbrief, allerdings mit «Fehlern»: Leserbrief vom 12. Dezember 2003 – mit der Bitte um baldige Publikation «Blick» beispielsweise führte jahrelang eine Kampagne gegen Blocher mit dem Ziel, ihn zu zerstören. Resultat: Der kleine Herrliberger wurde In den Bundesrat geprügelt noch grösser. Und zu einem Märtyrer – eine Rolle, die er sorgsam pflegt. Qualitätszeitungen leiden seit 1992 an einer Blocher-Fixierung. Mit gro- Wie Christoph Blocher und die Massenmedien voneinander tesken Folgen: Wenn er an der Generalversammlung der Trachtengrup- profitieren.2 pe Edelweiss in Hintermümliswil mit dem linken Auge zwinkert, hat das «Blocher am Ziel: Bundesrat», Tages-Anzeiger vom 11. Dezember Newswert5 erster Güte. Und heult ein Lead-Medium5 auf, stimmen die anderen ein. Das bekannte Rudelverhalten der Wölfe. Für Reflexion so- Die Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat ist auch ein Lehr- wie journalistische Gewichtung und Einordnung bleibt kaum mehr Zeit. stück über die Rolle der Massenmedien. 1986 verpassten ihm die Jour- Da stellt sich unweigerlich die Frage, ob die Medien ihre Kernaufgaben nalisten das Etikett «Volkstribun», weil die von ihm mitbegründete Auns3 noch wahrnehmen – oder wahrnehmen wollen. dem Bundesrat ein erstes Waterloo bereitete. Die Abstimmung über den Uno-Beitritt3 fiel mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 75 Prozent durch. Blocher und die Massenmedien – sie beobachten sich argwöhnisch, ge- Im schicksalhaften Jahr 1992 mutierte Blocher definitiv zur Reizfigur reizt, womöglich sogar mit Verachtung. Gleichzeitig profitieren sie vonein- par excellence, weil er, so die mediale Verkürzung, die Schlacht um den ander: Die Medien bolzen mit ihm Quoten und Auflagen, er missbraucht EWR-Vertrag3 im Alleingang gewann. -

Right Wing Populism in Europe: a Discoursive Rhetoric Focused on European Union, Ethno-Nationalism, Democracy and Globalization
RIGHT WING POPULISM IN EUROPE(DE CUETO NOGUERAS) Article RIGHT WING POPULISM IN EUROPE: A DISCOURSIVE RHETORIC FOCUSED ON EUROPEAN UNION, ETHNO-NATIONALISM, DEMOCRACY AND GLOBALIZATION DE CUETO NOGUERAS, Carlos Key words: Right-wing parties, populism, Euroscepticism, ethno-nationalism, democracy, globalization. 1. POPULISM IN SOCIAL SCIENCES AND POLITICAL ANALYSIS. Despite the fact that the term “populism” is highly ambivalent, it is increasingly used in the social sciences and has become a particular field in political analysis, without being precisely defined. Populism is a particular political rhetoric, which extremely simplifies complex problems and offers apparently easy, painless but at the same time vague solutions. However, due to the negative connotation of the term, far-right populist parties prefer to define themselves to be centrists, reject most of labels normally associated with them -con- servative, right-wing, racist, xenophobic- and threaten to take legal actions or denounce in some cases media companies and journalists who do. After a Swedish journalist of Sveriges Radion called the Sweden Democrats party xenophobic in 2013, the party reacted with a complaint lodged to the broadcasting regulator. In 2014, the Supreme Court of Hungary ruled that Jobbik couldn’t be labelled “far-right” in any domestic radio or television transmission. They present themselves as common men and women who understand and represent people, especially the under-privileged and under-represented segments, who know and voice their concerns, in contrast to the corrupt and established elites. Populism relies on charismatic leaders with decisive roles in their parties and on popular support. Populism respects the basic criteria of democracy but rejects all existing ideologies as insufficient for the particular society and tries to find and adopt its “own new path”.