Aus Der Geschichte Der Aargauer Nordwestecke
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

So Geht's: Die Schatzsuche
Eine Beilage der «Neuen Fricktaler Zeitung» Donnerstag, 1. Juli 2021 Auch digital auf www.nfz.ch Freizeit-Tipp für die Sommerzeit vom 4. Juli bis 17. Oktober 2021 Die Schatzsuche – so geht’s: Entdecke spielerisch die lieblichsten Landschaften und faszinierendsten Winkel im Fricktal. Die «Neue Fricktaler Zeitung» nimmt dich mit auf Schatzsuche in die Tal- schaft Mettauertal und ins westlichste Dorf im Fricktal nach Kaiseraugst. Wähle eine Route Notiere deine Zahlen auf der Karte, denn sie bilden Suche den Startpunkt auf der Karte und folge den am Schluss den Zahlencode – den Schlüssel zum Anweisungen. Orientiere dich an den durchnum- Schatz. merierten Bildern und den schriftlichen Hinweisen deiner Route. Schatztruhe gefunden? Dann schliesse sie auf. Du entnimmst eine Postkarte Knacke den Code und füllst sie aus. Dank der ausgefüllten Postkarte Camping Kaiseraugst Unterwegs erwarten dich schöne Aussichten und nimmst du an der Verlosung der Monats- sowie der wichtige Zahlen. Sammle diese Zahlen, beobachte Hauptpreise teil. Gewinne den Goldschatz! genau und rechne flink. So löst du die Rätsel und kommst dem Schatz näher. Und nicht vergessen: Alles weitere auf oder in der Schatztruhe. Kaiseraugst: Abkühlung im schönen Rhein Spielplatz Oberhofen Flösserherberge Hottwil Wichtig: Stift mitnehmen! • Während der Schatz suche müssen immer wieder Zahlen notiert werden. Zwei spannende Touren warten auf dich. • Am Ende jeder Route gelangst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuss zurück zum Startpunkt. Die entsprechenden Angaben findest du am Die NFZ hat an zwei Orten im Fricktal einen Schatz versteckt. Zielort. U-Abo, Juniorkarten usw. nicht vergessen. • Wir verhalten uns gegenüber der Natur, Flora und Fauna respektvoll! 10 GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN 10 GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN 20 geref.ch GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN 10 GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN 20 50 GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN 50 Der ideale Geschenk-Schatz:20 GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN Jetzt GESCHENKGUTSCHEINFRANKEN Beratungstermin vereinbaren. -

Canton of Basel-Stadt
Canton of Basel-Stadt Welcome. VARIED CITY OF THE ARTS Basel’s innumerable historical buildings form a picturesque setting for its vibrant cultural scene, which is surprisingly rich for THRIVING BUSINESS LOCATION CENTRE OF EUROPE, TRINATIONAL such a small canton: around 40 museums, AND COSMOPOLITAN some of them world-renowned, such as the Basel is Switzerland’s most dynamic busi- Fondation Beyeler and the Kunstmuseum ness centre. The city built its success on There is a point in Basel, in the Swiss Rhine Basel, the Theater Basel, where opera, the global achievements of its pharmaceut- Ports, where the borders of Switzerland, drama and ballet are performed, as well as ical and chemical companies. Roche, No- France and Germany meet. Basel works 25 smaller theatres, a musical stage, and vartis, Syngenta, Lonza Group, Clariant and closely together with its neighbours Ger- countless galleries and cinemas. The city others have raised Basel’s profile around many and France in the fields of educa- ranks with the European elite in the field of the world. Thanks to the extensive logis- tion, culture, transport and the environment. fine arts, and hosts the world’s leading con- tics know-how that has been established Residents of Basel enjoy the superb recre- temporary art fair, Art Basel. In addition to over the centuries, a number of leading in- ational opportunities in French Alsace as its prominent classical orchestras and over ternational logistics service providers are well as in Germany’s Black Forest. And the 1000 concerts per year, numerous high- also based here. Basel is a successful ex- trinational EuroAirport Basel-Mulhouse- profile events make Basel a veritable city hibition and congress city, profiting from an Freiburg is a key transport hub, linking the of the arts. -

Zuzgen Abfall-Info 2021
Entsorgungs- und Recyclingkalender «Mit der Abfall-App der GAF-Region 2021 verpasse ich keine Entsorgungen mehr» PS: QR-Code einlesen, Entsorgungskalender Zuzgen wählen, Sammlung aktivieren – fertig! GAF Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung unteres Fricktal Schulstrasse19 4315 Zuzgen Tel. 061 843 94 66 [email protected] www.abfall-gaf.ch Alle Informationen fi nden Sie auf Gemeindekanzlei Zuzgen unserer Website Tel. 061 875 95 75 Fax 061 875 95 70 www.abfall-gaf.ch gemeindeverwaltung@ zuzgen.ch Entsorgungs- und Recyclingkalender 2021 Zuzgen Tourenplan Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Weihnachts- Mi. 06. bäume 13. Papier Mo. 22. 03. 06. 06. Karton Di. 23. 04. 07. 07. Häckseldienst Mo. 25. 15. 03. 25. 22. Kunststoff in Do. 14. 11. 11. 08. 06. 03. 01. 12. 09. 07. 04. 02. Gebühren- 28. 25. 25. 22. 20. 17. 15. 26. 23. 21. 18. 16. säcken 29. 30. Werkhof- Elektroschrott, Leuchtmittel, Bausperrgut, Altmetall und Altöl: Sa. entsorgung 06.02., 15.05., 04.09. und 06.11.von 10.00 – 11.00 Uhr Sammelstelle Alte Säge Grüngut- Jeweils Mittwochs container Jeweils Freitags, ausser Mi. 30.12.2020 für Neujahr 01.01.2021 / Haushaltkehricht Mi. 31.03. für Karfreitag 02.04. Wir holen… Bereitstellung Hauskehricht, Sperrgut und Container Frühestens am Abfuhrtagmorgen, bis spätestens Hauskehricht in Abfallsäcken 07.00 h. Gebührenpflichtig mit GAF-Abfall-Vignette. 17-Liter-Sack = 1⁄2 Vignette (Wert: CHF 0.90) An allgemeinen Feiertagen findet keine Abfall-Entsor- 35-Liter-Sack = 1 Vignette (Wert: CHF 1.80) gungs-Tour statt. Die Ersatztouren werden zusätzlich 60-Liter-Sack = 2 Vignetten (Wert: CHF 3.60) im fricktal.info publiziert. -

150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg 150 Jahre Stift Olsberg Impressum Herausgeber: Kanton Aargau, Dep. BKS Satz und Druck: Herzog Medien AG, Rheinfelden Umschlag: Aufnahme Adi Tresch, 25.07.2006, Gasballonpilot Silvan Romer Fotos: Wenn nicht anders vermerkt: Stift Olsberg Auflage: 1200 Exemplare ©2010 bei den Autoren Inhalt Vorwort Alex Hürzeler . 7 Vorwort Urs Jakob . 8 Die Zisterzienserinnen vom Gottesgarten Jürg Andrea Bossardt . 13 Pädagogik und Bau im Wandel Joseph Echle-Berger Einleitung . 21 Die geographische Lage . 22 Die Liegenschaftspolitik des Kantons nach der Klosteraufhebung . 23 Das Klostergebäude in der Zwischennutzung . 26 Der Übergang von der privat geführten «Pestalozzistiftung der deutschen Schweiz» an das Erziehungsdepartement des Kantons Aargau . 37 Die Erziehungsanstalt Pestalozzistiftung und ihre Leiter von 1860–1942 . 42 Die Erziehungsanstalt wird zur «Staatlichen Pestalozzistiftung Olsberg» 1946 . 54 Die Staatliche Pestalozzistiftung Olsberg und ihre Leiter von 1955–1999 . 57 Die Staatliche Pestalozzistiftung Olsberg wird zum Stift Olsberg 2006 . 67 Heutiger Betrieb Urs Jakob . 75 Leitbild . 75 Schule / Sozialpädagogik . 77 Dienste – Spezialangebot / Ärztliche Beratung & Beratende Dienste . 78 Aufnahmekriterien / Aufnahmeverfahren . 78 Förderplanung . 80 Austritt/nach dem Austritt . 81 Führung / Mitarbeitende / Raumvermietungen und Führungen / Landwirtschaft / Ausblick . 82 Schlussbemerkung . 83 Die Sicht der Kulturhistorischen Schule auf Fragen der Erziehung Margarethe Liebrand . 87 5 6 Vorwort des Regierungsrates Liebe Leserin, -
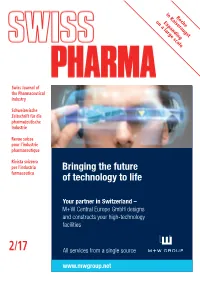
Roche in Kaiseraugst Expanding on a Large Scale Swiss Journal of The
in Kaiseraugst Roche on a Expandinglarge scale Swiss Journal of the Pharmaceutical Industry Schweizerische Zeitschrift für die pharmazeutische Industrie Revue suisse pour l’industrie pharmaceutique Rivista svizzera per l’industria farmaceutica 2/17 PHARMA. COMPETENCE. COMBINED. Visit us in Hall 16, Stand A25 We are partner of the international pharma and biotech industry and offer solu- tions for the safe and efficient manufacturing, inspection and packaging of pharmaceutical products. Worldwide leading technical know how, excellent services and personal contact are the base of our long-term relationships. wwww.medipak-systems.com Swiss Journal of SWISS PHARMA 39 (2017) Nr. 2 the Pharmaceutical Industry Schweizerische Zeitschrift für die pharmazeutische Industrie Revue suisse pour l’industrie pharmaceutique Rivista svizzera per l’industria farmaceutica 2/17 CONTENTS COVER IMPRINT 2 Further Development of the Basel and Kaiseraugst Site F. Hoffmann-La Roche Ltd – One billion Swiss francs for expansion in Kaiseraugst – three billion Swiss francs for transformation of the Basel site Special issue SWISS PHARMA 2/2017 Published in cooperation with the company F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel and Kaiseraugst • This issue of SWISS PHARMA 2/2017 • also is available as SWISS PHARMA 1/2017 in a German version. • • • SWISS PHARMA 39 (2017) Nr. 2 1 IMPRESSUM Verlag, Einzelhefte, Anzeigen: VERLAG DR. FELIX WÜST AG In der Hinterzelg 4 • CH-8700 KÜSNACHT ZH (SCHWEIZ) Telefon +41 (0)44 918 27 27 • Telefax +41 (0)44 918 29 70 E-Mail: [email protected] www.verlag-dr-felix-wuest.ch Redaktion: 1/16 Dr. rer. publ. Felix Wüst © by VERLAG DR. -

Inhaltsverzeichnis
Akademischer Bericht Departement Umweltwissenschaften über Aktivitäten und Ereignisse im Jahr 2017 Leitung während der Berichtsperiode: Dieter Ebert Basel, den 16. Februar 2018 Departement Umweltwissenschaften Bernoullistrasse 32 4056 Basel +41 61 207 36 14 [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung (Management Summary) .................................................................................. 3 2 Forschung ....................................................................................................................................... 3 2.1 Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte ......................................................................................................... 3 2.2 Andere Forschungsprojekte ............................................................................................................................. 11 2.3 Wissens- und Technologietransfer ................................................................................................................... 19 3 Aussenbeziehungen / Kooperationen ........................................................................................... 19 3.1 Nationale Kooperationen ................................................................................................................................. 19 3.2 Internationale Kooperationen .......................................................................................................................... 20 3.3 Gastprofessuren / Fellowships an anderen akademischen Einrichtungen -

SWISS REVIEW the Magazine for the Swiss Abroad June 2016
SWISS REVIEW The magazine for the Swiss Abroad June 2016 100 years of Dada in Zurich: the Cabaret Voltaire mavericks Delayed withdrawal: what future for Swiss nuclear power? Humanitarian tradition under pressure: federal government cuts development aid In view of its centennial, the Organisation of the Swiss Abroad asks about „Switzerland – part of the world” And you, what’s your vision of Switzerland as part of the world in 2016? Join the conversations and explore the centennial festivities on SwissCommunity.org! connects Swiss people across the world > You can also take part in the discussions at SwissCommunity.org > Register now for free and connect with the world SwissCommunity.org is a network set up by the Organisation of the Swiss Abroad (OSA) SwissCommunity-Partner: Contents Editorial 3 Withdrawal in stages 5 Mailbag 6 Focus Withdrawal from nuclear energy – an unresolved issue The situation is delicate. In the wake of Fukushima 10 Politics five years ago, Federal Councillor Doris Leuthard Major cutbacks to development aid announced Switzerland’s withdrawal from nuclear energy, and the whole world reported on this coura 12 Society geous step. Is Switzerland a pioneer in the field of IS fighters from Switzerland alternative energy? The strategy for 2050, which Par liament will decide upon in the summer, certainly 14 Culture aims to achieve this objective. The Dadaists of 1916 However, the situation has changed in the meantime. The Fukushima ef An interview with Adrian Notz fect has long since fizzled out, including in Switzerland. While the halt on constructing new nuclear power stations in Switzerland is effectively final News from around the world ised, existing ones are not being decommissioned provided they are “safe”. -

Kaiseraugst-Arisdorf-Giebenach Möhlin
PASTORALRAUM MÖHLINBACH Kaiseraugst-Arisdorf-Giebenach Möhlin Palmbinden – Herzlichen Dank Am Mittwoch, 10. April, war Palmbin- Was wäre auf dieser Erde alles möglich! Pfarramt den. Unser grosser Vorbereitungsanlass Diese Kräfte und Energien, die da zu- für Palmsonntag. Für mich ein letztes sammenkommen! Ich möchte mich auf Mal in «meiner» Pfarrei. Wenn Jesus der diesem Weg herzlich bei allen bedan- Hirte ist, sind wir dann seine Schafe?», ken, die uns jedes Jahr beim Palmbin- fragte im Schülergottesdienst eines der den mitgeholfen, mitgedacht, mitgetra- Kinder. «Ja, das sind wir dann wohl.» gen haben! Nur zusammen ist dies alles Wir Christen sind eine grosse Schafher- möglich. Ich bin überzeugt, genau das de mit vielen wunderbaren, einzigarti- hat unser Hirt Jesus gemeint, als er sag- gen Schafen. Das ist unsere Pfarrei: eine te: «Dienet einander in Liebe!» fleissige Herde einzigartiger Menschen. Franziska Meichtry Und Jesus ist unser Hirte. Bei den Vorbe- «Da steht jemand hinter mir und zu mir» – Gott und die Paten! Das erleben reitungen des Palmbindens kommt dies die Firmanden an ihrem Patentag auf dem Weg durch verschiedene deutlich zum Ausdruck, denn unsere Lebensräume. Vorbereitungen zu Palmsonntag sind Pfarrei Kaiseraugst bewundernswert. Viele Pfarreimitglie- der bieten mir stets ihre Hilfe an. Für AGENDA mich sind es Momente zum Staunen. Samstag, 4. Mai Donnerstag, 9. Mai 9.00 Firmkurs;Patentag 9.00 Werktagsgottesdienst;UrsZim- AGENDA 15.00 Zwüschezyt:Apérovorbereiten mermann Samstag, 4. Mai 19.00 MaiandachtmitderLitur- 17.30 Gottesdienstmitanschliessen- 17.30 Relitreff:6.Klasse;Kinderfür 18.00 Kommunionfeier giegruppemitdenFrauenverei- demApéro;DanielFischler; Kinder Sonntag, 5. Mai, Taufsonntag nenHertenundDegerfelden DreissigsterfürSusanneMan- 19.00 SitzungKirchenpflege 3. Sonntag der Osterzeit Freitag, 10. -

Polizeireglement
Polizeireglement der Gemeinden im Einzugsgebiet der Regionalpolizei Unteres Fricktal Kaiseraugst Magden Olsberg Möhlin Zeiningen Zuzgen Hellikon Wegenstetten Wallbach Mumpf Obermumpf Stein Schupfart Münchwilen Rheinfelden (Sitzgemeinde) Polizeireglement 2 Die Gemeinderäte Hellikon, Kaiseraugst, Magden, Möhlin, Mumpf, Münchwilen, Obermumpf, Olsberg, Rheinfelden, Schupfart, Stein, Wallbach, Wegenstetten, Zeiningen, Zuzgen, (nachfolgend: Vertragsgemeinden der Regionalpolizei un- teres Fricktal - REPOL) erlassen gestützt auf §§ 37 Abs. 2 lit. f, 38 und 112 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) vom 19. Dezember 1978 folgendes Polizeireglement: ___________________________________________________________________________ I. Allgemeine Bestimmungen § 1 Geltungsbereich 1 Dieses Reglement dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung, Si- cherheit und Sittlichkeit und gilt auf dem ganzen Gebiet der Vertragsgemeinden. 2 Es ergänzt die Polizeigesetzgebung von Bund und Kanton. 3 Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 4 Die Feiertage, der Bussentarif sowie die gemeindespezifischen Regelungen sind im Anhang dieses Reglements aufgeführt. § 2 Polizeiorgane 1 Oberste Polizeibehörde ist der Gemeinderat. Mit der Ausübung des Polizeidienstes ist die REPOL gemäss Gemeindevertrag vom 15. Dezember 2006 betraut. 2 Beamte und Angestellte der Vertragsgemeinden REPOL können im Rahmen der ihnen von Amtes wegen zustehenden oder vom Gemeinderat speziell übertragenen Befugnisse polizeiliche -

Sanierung Und Umgestaltung Der Landstrasse
Das Informationsblatt für unsere Einwohnerinnen und Einwohner. August/September 2016 Sanierung und Umgestaltung der Camino – das «Adler»-Junge Landstrasse – Aufwertung des Ortsbildes Selten hat es im Dorf so laut geklap pert wie in diesem Frühling. Prak tisch jedes bestehende Storchennest und Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde bezogen oder neue Unter künfte gebaut. In diesem Jahr waren es sieben Brutpaare, die ihren Som mer in Kaiseraugst verbrachten, um ihre Jungen aufzuziehen. Siebzehn Junge kamen zur Welt, davon konn ten Ende Juni zwölf Jungstörche be ringt werden. Vor 1991 blieben die Störche der Gemeinde 60 Jahre fern. Dieses Jahr nisteten die Stor chen paare beim Kraftwerk Augst, Fuss- und Radweg Landstrasse Knoten Landstrasse / Mühlegasse mit neuer Oberirdischer Fussgängerübergang im Campingareal, auf der Kirche Lichtsignalanlage mit Mittelinsel sowie mitten im Dorf auf dem Ka min des Gasthofs Adler. Das Die Kantonsstrasse in Kaiseraugst ist in einem schlechten Zustand Umleitung für Fussgänger ist signalisiert Adler Junge, getauft auf den Namen und wird zurzeit saniert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Während der Bauzeit besteht zwischen der Kantonsgrenze und der Ca mino, wurde nebst Beringung Herbst 2017. Im Zuge der Belagssanierung auf dem rund 750m Giebenacherstrasse keine durchgängige Fussgängerführung ent mit einem speziellen Sender ausge langen Abschnitt der Landstrasse von der Kantonsgrenze bis zum lang der Landstrasse. Für die Fussgänger ist eine Umleitung signali rüstet. Dieses kleine Gerät sendet Knoten Giebenacherstrasse werden auch die Kanalisation, die Was siert, insbesondere vom Bahnhof Kaiseraugst zu den Standorten Caminos Flugdaten an S.O.S. Storch. serleitung sowie die Gasleitung erneuert. Die Belagsund Werklei von Augusta Raurica. Der Zugang zu den Liegenschaften ist immer Unter www.projekt-storchenzug.com tungssanierung wird gleichzeitig zum Anlass genommen, das Orts gewährleistet. -
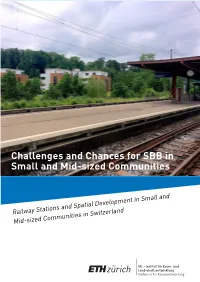
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-Sized Communities
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland IRL – Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung Professur für Raumentwicklung Imprint Editor ETH Zurich Institute for Spatial and Landscape Development Chair of Spatial Development Prof. Dr. Bernd Scholl Stefano-Franscini-Platz 5 8093 Zurich Authors Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier Rolf Sonderegger English editor WordsWork, Beverly Zumbühl Project partners at the SBB Stephan Osterwald Michael Loose SBB Research Advisory Board Prof. Dr. rer.pol. Thomas Bieger, University of St.Gallen Prof. Dr. Michel Bierlaire, EPFL Lausanne Prof. Dr. Dr. Matthias P. Finger, EPFL Lausanne Prof. Dr. Christian Laesser, University of St.Gallen Prof. Dr. Rico Maggi, University of Lugano (USI) Prof. Dr. Ulrich Weidmann, ETH Zurich Andreas Meyer, CEO of Schweizerische Bundesbahnen AG (Swiss Federal Railways, SBB). Project management Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier (Deputy) Print Druckzentrum ETH Hönggerberg, Zurich Photo credit Mahdokht Soltaniehha: Pages 8, 36 and cover photo Rolf Sonderegger: Pages 28 and 56 Data sources Amt für Raumentwicklung (ARE) Bundesamt für Statistik (BFS) Kantonale Geodaten AG, BE, SO, ZH Professur für Raumentwicklung, ETH Zürich - Raum+ Daten Schweizerische Bundesbahnen (SBB) swisstopo © 2015 (JA100120 JD100042) Wüest & Partner (W+P) 1 Final Report: SBB research fund Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland Citation suggestion: Scholl, B., Soltaniehha, M., Niedermaier, M. and Sonderegger, R. (2016). Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities: Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland. -

Sonntag, 18. Juni 2017 10-17 Uhr | 32 Km
Nationale Hauptsponsoren Nationaler Sponsor Regionale Partner #slowUp Nationale Trägerschaft Sonntag, 18. Juni 2017 10-17 Uhr | 32 km Der grenzüberschreitende Erlebnistag zwischen Laufenburg, Bad Säckingen und Stein SlowUp-Anzeige | d | Emma | Format 205 x 278 mm | DU: 12.05.2015 Wir versprechen Emma, bis 2017 als nationale Hauptsponsorin von «slowUp» über 40 Millionen auto- freie Kilometer zu ermöglichen. Tolle Sofortpreise in der Generation M Zone Geniessen Sie die schönsten Strassen der Schweiz einen Tag lang ganz ohne Motorenlärm und entdecken Sie die malerischen Landschaften mit dem Velo, den Inlineskates oder zu Fuss. Direkt an der «slowUp»-Strecke lädt die Genera- tion M Zone zu einer Pause ein, wo Sie bei unserem Nachhaltigkeits-Parcours attraktive Sofortpreise gewinnen können. Mehr Infos zu den Engagements der Migros erhalten Sie unter www.generation-m.ch. 041-60015043_Anz_SlowUp_Emma_205x278_d_TZ.indd 1 12.05.15 13:29 slowUp Zytig 3 IMPRESSUM Herausgeber Inhalt Verein slowUp Hochrhein Armin Eschbach, Präsident D-79725 Laufenburg Grussworte zum 14. slowUp Hochrhein 5 + 7 Redaktion Geri Hirt, Linn 12, 5225 Bözberg-Linn [email protected] Stein – das Zentrum im mittleren Fricktal 4 Inserate slowUp Das slowUp-Festprogramm 9 Helene Häseli, Geschäftsstelle CH-5073 Gipf Oberfrick [email protected] Wie komme ich zum slowUp? 8 Geri Hirt, Linn 12, 5225 Bözberg-Linn [email protected] Streckenplan 11 Layout Fahrpläne – mit dem ÖV an den slowUp 13 Zumsteg Druck AG, 5070 Frick Druck Die nationalen Sponsoren und ihre Angebote 15 Mittelland Zeitungsdruck AG, 5000 Aarau Jurapark – die grüne Schatzkammer 19 Auflage: 105’000 Exemplare Verteilung: Alle Haushaltungen in 125 Jahre Bahnstrecke Koblenz–Stein-Säckingen 22 150 Ortschaften beidseits des Rheins, zwischen Tiengen und Rheinfelden, Einzigartiger Industriezeuge – Bergwerk Herznach 25 im Gebiet Schwarzwald sowie zwi- schen Bözberg und Rhein.