Heft 10 Der Korallenoolith Im Wesergebirge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Bergbau in Der Bundesrepublik Deutschland Bergwirtschaft Und Statistik 2016 – 68
Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland Bergwirtschaft und Statistik 2016 – 68. Jahrgang Inhaltsverzeichnis Abschnitt A – Textbeiträge Verzeichnis der Tabellen aus Abschnitt A ……………………….…………………4 Verzeichnis der Diagramme aus Abschnitt A ……………………………………....5 Teil 1 – Die wirtschaftliche Entwicklung des Bergbaus in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016 A 1.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung ..................................................................... 6 A 1.2 Energieverbrauch ................................................................................................ 8 A 1.3 Die Lage in den einzelnen Bergbauzweigen ..................................................... 11 A 1.4 Die Rohstoffversorgungslage im internationalen Vergleich ............................... 35 Teil 2 – Die Bergbehörden der Bundesrepublik Deutschland A 2.1 Aufbau der Bergbehörden ................................................................................. 43 A 2.2 Zuständigkeiten und Aufgaben .......................................................................... 44 A 2.3 Durchführung der Bergaufsicht .......................................................................... 45 Teil 3 – Ausgewählte Beispiele aus dem Bereich der Bergbehörden A 3.1 Genehmigungsverfahren für den weltweit ersten kommerziellen Helium- Untergrundspeicher in Gronau-Epe …………………………………………….…..47 A 3.2 Optimierung des Hochwasserschutzes am Rhein durch Einbeziehung des Tagebaus „Reckerfeld“ in den Polder Lohrwardt………………………………54 A 3.3 Ökologie – Ein Abschlussbetriebsplan -

Im Weserbergland
2021 UrlaubIM WESERBERGLAND Herausgeber: Weserbergland Tourismus e. V. Postfach 10 03 39 31753 Hameln Fon 05151/9300-0 [email protected] www.weserbergland-tourismus.de ausgezeichnet WWW.WESERBERGLAND-TOURISMUS.DE mit dem Gütesiegel: Das Weserbergland auf einen Blick. LIEBE GÄSTE, Fachwerk und Weserrenaissance, Burgen und Schlösser sowie die eindrucksvolle Natur mit sanften Hügeln und die durch die Region fließende Weser - all das zeichnet das Weserbergland aus. Unsere Urlaubsregion erstreckt sich von Hann. Münden im Süden bis Porta Westfalica im Norden und bietet A2 Porta Westfalica eine Reihe einzigartiger Erlebnisse für Ihre nächste Reise. Wie wäre es Elze beispielsweise mit einer Radreise auf A2 Gronau dem ausgezeichneten Weser-Radweg Eime entlang der Weser? Sie schnüren lieber W e s die Wanderschuhe? Kein Problem! e r Duingen b Lamspringe Dann erwandern Sie doch einen der e Alfeld zertifizierten Qualitätswanderwege wie r zum Beispiel den Weserbergland-Weg g Freden oder den Ith-Hils-Weg. l a Auch Kulturliebhaber kommen bei n uns auf ihre Kosten: Sie können sich d auf die Spuren der historischen Städte und Stätten begeben und in die über 1.000-jährige Geschichte des Weserberglandes eintauchen. Entspannung und Ruhe sowie Wesertal genussvolle Momente sollen bei Ihrem Aufenthalt natürlich nicht zu kurz kommen und können in den Kur- und Heilbädern oder bei kulinarischen Ausflügen genossen werden. Ganz gleich, was Sie bei uns erleben möchten: das Weserbergland ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine erlebnisreiche Zeit! 2 IHRE URLAUBSTHEMEN IHRE FERIENORTE Bad Karlshafen .......................................16 RADFAHREN Bad Pyrmont ............................................17 Weser-Radweg & Co. -

Wanderwege Am Wanderwegeknotenpunkt Porta Westfalica
Wandergebiet Porta Westfalica-Kleinenbremen Die Fernwanderwege am Wanderwegeknotenpunkt Porta Westfalica Rundwanderung Papenbrink E11 Europäischer Fernwanderweg 11 Wanderparkplatz: Besucherbergwerk, Rintelner Straße 396 Niederlande/Nordsee – Wiehengebirge – Wesergebirge – Süntel – Harz – Zeichnung: A1 Mark Brandenburg – Masuren – Moskau Länge: 5,5 km Verlauf: Besucherbergwerk ab i-Punkt ostwärts – X2 Burgensteig – 92 km – Erzsteine/Lore – Everdingsbrink – Holzabfuhrweg – Porta Westfalica – Barntrup – Höxter Hacksgrund – Friedrich-Ebert-Denkmal – Königshütte – Stand Juni 2013 / ikonwerbung.de Stand Aussichtspunkt – bergab zum Besucherbergwerk X3 Cheruskerweg – 65 km – Porta Westfalica – Lemgo – Detmold – Schlangen/Kreuzkrug Südwanderweg Wanderparkplatz: Besucherbergwerk, Rintelner Straße 396 X7 Runenweg – 70 km – Zeichnung: A2 Porta Westfalica – Lemgo – Detmold – Externsteine – Schlangen/Kreuzkrug Länge: 7 km Verlauf: Besucherbergwerk ab i-Punkt ostwärts bis Autobahnbrücke – X11 Bückeberg Weg – 60 km – westwärts Richtung Kleinenbremen – Besucherbergwerk Porta Westfalica – Bückeburg – Krainhagen – Obernkirchen – Reinsdorf – Bad Nenndorf Panoramaweg XW Wesergebirgsweg – 55 km – Porta Westfalica – Hameln Wanderparkplatz: Besucherbergwerk, Rintelner Straße 396 Zeichnung: A3 XW Weserbergland-Weg – 225 km – Länge: 4 km Porta Westfalica – Hameln – Bodenwerder – Stadtoldendorf – Bad Karlshafen – Hann. Münden Verlauf: Besucherbergwerk – Sportplatz – Besucherbergwerk XW Weserweg – 180 km – Porta Westfalica – Minden – Petershagen – Stolzenau – Nienburg -
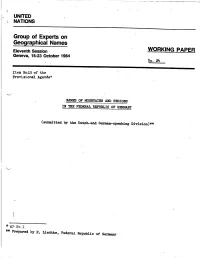
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

Wissenschaftliche Originale in Den Sammlungen BGR/LBEG, Hannover Und BGR, Berlin
Wissenschaftliche Originale in den Sammlungen BGR/LBEG, Hannover und BGR, Berlin Schriftenverzeichnis V. DANIELS, C.H., HEINKE, A., HEUNISCH, C., LINDERT, W. & WIESE, T. Papierversion: 93 Seiten; Archiv-Nr. BGR/LBEG 0117040 Berichtsdatum: 03. 03. 1998 Diese Version wurde aktualisiert am: 06. 01. 2020 durch T. Wiese Wissenschaftliche Originale in den Sammlungen BGR/LBEG, Hannover und BGR, Berlin Schriftenverzeichnis V. DANIELS, C. H., HEINKE, A., HEUNISCH, C., LINDERT, W. & WIESE, T. „Unter Original wird im folgenden jedes Stück verstanden, das in der Literatur abgebildet ist.“ (P. DIENST 1928) Wissenschaftliche Originale gehören zu den wertvollsten Stücken jeder Sammlung. Ein erheblicher Anteil der Nutzeranfragen gilt ihnen. Die Orginale-Sammlungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover und Berlin sowie des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover, sind zwar zum heutigen Zeitpunkt weitestgehend erfaßt - davon auch große Teile DV- mäßig - und damit gut recherchierbar, es fehlte jedoch bisher eine aktuelle Literaturübersicht für die interessierte Fachwelt. Mit dem vorliegenden Schriftenverzeichnis wird diese Lücke geschlossen. Die Originale-Sammlungen in Hannover und Berlin sind nicht nur räumlich getrennt, auch ihr historischer Hintergrund, ihre Quellen und die Art der Katalogisierung sind verschieden. Geschichtliches Im Jahr 1873 wurde in Berlin die Königlich-Preußische Geologische Landesanstalt gegründet, die 1939 in der Reichsstelle für Bodenforschung (ab 1941 Reichsamt für Bodenforschung) aufging. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurden die Bundesaufgaben zunächst dem Amt für Bodenforschung in Hannover übertragen. 1958 wurde die Bundesanstalt für Bodenforschung (ab 1975 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR) aus dem Bestand des Amtes für Bodenforschung errichtet. Die BGR arbeitet auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens eng mit dem Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zusammen. -

The Iron-Ore Resources of Europe
DEPARTMENT OF THE INTERIOR ALBERT B. FALL, Secretary UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY GEORGE OTIS SMITH, Director Bulletin 706 THE IRON-ORE RESOURCES OF EUROPE BY MAX ROESLER WASHINGTON GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1921 CONTENTS. Page. Preface, by J. B. Umpleby................................................. 9 Introduction.............................................................. 11 Object and scope of report............................................. 11 Limitations of the work............................................... 11 Definitions.........................:................................. 12 Geology of iron-ore deposits............................................ 13 The utilization of iron ores............................................ 15 Acknowledgments...................................................... 16 Summary................................................................ 17 Geographic distribution of iron-ore deposits within the countries of new E urope............................................................. 17 Geologic distribution................................................... 22 Production and consumption.......................................... 25 Comparison of continents.............................................. 29 Spain..................................................................... 31 Distribution, character, and extent of the deposits....................... 31 Cantabrian Cordillera............................................. 31 The Pyrenees.................................................... -

WERNER- WESLEY the Development of the School, Whi Ch Rose to Be One of the Cen Czech., on April 15, 1880
4.12 WERNER- WESLEY the development of the school, whi ch rose to be one of the cen Czech., on April 15, 1880. H e studied phi losophy and psychology tres of scientific learning in Europe. He died at Freiberg on at Prague and Berlin and received his Ph.D. smnma cum, la 1tde June 30, 1817. from Wifrzburg in 1904. He taught at Frankfurt and then at Ber One of the di stinguishing features of Werner's teaching was lin , returning to Frank furt in 1929 to accept the chair in psychol the care with ·which he taught lithology and the succession of ogy. In 1933 he moved to the Uni ted States, joining the New geological formations ; a subject to which he applied the name Scho ol fo r Social Research in New York City, where he held a geognosy. His views on a definite geological succession were in professorship until hi s death on Oct. 12, 1943 . spired by the wo rks of J. G. Lehmann and G. C. Fuchsel ( 17 22- Wertheimer's profound influence on psychology came mainly 73) . He showed that the rocks of the earth foll ow each other in through hi s many devoted students. His writings ranged widely, a certain definite order. He had never traveled, and the sequence including such field s as the psychology of perception and of think of rock-masses which he had recognized in Saxony was believed ing, crime detection , musicology, and philosophical problems of by him to be of universal appli cation. He taught that the rocks logic, ethics, and truth. -

Erzlagerstätten
ERZLAGERSTÄTTEN Kurzvorlesungen zur Einlührung und zur Wiederholung Von Dr. Hans Schneiderhöhn Ordentlicher Professor der Mineralogie, Gesteinskunde und Lagerstättenkunde an der Universität Freiburg i. Br. JENA VERLAG VON GUSTAV FISCHER ERZLAGERSTÄTTEN Kurzvorlesungen zur Einführung und zur Wiederholung Von Dr. Hans Schneiderhöhn Ordontlicher Professor der Mineralogie, Gesteinskunde und Laaerstättenkunde an der Univorsitiit Freiburg i. JJr. JENA VERLAG VON GUSTAV FISCHER 1944 Printed in Germany Alle Rechte Vorbehalten Vorwort. In Besprechungen des „Lehrbuchs der Erzlagerstättenkunde“ 1941, Band I und in Zuschriften von Kollegen wurde ich wieder holt aufgefordert, einen kurzen Leitfaden über Erzlagerstätten zu schreiben. Auch beim eigenen Unterricht und besonders bei der Fernbetreuung der in der Wehrmacht eingezogenen Studenten machte sich immer mehr dieser Wunsch bemerkbar. Ich lege nun diesen kurzen Leitfaden vor, der etwa Umfang und Form hat, wie es sich zuletzt in einer zweisemestrigen Kurzvorlesung heraus gebildet hatte. Leider gestattete die heute gebotene Knappheit im Umfang die Einschaltung von Abbildungen nicht. Sie hätten in so reichlicher Menge beigegeben werden müssen, daß das Buch dreimal umfangreicher geworden wäre. Es ist beabsichtigt, später einmal einen Atlas zu den Erzlagerstätten gesondert herauszugeben, der zur Illustrierung dieser „Kurzvorlesung“ dienen soll. Aus dem selben Grunde wurde auch auf zusammenhängende Ausführungen über Lagerstättenprovinzen, Metallepochen und ihre Beziehungen zur Geotektonik und zum Geomagmatismus verzichtet, die nur mit vielen Karten verständlich werden. Auch die geochemische Verteilung der Elemente konnte deshalb nicht berücksichtigt werden. Über die allgemeinen Gesichtspunkte, die mich auch in diesem Buch leiteten, habe ich mich ausführlich im Vorwort zum „Lehr buch der Erzlagerstättenkunde“ geäußert. Auch dieses kleine Werk ist nicht als Literaturzusammenstellung zu werten, sondern ent hält wieder zahlreiche, z. -

Raubsaurier Und Krokodile Im Wiehengebirge
suchungen in rein jurassischen Sedimentge- Samenvatting steinen durchgeführt worden. Die aktuelle In de zomer van 2013 werd door een verzame- Grube schließt im Südwesten auch den Über- laar in een leemgroeve in Warburg-Bonen- gang vom ältesten Jura in das Liegende auf, burg het skelet van een zwemsauriër gevon- also die oberste Trias mit dem sogenannten den. Het fossiel uit de tijd van het boventrias Rhät. Die Trias-Jura-Grenze liegt bei ca. 200 werd compleet in één blok gesteente geborgen Mio. Jahren vor heute. Der geologische Bau en naar het LWL-Museum für Naturkunde des östlichen Egge-Vorlandes ist sehr stark Münster getransporteerd. Na het uitprepare- durch Störungstektonik geprägt, was sich im ren werd de zwemsauriër, die vooral vanwege Kleinen auch in der Tongrube bemerkbar zijn hoge ouderdom interessant is, wetenschap- macht. Jedoch scheint im Südwesten der kon- pelijk onderzocht door experts van de Üniver- kordante Übergang Rhät-Lias sicher zu sein. sität Bonn. Die Fundstelle liegt also, stratigrasch gese- AUSGRABUNGEN UND FUNDE UND FUNDE AUSGRABUNGEN hen, unter dieser Grenze. Literatur Da vollständig erhaltene Schwimmsauri- Hans Stille/Adolf Mestwerdt, Erläuterungen zu Blatt Pe- er-Skelette bisher in Schichten des Unter-Jura ckelsheim Nr. 2515. Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern (Berlin 1935). – Britta (Lias) gefunden worden sind (Süddeutschland, Niermeyer, Litho- und Biostratigraphie der Tongrube England), könnte dem Fund von Bonenburg Bonenburg. Geologie und Paläontologie in Westfalen 45 eine besondere Bedeutung beikommen. Man (Münster 1996). – Leonie Schwermann/Martin Sander, darf interessante Ergebnisse der wissenschaft- Osteologie und Phylogenie von Westfaliasaurus simon- lichen Untersuchungen erwarten. sensii: Ein neuer Plesiosauride (Sauropterygia) aus dem Unteren Jura (Pliensbachium) von Sommersell (Kreis Höx- ter), Nordrhein-Westfalen, Deutschland. -

The North of England Institute of Mining and Mechanical Engineers
THE NORTH OF ENGLAND INSTITUTE OF MINING AND MECHANICAL ENGINEERS. TRANSACTIONS. VOL. LIII. 1902-1903. Edited by M. WALTON BROWN, Secretary. NEWCASTLE-UPON-TYNE: PUBLISHED BY THE INSTITUTE. Printed by Andrew Reid & Co., Limited, Newcastle-upon-Tyne. 1905. [All rights of publication or translation are reserved.] [ii] ADVERTIZEMENT. The Institute is not, as a body, responsible for the statements and opinions advanced in the papers which may be read, nor in the discussions which may take place at the meetings of the Institute. [iii] CONTENTS OF VOL. LIII. Page Advertizement ii Contents iii GENERAL MEETINGS. 1902. Page Sept. 17.—Thirteenth Annual General Meeting of The Institution of Mining 1 Engineers (Newcastle-upon-Tyne) Election of Officers, 1902-1903 1 Thirteenth Annual Report of the Council 2 Accounts 9 Books, etc., added to the Library 16 Exchanges 17 "The Marl-slate and Yellow Sands of Northumberland and Durham." By 18 Prof. G. A. Lebour Discussion 37 "The Alston Mines." By the Rev. W. Nall 40 Discussion 52 "Notes on the Gold Coast of West Africa." By Louis P. Bowler 61 Discussion 62 Discussion on Mr. A. R. Sawyer's paper on "The Tarkwa Gold-field, West 64 Africa" Discussion of Mr. F. W. Payne's paper on "Gold-dredging in Otago, New 65 Zealand" Discussion of Mr. Fred C. Keighley's paper on "Coke-making at the Oliver Coke- 66 works" "Undersea Coal of the Northumberland Coast." By T. E. Forster 69 Discussion 77 "Steam-generation by the Gases from Beehive Coke-ovens.” By M. R. Kirby 89 "Corliss-engined Fan at Seghill Colliery." By C. -

Hochwasserschutzplan Weser
Hochwasserschutzplan Weser 07.06.2006 Expertengruppe „Hochwasserschutz Weser“ der FGG Weser: Dipl.-Ing. Birgit Heddinga Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Dipl.-Ing. Simon Christian Henneberg Flussgebietsgemeinschaft Weser (Obmann) Dipl.-Ing. Albert Kreil Regierungspräsidium Kassel Dipl.-Ing. Axel Mohr Senator für Bau, Umwelt und Verkehr der Hansestadt Bremen Dipl.Ing. Thomas Rieck Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Ostwestfalen-Lippe Dipl.-Hydr. Helmut Teltscher Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Dipl.-Ing. Tilmann Treber Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsdirektion -Mitte- Bearbeitung: Geschäftsstelle Weser An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Telefon: 05121 509712 Telefax: 05121 509711 E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung 1 2 Auswahl der Gewässer 1 3 Grundlagen 2 3.1 Einzugsgebiet, naturräumliche Gegebenheiten 2 3.2 Natürlicher Wasserrückhalt 4 3.3 Handlungsziele und Strategie 4 3.4 Rechtsgrundlagen 5 4 Bestandsaufnahme 5 4.1 Vorsorgemaßnahmen 5 4.2 Überschwemmungsgebiete 5 4.3 Technischer Hochwasserschutz 7 4.4 Schutzgrad und Gefährdungspotential 9 4.5 Hochwassermelde- und -vorhersagedienst 9 5 Handlungsfelder und Maßnahmen 11 6 Schlussbemerkungen 13 Anlage 1 14 Hochwasserschutzplan Weser 1 1 Veranlassung In den vergangenen 10 Jahren gab es weit mehr als 100 Hochwasserereignisse in Europa, von be- sonderer Betroffenheit das Hochwasser 1997 im Odergebiet, an der Elbe und der Donau in den Jahren 2002 und 2006 oder im Alpenraum im Sommer 2005. Hierbei kam es auch zu Todesfällen. Über eine halbe Millionen Menschen verloren ihr Zuhause und die Schadenssumme alleinig der versicherten Schäden überschritt die Schwelle von 25 Mrd. €. An der Weser traten in diesem Zeitraum flussgebietsbezogen zwar nur kleinere Hochwasser mit geringfügigeren Schäden auf. -

13 LSG Verordnung Wesergebirge
Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles „Wesergebirge“ in der Stadt Rinteln, Gemeinde Auetal und Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg Präambel Aufgrund der §§ 26 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 155; berichtigt Nds. GVBl. S. 267), zuletzt geändert durch Arti- kel 4 des Gesetzes vom 26. April 2007 (Nds. GVBl. S. 161) in Verbindung mit § 36 (1) der Nds. Landkreisordnung in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 510 ) hat der Kreistag des Landkreises Schaumburg in seiner Sitzung am 08.07.2008 folgende Verordnung beschlos- sen: § 1 Landschaftsschutzgebiet (1) Der innerhalb der in Absatz 2 festgelegten Umgrenzung liegende Landschaftsteil in den Gemeinden Auetal, Buchholz und Luhden und der Stadt Rinteln wird mit dem Inkrafttre- ten dieser Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. (2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 3312 ha. Die Grenze des Schutz- gebietes ist in einer Karte im Maßstab 1 : 10.000 dargestellt. Ausfertigungen dieser Karte werden beim Landkreis Schaumburg, untere Naturschutzbehörde, und bei den Gemein- den, deren Gebiet betroffen ist, aufbewahrt und können dort von jedermann kostenlos eingesehen werden. Die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist der beiliegenden Über- sichtskarte im Maßstab 1 : 50.000 zu entnehmen. § 2 Charakter und Schutzzweck (1) Das Landschaftsschutzgebiet „Wesergebirge im Bereich des Landkreises Schaumburg“ umfasst die im Landkreis Schaumburg gelegenen Teile der Wesergebirgskette sowie die südlich und nördlich angrenzenden Hangbereiche. Es ist der naturräumlichen Region des Weser- und Leineberglandes zugeordnet und hat dort Anteile an der naturräumlichen Einheit Kalenberger Bergland, Untereinheiten Wesergebirge und Langenfelder Hochflä- chen sowie an der naturräumlichen Einheit Rinteln-Hamelner Weserland, Untereinheit Steinberger Lößhang.