Forschergruppe CSG-II W O R K S H P Freitag, 18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tātou O Tagata Folau. Pacific Development Through Learning Traditional Voyaging on the Waka Hourua, Haunui
Tātou o tagata folau. Pacific development through learning traditional voyaging on the waka hourua, Haunui. Raewynne Nātia Tucker 2020 School of Social Sciences and Public Policy, Faculty of Culture and Society A thesis submitted to Auckland University of Technology in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy Table of Contents Table of Contents .......................................................................................................... i Abstract ........................................................................................................................ v List of Figures .............................................................................................................. vi List of Tables ............................................................................................................... vii List of Appendices ...................................................................................................... viii List of Abbreviations .................................................................................................... ix Glossary ....................................................................................................................... x Attestation of Authorship ............................................................................................. xiii Acknowledgements ..................................................................................................... xiv Chapter 1: Introduction ................................................................................................ -

Riesenberg 1972 the Organisation of Navigational Knowledge on Puluwat
THE ORGANISATION OF NAVIGATIONAL KNOWLEDGE ON PULUWAT Author(s): Saul H. Riesenberg Source: The Journal of the Polynesian Society, Vol. 81, No. 1 (MARCH 1972), pp. 19-56 Published by: The Polynesian Society Stable URL: https://www.jstor.org/stable/20704826 Accessed: 08-10-2018 13:49 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms The Polynesian Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of the Polynesian Society This content downloaded from 74.93.217.178 on Mon, 08 Oct 2018 13:49:56 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms THE ORGANISATION OF NAVIGATIONAL KNOWLEDGE ON PULUWAT Saul H. Riesenberg Smithsonian Institution This article describes some of the mnemonic devices and systems of classification employed by the navigators of the atoll of Puluwat (Central Caroline Islands) to arrange their knowledge of geography and of star courses into organised bodies of data. The word geography is used here in a very broad sense, to include both natural and mythical phenomena, and animate beings as well, when they are part of those bodies of data and are used as reference points by navigators in finding their way on the high seas. -

Carolinian Voyaging in the New Millennium
MICRONESIAN JOURNAL OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Vol. 5, nº 1/2 Combined Issue November 2006 CAROLINIAN VOYAGING IN THE NEW MILLENNIUM Eric Metzgar Triton Films, Camarillo, CA A holistic view of the Carolinian voyaging movement to date, highlighting major voyaging achievements as well as the master navigators (palu) who have made significant contributions. The reinvigorization of long-distance voyaging has expanded beyond the Carolininan-Marianas voyaging renaissance into a pan-Carolinian movement with navigators using traditionally-made canoes to make two-way voyages from Yap to Palau in the west and from Polowat to Pohnpei in the east. Using ancient knowledge of non-instrument tion traditions. Many of these navigators have wayfinding that had been handed down for been recognized previously in published arti- generations, master navigators (palu) from cles but some have not, either because they Polowat and Satawal in the later part of the last were formerly apprentices who only recently century rediscovered the 500-mile1 sea route came of age as palu master navigators or the from their islands in the central Carolines2 to nature of their contribution has been that of Saipan and Guam in the Marianas archipelago. teacher more than voyager. In addition, there In so doing they sparked a renaissance of Caro- are many others in “the background” who have linian-Marianas voyaging that continues today. participated in significant ways to the re- First to rediscover the passage from the Caro- invigorization of the Carolinian voyaging line Islands to the Mariana Islands were Hipour movement — both men and women — whose (from Polowat) in 1969, Repunglap and Re- storied achievements and contributions have punglug (from Satawal) in 1970, and Ikuliman yet to come to light. -

East-West Center Magazine, Spring/Summer 1976
EAST-WEST CENTER MAGAZINE SPRING-SUMMER 1976 X EAST-WEST CENTER MAGAZINE SPRING-SUMMER 1976 Page 6 CONTENTS Bicentennial Voyage of Rediscovery 1 The East-West Center Contribution 3 Steering by the Stars 6 "Star of Gladness" 8 Teaching Materials for Culture Training 10 An Exercise in Culture-Relative Intelligence 11 One Son and An Irish Setter 13 Transformation in the People's Republic of China 16 English in Three Acts 18 Inouye and the Jefferson Fellows 20 The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans 21 Published quarterly by Office of Publications and Public Affairs East-West Center 1777 East-West Road Honolulu, Hawaii 96822 Robert B. Hewett, Director Mark E. Zeug, Editor Arnold Kishi, Photojournalist Bob Wernet, Feature Writer Mary Connors, Designer About the Cover: Hawaiian artist Herb Kawainui Kane's vision caught the Hokule'a on the crest of a wave shortly before sunset. The painting was used on a poster of the Polynesian Voyaging Society to bring attention to the voyage. See story on facing page. Launched with careful attention to religious tradition, this re-creation of an ancient Polyne• sian voyaging canoe plies the waters of the South Pacific in an effort to duplicate the supposed route of Hawaii's discoverers more than HUU years ago. Bicentennial Voyage of Rediscovery By Mark Zeug It is more than an adventure, more than an exper• capture the navigational skills and spirit of old iment in seamanship. It is a planned voyage into Hawaii in a dramatic experiment in cultural re• the past in perhaps the most ambitious single trieval. -

We, the Navigators: the Ancient Art of Landfinding in the Pacific PDF Book
WE, THE NAVIGATORS: THE ANCIENT ART OF LANDFINDING IN THE PACIFIC PDF, EPUB, EBOOK David Lewis,Derek Oulton | 200 pages | 31 Oct 1994 | University of Hawai'i Press | 9780824815820 | English | Honolulu, HI, United States We, the Navigators: The Ancient Art of Landfinding in the Pacific PDF Book The book is organized by navigational technique and generally follows Lewis's own voyages with Micronesian navigators in the Caroline Islands. Compared to Heyerdahl's narratives of his voyages, We the Navigators is more satisfying from the standpoint of understanding the navigational aspects. Feb 16, Carl Sholin rated it it was amazing Shelves: ethnography. Second, when we were cruising the South Pacfic in we were privileged to meet one of the main characters featured in the book, Hippour, one of the last surviving natural navigators on his home island of Puluwat Atoll, near Truk in Micronesia. Community Reviews. Succeeds admirably. Although there are usually swift currents around islands, the major currents take over more than 5—6 miles from land. Product details Format Paperback pages Dimensions Any information you do submit will be stored securely and will never be passed on or sold to any third party. Navigation in context: grand theories and basic mechanisms. We use cookies to improve this site Cookies are used to provide, analyse and improve our services; provide chat tools; and show you relevant content on advertising. More Filters. Their boats were faster and better than anything the "civilized" world had. Return to Book Page. The preferred size for long distances throughout Oceania was 50—75 feet, which were least likely to succumb in storms and could carry up to 50 people. -

L'art D'être Pirogues De Voyage En Océanie Insulaire
L’art d’être pirogues de voyage en Océanie insulaire par Anne DI PIAZZA * et Erik PEARTHREE ** Les pirogues ou Après citation de la description que donne « la partie la plus curieuse de ces îles » Cook des grandes pirogues, il poursuit son cons- tat. « Les pirogues étonnèrent les premiers marins qui les virent, par leurs échafaudages extérieurs « On vient de voir ce qu’étaient, en 1780, la et leurs longues charpentes, dont l’usage n’est petite marine de Taïti et sa population indus- possible qu’avec des bateaux aussi légers, qui trieuse, et cela, comparéàce qui existe mainte- peuvent, comme un morceau de liège, suivre les nant, donne la mesure du mal de ce que moindres impulsions des vagues ; elles ne peu- les Européens ont causéàce pays : nous avons vent non plus servir que dans les mers paisibles, fait le tour de toute l’île en naviguant presque où règnent les vents réguliers qui, bien qu’assez toujours en dedans des récifs, souvent à quelques forts, ne soulèvent jamais les lames gigantesques mètres de terre, sans trouver un seul hangar ; la des hautes latitudes : ce n’est donc que grâce à la plupart des villages où nous descendîmes ne pos- beauté du climat qu’il est possible aux naturels sédaient qu’une ou deux pirogues » (Pâris, 1843 : de franchir les distances qui séparent leurs archi- 123). pels, et il ne leur en faut pas moins beaucoup de Il faut attendre la fin des années 1960 pour que courage pour perdre la terre de vue et aller sans s’opère la renaissance de la navigation tradition- boussole à la recherche de petites îles basses dont nelle polynésienne. -
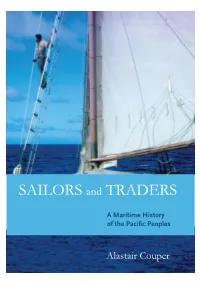
SAILORS and TRADERS
SAILORS and TRADERS ".BSJUJNF)JTUPSZ PGUIF1BDJ¹D1FPQMFT Alastair Couper Sailors and Traders 1Coup_i-xiv.indd i 10/28/08 7:58:59 AM Sailors and A Maritime History of 1Coup_i-xiv.indd ii 10/28/08 7:59:00 AM Traders the Pacific Peoples Alastair Couper University of Hawai‘i Press honolulu 1Coup_i-xiv.indd iii 10/28/08 7:59:00 AM © 2009 University of Hawai‘i Press Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Couper, A. D. Sailors and traders: a maritime history of the Pacific peoples / by Alastair Couper. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8248-3239-1 (hardcover : alk. paper) 1. Pacific Islanders—History. 2. Sea Peoples—Pacific Area—History. 3. Sailors—Pacific Area—History. 4. Shipping—Pacific Area—History. I. Title. GN662.C68 2009 995—dc22 2008038710 An electronic version of this book is freely available thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high-quality books open access for the public good. The open-access ISBN for this book is 9780824887650 (PDF). More information about the initiative and links to the open-access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. The open access version of this book is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), which means that the work may be freely downloaded and shared for non-commercial purposes, provided credit is given to the author. Derivative works and commercial uses require permission from the publisher. For details, see https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. -
Hull Speed 2017.Pdf
HULL SPEED AN INSIGHT INTO THE PRINCIPAL BARRIER TO HIGH SPEED UNDER SAIL ALAN SKINNER HULL SPEED AN INSIGHT INTO THE PRINCIPAL BARRIER TO HIGH SPEED UNDER SAIL ALAN SKINNER PREFACE Sailboat design is an art and, as for all art, success demands not only the development of natural talent but also an intimate knowledge of the subject. For sailboat design, the accumulation of that knowledge has been a lengthy, evolutionary process, beginning in prehistory and achieving a significant level of advancement by the time of man's earliest records. The proas and double canoes of Oceania, the junks of Asia and the Viking ships of Europe typify the extraordinary refinement and diversification of evolutionary design evident throughout the history of the maritime world. Although aided by increasingly sophisticated technology, modern sailboat design is essentially an extension of that evolutionary process. Today, the theory of all boat design is regarded as an engineering science, whereby the behaviour of a vessel is explained by the application of mathematics. However, some factors that determine the performance of a boat, especially under sail, are still seemingly impossible to resolve other than by empirical methods. Consequently, the theory of certain aspects of sailboat design remains limited to broad principles, the interpretations of which are dependent on the adeptness of the designer. Shaping a hull to reduce resistance is the most fundamental, most studied but generally the least understood feature of design for all types of vessels. Surface waves caused by the forward motion of a hull represent a major component of a vessel‘s total resistance. -

The Etymology of the Star Altair in the Carolinian Sidereal Compass
Squib East is Not a ‘Big Bird’: The Etymology of the Star Altair in the Carolinian Sidereal Compass Gary Holton,* Calistus Hachibmai,† Ali Haleyalur,‡ Jerry Lipka,* and Donald Rubinstein§ *UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS, †YAP STATE DEPT. OF EDUCATION,͒ ‡YAP TRADITIONAL NAVIGATION SOCIETY, AND §UNIVERSITY OF GUAM We argue that the Micronesian constellation centered on Altair, known in Lamotrek as Mailap, has been mistakenly identified in previous literature with another constellation centered on Sirius, known as Mannap. The latter is literally the ‘Big Bird’ and is well known in parts of Polynesia as well. Con- fusing this Big Bird with Altair has led to much confusion in the literature on Carolinian navigational arts. We trace the history of how this error arose and why it has persisted over time, and we also suggest an alternate etymology for Mailap. The title of Thomas Gladwin’s (1970) well-known book on Carolinian navigational arts, East is a Big Bird, asserts an etymology for the star known in English as Altair. Here we reexamine that proposed etymology in order to explain how the appellation Big Bird came to be associated with East throughout much of the literature on Pacific voyaging and navi- gation. Unraveling this mistake requires a careful recounting of the history of the study of Micronesian navigation as well as the historical linguistics of the Chuukic languages. Gladwin writes that “on Puluwat the cardinal direction is east, under the rising of Altair, the ‘Big Bird’” (1970:148). This gloss is found also in David Lewis’s book We, the navigators, which recounts the author’s voyaging with Puluwat navigator Hipour (D. -

Book Reviews - H.J.M
Book Reviews - H.J.M. Claessen, David Lewis, From Maui to Cook: The discovery and settlement of the Pacific, Drawings by Walter Stackpool. Sydney: Doubleday, 1977. Bibliography. - P. van Emst, Carl Lumholtz, Among Cannibals. An account of four years travel in Australia and of camp life with the aborigines of Queensland. Firle: Caliban Books. 383 pp. Maps, illustrations and index. Reprinted from the first edition, London: John Murray. - D.C. Geirnaert-Martin, Robert Wessing, Cosmology and social behaviour in a West Javanese settlement, Papers in International Studies, Southeast Asia Series no. 47, Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, 1978, Athens, Ohio. - B.G. Grijpstra, William Wood, Cultural-ecological perspectives in Southeast Asia, edited and with an introduction by William Wood, Papers in International Studies, Southeast Asia Studies no. 41, Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, 1977, Athens, Ohio. - R. Hagesteijn, M. Jacq-Hergoualch, Larmement et lorganisation de larmée khmère aux XIIe et XIIIe siècles; daprès les bas-reliefs dAngkor Vat, du Bayon et de Bantay Chmar. Paris: Presses Universitaires de France. - C.K. Jonker-de Putter, John Ingleson, Road to exile; The Indonesian nationalist movement, 1927-1934. ASAA Southeast Asia Publications Series, No. 1. Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., Singapore, 1979. xii + 254 blz. Bibliographie, index. - P.E. de Josselin de Jong, Roland Werner, Jah-het of Malaysia: art and culture, 1975. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. xxxv, 626 pp., 39 figs., 2 maps, 746 plates. - P.E. de Josselin de Jong, Roland Werner, Mah-Meri of Malaysia: Art and culture, 1974. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. -

Traditional-Navigati
Traditional Navigation, Seafaring and Fishing Teachers Resource Guide A. Lesson Plan Traditional navigation by Pacific islanders involves no compasses or charts. Instead, navigators rely on the stars; on their reading of winds, waves and clouds; on their knowledge of sailing directions and seamarks; and on their ability to determine currents and predict weather. Utilizing these methods, ancient Polynesians and Micronesians traveled from Samoa to Hawaii and from Satawal to Saipan. Today the traditional arts of navigation, seafaring and fishing are being revived, and traditional Pacific sailing canoes are circumnavigating the globe. 1. Encourage students to hypothesize about the following regarding traditional navigation, seafaring and fishing: a. How does one become a traditional navigator? b. How does one prepare for a voyage? c. What is the experience of open ocean navigation like? d. Is fishing important to the voyage? If so, why? e. Is learning this practice important today and why? 2. Then have the students to watch the videotaped interviews of traditional navigators and seafarers available on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=Dkct6nGMuOE, on Vimeo at https://vimeo.com/143950507 or on the Council’s website at http://www.wpcouncil.org/education-and-outreach/educational-videos-4/. They can also watch the complete interviews of each navigator. Wally Thomson at https://www.youtube.com/watch?v=jr2zOUio2Z8 Cecilio Raiukiulipiy at https://youtu.be/u6-8DadLSYg Manny Sikau at https://youtu.be/KMh2at7oQyU Chadd Paishon at https://youtu.be/D8LAu6wADXQ 3. Afterwards, have the students put pen, pencil, paint, crayon or other appropriate medium to paper as they prepare their entry for the “Traditional Navigation, Seafaring and Fishing” poster competition. -

A Preliminary List of Animal Names in the Chuuk District, Micronesia with Some Notes on Plant Names
Micronesica 31(1):1-245, 1999 A Preliminary List of Animal Names in the Chuuk District, Micronesia with some notes on plant names Alan E. Davis1 1 Current Address: AAA196, Box 10001, Saipan, MP 96950, CNMI This list is dedicated to my children, Forrest LeRoy Eugene Davis, Timothy Davis, and Thomas Gotthelf Fischer Davis, Tian Taky Davis, and Dianne Eclipse Davis and to all other little boys and girls in Chuuk whose mothers and fathers do not understand one another very well. Revised from a technical report printed by the College of Mi- cronesia and the Micronesian Language Institute (UOG). °c 1996, 1999 Alan Eugene Davis °c 1996, 1999 College of Micronesia, Chuuk °c 1996, 1999 Micronesian Language Institute, University of Guam This document may be freely copied, on the condition that a copy of this notice is provided or else, for excerpts, that full acknowledgement is given of this source. Abstract—This is an unfinished list of animal names, including many unverified names, from dialects / languages commonly heard in Chuuk Lagoon, the Mortlock Islands, Hall Islands, Western Islands (Pattiw) and Nominweit´e,constituting the Eastern end of a chain of related dialects and cultures extending from Sonsorol and Tobi to Chuuk Lagoon. This list may emphasize a relatively small number of dialects; names are listed, however, from throughout the district. Animal names are ordered phylogenetically, divided into chapters according to broad classification. Chapters on sponges, coelenterates, worms, molluscs, crus- taceans, and insects and allies are divided into sections by category. Fishes are the subject of one large chapter, divided into sections by family.