Wege Und Ziele Weitwandern in Europa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
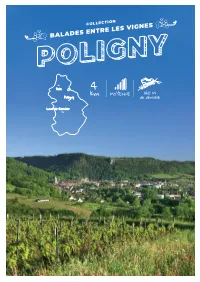
Balades Entre Les Vignes
COLLECTION BALADES ENTRE LES VIGNES Dole 4 MOYENNE 140 M Poligny km de dénivelé Lons-le-Saunier POUR ALLER DE POLIGNY, ON RETIENT SOUVENT QU’ELLE EST LA CAPITALE MONDIALE LE PLUS LOIN… DU COMTÉ. MAIS CETTE CITÉ DE CARACTÈRE EST AUSSI L’HÉRITIÈRE UNE ŒUVRE D’UNE RICHE HISTOIRE ET D’UNE TRADITION VITICOLE AFFIRMÉE. PARCOURS 1 DE DÉCOUVERTE À L’EMBOUCHURE DE LA “RECULÉE” DE POLIGNY, CETTE BALADE VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE DE VESTIGES ET DE VIGNES SECRÈTES • Départ sur le parking jouxtant l’ONF, OÙ DE SUBLIMES PANORAMAS S’OFFRIRONT À VOUS. CÔTÉ VILLE, en haut de la rue de la Doye. VOUS AUREZ L’OCCASION DE DÉCOUVRIR L’HABITAT TRADITIONNEL Pour cette promenade le balisage est jaune puis blanc et rouge (GR 59) puis à La statue du Vigneron est une belle VIGNERON (QUARTIER DE CHARCIGNY). sculpture de bronze dédiée à Wladimir nouveau jaune. Gagneur, célèbre militant et député • En partant de l’ONF, descendez la fouriériste qui se situe Square de Charcigny. Elle valorise les valeurs progressistes du XIXe rue de la Doye puis la rue de Faîte en siècle : l’épanouissement par l’étude (le livre) direction du village, jusqu’au poteau et le travail (le bigot). Un chef d’œuvre signé Marguerite Syamour inauguré en 1889. “Charcigny”. Laissez sur la gauche, la tour de la Sergenterie, les vestiges du château de Grimont au pied duquel coule le UN BELVÉDÈRE Sergenterin. Vous êtes dans le typique 2 quartier vigneron de Charcigny dont les GORGES DE GREUBEY caves affleurent par des trappes sur la rue ; • Au poteau “Charcigny”, prenez la direc- tion “Gorges de Greubey”. -
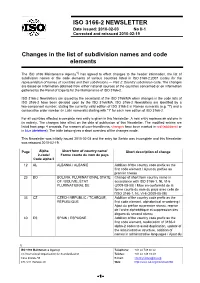
ISO 3166-2 NEWSLETTER Changes in the List of Subdivision Names And
ISO 3166-2 NEWSLETTER Date issued: 2010-02-03 No II-1 Corrected and reissued 2010-02-19 Changes in the list of subdivision names and code elements The ISO 3166 Maintenance Agency1) has agreed to effect changes to the header information, the list of subdivision names or the code elements of various countries listed in ISO 3166-2:2007 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code. The changes are based on information obtained from either national sources of the countries concerned or on information gathered by the Panel of Experts for the Maintenance of ISO 3166-2. ISO 3166-2 Newsletters are issued by the secretariat of the ISO 3166/MA when changes in the code lists of ISO 3166-2 have been decided upon by the ISO 3166/MA. ISO 3166-2 Newsletters are identified by a two-component number, stating the currently valid edition of ISO 3166-2 in Roman numerals (e.g. "I") and a consecutive order number (in Latin numerals) starting with "1" for each new edition of ISO 3166-2. For all countries affected a complete new entry is given in this Newsletter. A new entry replaces an old one in its entirety. The changes take effect on the date of publication of this Newsletter. The modified entries are listed from page 4 onwards. For reasons of user-friendliness, changes have been marked in red (additions) or in blue (deletions). The table below gives a short overview of the changes made. This Newsletter was initially issued 2010-02-03 and the entry for Serbia was incomplete and this Newsletter was reissued 2010-02-19. -

BAUMES, CIRQUES ET RECULEES EN ARBOIS (Jura)
Club Alpin Français d’Ile de France Michel LOHIER (tel : 02 32 51 90 15 ou à défaut 06 12 62 14 53) BAUMES, CIRQUES ET RECULEES EN ARBOIS (Jura) code 08-RW 23 niveau : M 22 au 24 mars 2008 édition du 2 janvier 2008 Cette randonnée au pied du Jura pourrait s’intituler : du sel, du vin et de l’eau . En effet à Salins, les salaisons de Séquanie étaient déjà très réputées du temps des Romains. Le sel valait plus que l’or au 17 e siècle et était conservé dans des lieux puissamment gardés comme à Arc et Senans à une trentaine de kilomètres de Salins. La première AOC de France est constituée de 5 cépages : Savagnin, Chardonnay, Pinot noir, Trousseau et Poulsard, donnant ce goût si particulier au vin d’Arbois. C’est dans la région que Louis Pasteur mena ses recherches sur la fermentation. Enfin l’eau qui a dessiné à travers des bancs calcaires ou marneux ces vallées aux parois abruptes formant baumes, cirques et reculées. Sans plus attendre voici le programme : Vendredi 21 mars : Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ? Rendez - vous dans le hall de la gare de Mouchard à 22h à l’arrivée du train. Transfert routier pour Salins les Bains . Hébergement en hôtel. Samedi 22 mars : Visite des Salines puis à pied au départ de Salins, Fort Saint André (construit par Vauban), Croix de Prétin, premiers vignobles à Montigny les Arsures, Arbois, visite de cave. Hébergement en ½ pension en hôtel pour 2 nuits. 4h30 Montée : 300 m Descente : 354 m Dimanche 23 mars : Circuit du Cirque du Fer à Cheval : Arbois, Mesnay, la Roche du Feu, les Planches près Arbois, cascade des Tufs et source de la Cuisance, le chemin des Diligences, belvédère du Fer à Cheval, Arbois. -

ISO 3166-2 NEWSLETTER Changes in the List of Subdivision Names And
ISO 3166-2 NEWSLETTER Date: 2010-02-03 No II-1 Changes in the list of subdivision names and code elements The ISO 3166 Maintenance Agency1) has agreed to effect changes to the header information, the list of subdivision names or the code elements of various countries listed in ISO 3166-2:2007 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code. The changes are based on information obtained from either national sources of the countries concerned or on information gathered by the Panel of Experts for the Maintenance of ISO 3166-2. ISO 3166-2 Newsletters are issued by the secretariat of the ISO 3166/MA when changes in the code lists of ISO 3166-2 have been decided upon by the ISO 3166/MA. ISO 3166-2 Newsletters are identified by a two-component number, stating the currently valid edition of ISO 3166-2 in Roman numerals (e.g. "I") and a consecutive order number (in Latin numerals) starting with "1" for each new edition of ISO 3166-2. For all countries affected a complete new entry is given in this Newsletter. A new entry replaces an old one in its entirety. The changes take effect on the date of publication of this Newsletter. The modified entries are listed from page 4 onwards. For reasons of user-friendliness, changes have been marked in red (additions) or in blue (deletions). The table below gives a short overview of the changes made. Page Alpha Short form of country name/ Short description of change 2-code/ Forme courte du nom de pays Code alpha 2 12 AL ALBANIA / ALBANIE Addition -
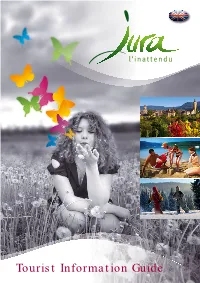
Tourist Information Guide Che-Com an Té Fr
Tourist Information Guide che-Com an té Fr Jura… Getting to the Jura area The name itself implies character, mystery – and indeed, visitors discover not one but several Juras, each one more breathtaking than the last. From the poetic ponds of Bresse to the snowy peaks of the Dôle, Jura’s wonder unfurl like Russian dolls: the magic of the Chaux forest, Vignoble’s good living, the gentle pace of the lake district and the “Low Mountains”, the sumptuous Haut-Jura… Every step of the way, you will rave about another landscape, another spread of colour, another playground… And just when you think you have seen it all, the best is yet to be discovered: and it is all so unexpected! www.jura-tourism.com Table of Contents Getting here P.2 Taste Jura p.78 Jura Maps P.3 Our most surprising nature sites p.80 13 highlights of the Jura P.4 Towns and villages to be visited p.82 4 micros région of the Jura P.17 Spas p.83 Pays Dolois et Bresse Jurassienne P.18 Treks p.84 Pays Vignoble et Revermont P.28 Outdoor activities p.89 Pays Lacs et Petite Montagne P.40 Oenotourism p.94 Pays Haut-Jura P.50 Winter activities p.96 Discovering Jura by Themes p.70 Families p.102 A page of history p.70 Tourism and Disability p.106 Museums p.72 Index p.107 Craftsmanship and know-how p.76 Useful addresses p.110 Tel. +33(0)3 25 71 20 20 Reproduction forbiddenMaps by ACTUAL www.actual.tm.fr 129-39/JMP/12-04 10 km Le Pays Dolois et Bresse Jurassienne Le Pays Vignoble et Revermont Le Pays Lacs et Petite Montagne Le Pays Haut-Jura 3 MUST-SEE PLACES Dole The town of liberty of the Franche-Comté inhabitants Take a town with a strong personality - and if possible enjoying the status of a ‘Ville d’Art et d’Histoire’. -

Besançon It's Time to B
> Statue of > The Imasonic Company > Sparkling Bisontine Water BESANçON IT’S TIME TO B Jouffroy d’Abbans Let the City of Time take you on a journey of extraordinary times… > Vélocité > The Citadel > La Rodia Besançon: A Time Teller and a Storyteller CONTENTS… Besançon is the City of Time, a bona fide teller of time and she has a thousand stories to tell. Time, as told by all the clocks and watches that have been made since the 18th century, has forged Besançon’s reputation. Markers of History: And time : what you are invited to take to discover and explore Besançon. Heritage in All Its Different Shapes and Forms 2 > 5 And so, we must take a journey: a journey through time, but also through space and lands- Snapshot: Vauban and the Fortifications 6 > 9 capes. Besançon’s story began in the loop in the Doubs River, where greens of every hue abound. Museum Byways 10 > 13 Vauban’s presence, of course, is at every street corner; the lines of 16th- and 17th-century Meet the People from Besançon: mansions proudly display their singular beige-blue stone facades, and there are her cour- the ‘Bisontins’ 14 > 17 tyards and secret staircases. Her festivals and events throughout the year lend vibrancy to the air. There is her fabulous history of watchmaking and micro- and nanotechnologies that Besançon on Stage: connects the halls of time and science. And then, there are the best places to go, the leading from Festivals to Plays and Shows 18 > 21 figures of yesterday and today... Besançon invites you to explore her great classics, her bold innovations and recent disco- The City of Time: veries. -

Mise En Page 1
BULLETIN MUNICIPAL PERRIGNY N°5 • Octobre 2009 Sommaire Le mot du Maire .............p 2 La vie perrignoise au jour le jour ...........................p 3-11 Etat civil / Agenda .......p 12 Bulletin édité par la Commune de Perrigny Directeur et responsable de la publication : Christiane MAUGAIN Crédits photographiques : Mairie de Perrigny, Mourier Imprimerie, Dépôt légal : 265 Création et impression : Chères Perrignoises, Chers Perrignois, Les coteaux de PERRIGNY prennent déjà des couleurs orangées : c'est le signe de l'arrivée de l'automne. Depuis quelques semaines, les rues résonnent à nouveau des cris et des rires des enfants de notre village qui ont repris le chemin de l'école. L'été est bien fini. Perrigny se réveille, enfin, après la pause estivale qui, cette année, a été égayée par la présence, très appréciée, de jeunes scouts allemands d'OFFENBOURG, au stade municipal. Les travaux décidés pour améliorer le cadre de vie de la commune vont pouvoir démarrer dans les semaines à venir : la réfection de la rue du Moulin, le réaménagement de la nouvelle mairie, l'étude pour la modernisation de l'école, la programmation pour la réfection de la rue des Tourterelles… enfin de nombreux projets structurants attendus par bon nombre de Perrignois. Des idées nouvelles contribuant à une meilleure animation de PERRIGNY sont actuellement mises en place comme, par exemple, la reprise des activités du Foyer Rural. Une structure de ce type rassemblant l'ensemble des habitants manquait ! Nous souhaitons que chaque Perrignois, quel que soit son âge, son sexe, son quartier, puisse participer à une activité de son choix. Le Foyer Rural doit être un lieu de rencontre des habitants et une source d’énergie nouvelle pour la vie du village en complément des associations locales existantes. -

Guide Pédagogique Des Musées Du Jura
_ Dossier pédagogique 2016-2017 Sites & musées du réseau Juramusées uramusees.fr LÉGENDE → Arbois → Dramelay Musée de la vigne et du vin du Jura Tour Musée d’Art - Hôtel Sarret de Grozon → Fort-du-Plasne Des sites naturels & des dinosaures Maison de Louis Pasteur Chalet à comté du Coin d’Aval Les Les chemins de l’archéologie Edito → Arlay → Gigny Des hommes & des savoir-faire Château Abbaye Saint-Pierre Les musées des Beaux-Arts → Baume-les-Messieurs → Lons-le-Saunier Abbaye Les chemins monastiques Musée des Beaux-Arts sites Grottes Musée Rouget-de-Lisle / Donation → Besain André Lançon Sentier karstique Maison de La vache qui rit → Bois-d’Amont → Lamoura Musée de la boissellerie Musée des lapidaires & musées → Cascades du Hérisson → Loulle Le Jura, fier de son histoire et de son inventivité… Maison des cascades Site à pistes de dinosaures → Champagnole → Mesnay Musée archéologique Écomusée du carton Le Jura est une terre de culture, d’art et d’histoire, qui a → Châtel (Commune de Gizia) Maison de l’abeille su tirer profit des nombreuses influences du passé. Riche du réseau Couvent/prieuré → Mirebel de cela, il continue à promouvoir la création artistique, → Chevreaux Château Château → Moirans-en-Montagne à destination de chacun, et en particulier des plus jeunes → Clairvaux-les-Lacs Musée du jouet générations. Juramusées Musée des maquettes à nourrir et → Montfleur courir le monde Moulin de Pont des Vents Expo « Il y a 6000 ans, des villages → Morez Son trésor culturel, notre Département sait le préserver lacustres à Chalain et Clairvaux » Musée de la lunette et l’exploiter au mieux, par respect pour les générations → Coisia → Nozeroy Site à pistes de dinosaures Cité des Chalon passées, et par amour des générations futures. -

A La Maison Gribouille
Au Village … (Sans prétentionprétention) Photo Georges Guyon Bulletin municipal de La Châtelaine Janvier 2013 Adresse du Site Internet de la commune : http://lachatelaine.arbois.com LE MOT DU MAIRE Voilà qui est fait ! Le château d’Artois est propriété de la Commune depuis le 22 octobre. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque la décision avait été prise il y a plusieurs mois, mais c’est un soulagement pour les élus, du fait des multiples obstacles administratifs qui ont dû être franchis. Le conseil municipal a pris sa décision à l’unanimité, après mûre réflexion, des discussions approfondies et des études sérieuses. Le dernier bulletin municipal (juillet 2012) a rendu compte avec précision des avantages du projet et de ses implications financières. On peut évidemment critiquer le bien-fondé d’une telle acquisition. Encore faut-il opposer des arguments solides. A défaut, quelques atrabilaires sentencieux, partisans de l’immobilisme et spécialistes du dénigrement systématique s’en donnent à cœur joie, hostiles par principe à tout projet dont ils ne sont pas les auteurs, se répandant en propos catastrophistes et parfois injurieux. Heureusement, chez le plus grand nombre, cette décision suscite un réel enthousiasme, au village et bien au-delà, et nous vaut quelques louanges réconfortantes. La gestion du dossier ne sera certes pas chose simple, mais je crois que l’avenir donnera raison à ceux qui ont osé ce défi. Autre réalisation récente, mais prévue de longue date (elle était annoncée et dessinée dans le bulletin municipal de janvier 2011) : la sécurisation du carrefour du Bas des Carres. La route à sens unique change les priorités en même temps que les habitudes, le rétrécissement oblige à ralentir … pas de quoi faire polémique. -

COMPLEMENT DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000 Moyenne Vallée De La Loue : De L’Aval De Quingey À Arc-Et-Senans
[DOCUMENT D’OBJECTIFS Site Natura 2000 des Vallées de la Loue et du Lison] COMPLEMENT DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000 Moyenne Vallée de la Loue : De l’aval de Quingey à Arc-et-Senans. C. Rossignon M. Parachout 1 Version finale, 2012 Page Sommaire Fascicule 2 INTRODUCTION .............................................................................................................................................................................................................. 3 CARTES DE SITUATION DU SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE LA LOUE, DE L’AVAL DE QUINGEY A ARC-ET-SENANS. .......................................... 4 RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTICS ............................................................................................................................................................... 5 Données administratives ............................................................................................................................................................................................. 5 Synthèse des données administratives ...................................................................................................................................................................... 8 Contexte physique et occupation du sol .................................................................................................................................................................. 9 Grands milieux .......................................................................................................................................................................................................... -

Les Planches Près Arbois Partie 1
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LA CUISANCE DIREN DE FRANCHE-COMTÉ PLAN DE GESTION DU SITE CLASSÉ DE LA RECULÉE DES PLANCHES-PRÈS-ARBOIS Diagnostic - mai 2005 DAT Conseils 12 rue de la Mairie 68470 STORCKENSOHN Tél : 03 89 82 73 17 - Fax : 03 89 38 22 24 - Email : [email protected] Communauté de Communes du Val de Cuisance – DIREN DE FRANCHE-COMTÉ - DAT Conseils – mai 2005 – page 1 SOMMAIRE page Contexte de l’étude 3 Démarche d’étude 5 -A- DIAGNOSTIC DU SITE CLASSÉ I. LES RICHESSES PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES : ENJEUX ET BESOINS DE GESTION ………...……………………………...………………... 6 1° La géomorphologie est le point fort de l’intérêt du site classé, à la base de multiples richesses 7 2° Le réseau hydrographique a façonné des paysages remarquables et a été utilisé pour sa force 10 hydraulique 3° La faune et la flore comportent de multiples espèces rares et protégées 13 4° Les richesses archéologiques s’échelonnent sur une période d’au moins 5000 ans 16 5° Les paysages ruraux anciens marquent l’identité paysagère actuelle 19 II. PLAN PATRIMONIAL ET PAYSAGER 22 23 1° Évolutions de l’occupation du sol et des paysages 2° Les pratiques agricoles, indispensables à l’entretien des paysages ouverts et des perspectives 25 3° Les évolutions forestières : une extension sur les terrains privés 30 4° Des évolutions villageoises et urbaines ponctuelles 32 5° Le tourisme : des enjeux pour le développement local 35 6° La carrière en bordure de la D 469 : des besoins de requalification 42 7° Diverses infrastructures 44 III. LA SENSIBILITÉ DES PAYSAGES ………….………………………………….………… 46 1° Belvédères et points de vue le long des itinéraires touristiques 47 2° Les enjeux des secteurs et les conflits d’enjeux 53 Communauté de Communes du Val de Cuisance – DIREN DE FRANCHE-COMTÉ - DAT Conseils – mai 2005 – page 2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE La Reculée des Planches-près-Arbois est située à quelques minutes en voiture d’Arbois, capitale des vins du Jura et site majeur du tourisme en Franche-Comté. -

Guide Touristique 2020
Touristic guide /Toeristische gids Offert par l’Office de Tourisme / Offered by the Tourist Office / Aangeboden door de VVV 1 1 2 Sellières, Les-Deux-Fays, 3 4 5 Foulenay, Tassennières, Saint Lothain Frontenay, Bersaillin, Charbonnières-les-Sapins Passenans, Etalans, Le Fied, Pontarlier, A Besançon, Villers-le-Lac, La Cluse et Mijoux Chapelle Voland, Chaussin, Commenailles, JURA Flacey-en-Bresse, Lac de Chalain Louhans B Pierre-de-Bresse, Sagy. Chaux Neuve, Marigny, Menétrux-en-Joux, Chapelle des bois Moirans-en-Montagne, Clairvaux-les-lacs, La Tour Du Meix Augea, Beaufort, C Champagnat, Chevreaux, Cressia, Cuiseaux, Les Charbonnières Saint Amour. AUTOCARS CREDOZ � EN AVION TRANSPORT TOURISTIQUE By plane / Mit dem Flugzeug Transports de groupes (associations, Aéroport international de GENÈVE Échelle : 1/200 000e groupes scolaires, sportifs...). > 108 km Aéroport international de LYON Conception du fond cartographique : > 141 km Latitude-Cartagène, cartographie mars 2014 Devis gratuit sur demande. www.latitude-cartagene.com � EN VOITURE / By car / Mit dem Auto 03 84 86 07 77 � EN BUS � EN TAxI Par autoroute A39 : � EN TRAIN [email protected] By taxi / Mit dem Taxi By bus / Mit dem Bus Sorties n°7 et 8 By train / Mit dem Zug Réseau de bus urbains sur Lons, www.transarc.fr De nombreux taxis vous sont proposés, Besançon > Lons-le-Saunier 1h10 Perrigny et Montmorot : contactez-nous pour connaître leur Depuis Bourg en Bresse = 62 km / 1h Lyon > Lons-le-Saunier 1h30 www.tallis.fr coordonnées, ou connecter-vous sur Depuis Dijon = 98 km / 1h10 Paris > Lons-le-Saunier le site des pages jaunes Depuis Lyon = 146 km / 1h30 N° Vert : 0 800 88 18 46 LIGNE FLIXBUS (via Dole ou Bourg-en-Bresse) 2h40 Depuis Annecy = 194 km / 2h10 Destinations : www.pagesjaunes.fr Moving around and how to get here Plusieurs lignes entre les villes à votre Depuis Paris = 416 km / 4h Renseignements sur PARIS, AUXERRE, DIJON, GENÈVE.