Ergebnisbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reisetipps Für Die Reise Durch Das Havelland – Stille Deine Sehnsucht (Ausgewählte Ziele – Nicht Vollständig)
Reisetipps für die Reise durch das Havelland – Stille Deine Sehnsucht (ausgewählte Ziele – nicht vollständig) Aktuelle Zahlen (Stand 31.12.2014): Das Havelland bedeckt eine Fläche von ca. 2700 km und hat 294.240 Einwohner. Größte Stadt im Havelland ist derzeit Falkensee mit 43115 Einwohnern, Der Havelland-Radweg 371 km beginnt in Berlin Spandau und führt durch das Havelland durch die Wassersportregion Havel-Elbe. Nr. Ort 1 Naturpark Hier kann man 1500 Kraniche und 100.000 Gänse beobachten Westhavelland („Entschleunigung durch Stillsitzen“) 2 Sternenpark Beim Astrotreffen kann man sich die Beobachtung der Sterne Westhavelland mittels Teleskop erklären lassen, die Milchstraße kann man mit bloßem Auge erkennen 3 Schloss Kleßen Mit Märkischem Gutsgarten (Pflege durch Familie Bredow) Märkische Musikfestspiele Spielzeugmuseum (ab 01. März Mi-So 11-17:00) 4 Stölln Ältester Flugplatz von Deutschland – Flugzeug IL62 – Lady Agnes dient als Otto-Lilienthal-Museum und Außenstelle Standesamt 5 Gollenberg Mit Lilien-Skulptur (Abflugstelle Otto Lilienthal bei Flugversuchen) 6 Groß Berchau Kolonistenpark von Friedrich II / Kolonistenkirche, Straußenhof 7 Strudeene Gülper See mit Erlebnisfischen/Fischsalate bei Fischerei Schröder Wasserwanderrastplatz an der Havel für Flöße/Hausboote Eselhof Wolsier 8 Hansestadt 6747 Einwohner Havelberg Stadtführungen 01.04.-31.10. Mo+Sa 10:00,14:30, So 11:30,14:30 Havelberg Dom mit Musikveranstaltungen 9 Garz am Havel- Vierseitshöfe, Achteckfachwerkkirche Radweg 10 Schollene am Bockwindmühle, Schloss, Heimatmuseum Havel-Radweg -

The Victims at the Berlin Wall, 1961-1989 by Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke August 2011
Special CWIHP Research Report The Victims at the Berlin Wall, 1961-1989 By Hans-Hermann Hertle/Maria Nooke August 2011 Forty-four years after the Berlin Wall was built and 15 years after the East German archives were opened, reliable data on the number of people killed at the Wall were still lacking. Depending on the sources, purpose, and date of the studies, the figures varied between 78 (Central Registry of State Judicial Administrations in Salzgitter), 86 (Berlin Public Prosecution Service), 92 (Berlin Police President), 122 (Central Investigation Office for Government and Unification Criminality), and more than 200 deaths (Working Group 13 August). The names of many of the victims, their biographies and the circumstances in which they died were widely unknown.1 This special CWIHP report summarizes the findings of a research project by the Center for Research on Contemporary History Potsdam and the Berlin Wall Memorial Site and Documentation Center which sought to establish the number and identities of the individuals who died at the Berlin Wall between 1961 and 1989 and to document their lives and deaths through historical and biographical research.2 Definition In order to provide reliable figures, the project had to begin by developing clear criteria and a definition of what individuals are to be considered victims at the Berlin Wall. We regard the “provable causal and spatial connection of a death with an attempted escape or a direct or indirect cause or lack of action by the ‘border organs’ in the border territory” as the critical factor. In simpler terms: the criteria are either an attempted escape or a temporal and spatial link between the death and the border regime. -
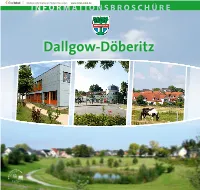
Dallgow-Döberitz
Dallgow-Döberitz Wir sind ganz in Ihrer Nähe! Stationär und ambulant sind wir für Sie da: Havelland Kliniken GmbH Klinik Nauen · Klinik Rathenow 14641 Nauen · Ketziner Straße 21 · Tel: 03321 42-0 ■ Innere Medizin Allgemein- und Viszeralchirurgie Urologie ■ Gynäkologie / Geburtshilfe Kinder- und Jugendmedizin ■ Orthopädie / Traumatologie Anästhesie / Intensivmedizin ■ Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatik (ambulant, stationär) Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH ■ Funktionsdiagnostik Radiologie Physiotherapie 14641 Nauen · Ketziner Straße 19 · Tel: 03321 42-1000 ■ Geriatrische Tagesklinik weitere Standorte in Falkensee, Wachow, Groß Behnitz und Rathenow 14641 Nauen · Ketziner Straße 13 · Tel: 03321 42-1570 Wohn- und Pfl egezentrum Havelland GmbH 14641 Nauen · Ketziner Straße 19 · Tel: 03321 42-1000 ■ Seniorenpfl egezentren in Nauen, Rathenow und Premnitz Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH 14641 Nauen · Ketziner Straße 19 · Tel: 03321 42-1000 Diagnostik mit allen Angeboten der Klinik · frühfunktionell · rehabilitativ ■ Gastronomie Hygiene- u. Facilitymanagement Zentralsterilisation Vermeidung bzw. Verminderung von Pfl egebedürftigkeit durch: - Ärztliche Untersuchung und Behandlung: Rettungsdienst Havelland GmbH · Labordiagnostik · Langzeitmessungen: EKG und Blutdruck 14641 Nauen · Ketziner Straße 19 · Tel: 03321 42-1000 · Ultraschalluntersuchungen · Endoskopie: Magen, Dickdarm - Aktivierende Pfl ege · Ernährungsberatung - Ergo -, Neuropsychologische, Sprach-, Schluck und Physiotherapie www.havelland-kliniken.de - -

Havelbus Aktuell
Havelbus Aktuell Das Fahrgastmagazin der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH 2/16 Der Bus fährt wie gerufen Kreative Köpfe sind gefragt Neues Verkehrskonzept Falkensee und Umland Ihr kostenloses Exemplar zum Mitnehmen! Editorial Juhu! – Sommer, Ferien, Sonnenschein. Planen Sie schon Ausfl üge für Ihre freien Tage? Mit Havelbus erreichen Sie sicher und komfortabel Ihr Ziel. Damit das auch zukünftig so bleibt, freuen Sie sich mit uns auf unsere zehn neuen Busse, die unsere Fahrzeugfl otte ab September verstärken. Mehr zu unseren Neulingen erfahren Sie auf Seite 3. Stölln war im vergangenen Jahr ein attraktiver BUGA-Standort und lockte viele Besucher. In diesem Jahr feierte das Otto-Lilienthal-Centrum den 168. Geburtstag des Flugpioniers. Hier wurde es Zeit für eine Anpassung der Busverbindung, die seit dem 1. Juni an Wochenendtagen als Rufbusangebot sowie als Bedarfshalt umgesetzt wurde. Lesen Sie auf den Seiten 4 bis 5, wie Sie diesen historischen Ort erreichen und Geschichte erleben können. Neben der Jubiläumsfeier hat das Havelland auch in diesem Sommer wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm und tolle Ausfl ugsziele zu bieten. Eine kleine Übersicht stellen wir Ihnen auf den Seiten 6 bis 9 vor. Möchten Sie oder Ihre Kinder in der Freizeit für uns kreativ sein, dann gibt es auf den Seiten 10 bis 11 viele Informationen für eine Teilnahme an unserem öffentlichen Ideenwettbewerb. Gesucht wird ein Havelbus-Unter- nehmensmaskottchen. Aktuell freuen sich alle Schulkinder sicher über die Ferien und denken noch nicht an ihren bekannten bzw. neuen Schulweg. Wir jedoch arbeiten in diesen Tagen schon auf Hochtouren, um alle Schülerfahrausweise pünktlich ausliefern zu können. Auf den Seiten 12 und 13 informieren wir Sie, wo Sie die Schülerfahrausweise erhalten und was dabei beachtet werden muss. -

2020 Falkensee/Spandau Am 15
Liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Der Havellandcup wurde vom SC Ketzin mit Anmeldung Sportbegeisterte, Unterstützung des Kreissportbundes und des Bei der Anmeldung zu den jeweiligen Läufen kann Havellandcup Landkreises Havelland ins Leben gerufen. auf dem Anmeldeformular die gewünschte ich freue mich Sie zu den Laufveranstaltungen des Teilnahme am Havellandcup angewählt werden. 2. Havellandcups einladen zu dürfen. Der Cup ist auf die Förderung des Breitensports im Damit ist gleichzeitig das Einverständnis erklärt, dass Havelland ausgerichtet, deshalb weder Zeiten noch Sport verbindet und so soll auch der Havellandcup die bei der Anmeldung gespeicherten Daten für die Platzierungen, sondern nur die reine Anzahl der Auswertung des Havellandcups genutzt werden unseren Landkreis sportlich verbinden. Neben der Läufe gewertet. Förderung des Breitensports liegt das Augenmerk dürfen. somit auch auf der Vielfalt unseres Landkreises. Die Teilnehmen können Läufer und Walker jeden Wer sich erst nach einem Lauf zur Teilnahme Läufe erstrecken sich von Frühling bis Herbst und Geschlechts und Alters. entscheidet, kann dies durch eine E-Mail an den über Stadt, Land und Fluss. Ausrichter unter [email protected] nachholen. Auf der Innenseite dieses Faltblatts sind die Hierbei ist der Lauf zu benennen und das Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern um eine einzelnen Läufe beschrieben, und dort befinden Einverständnis zu erklären, dass die bei diesem Lauf gute Zeit bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten. sich auch Hinweise zur jeweiligen Anmeldung. gespeicherten Daten für die Auswertung des Havellandcups genutzt werden dürfen. In diesem Sinne wünsche ich viel Bei der Auswertung zählt nur die Anzahl der Sponsoren des Havellandcups Vergnügen bei den Läufen im absolvierten Läufe. Havelland Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 4 2020 Ihr Roger Lewandowski Teilnahmen erhalten – unabhängig von den Prämierungen der einzelnen Veranstalter – eine Landrat Landkreis Havelland Urkunde und Medaille. -

Subject: Information About the Limitation Accessibility to the Job- Center in District of Havelland. Controlling's Measures Ag
Dear Ladies and Gentlemen: Subject: Information about the limitation accessibility to the Job- Center in District of Havelland. Controlling’s measures against Coronavirus-Infection. In order to avoid any infections to the citizens in District of Havelland we have set new accessibility rules to all Job-Centers, only by priority, to clarify the essential and important matters. Please note that it’s only possible after setting the appointment by phone! The essential service issues are: - To cover any lake with the health insurance. - Bank account lockout. - Homelessness. 1- Usual opening hours will not be offered until further notice. 2- Please note that all the appointments starting March the 17th, 2020 will be carried out by telephone. Please be ready to become a phone call within the appointment time. 3- We will be reachable through Phone calls, Emails and letters. You can send any documents and letters to one of the following addresses: Jobcenter Falkensee: Bahnstr. 8-12, 14612 Falkensee E-Mail: [email protected] Jobcenter Nauen: Waldemardamm 3, 14641 Nauen E-Mail: [email protected] Jobcenter Rathenow: Berliner Str. 15, 14712 Rathenow E-Mail: [email protected] Your social benefits will be paid as usual. Please don’t come to the Job-Center if you have any Flu symptoms, debility, fever, cough or sore throat or any other similar symptoms. Health department in District of Havelland has set a direct Hot-Line to answer your questions about Coronavirus: 03385 7119 Mondays and Tuesdays: 9:00 am until 6:00 pm. Wednesdays and Thursdays: 9:00 am until 4:00 pm. -

Finding Aid (English)
Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager in Deutschland und in den besetzen Gebieten (Fond 1367) Concentration and prisoner of war camps in Germany and the Occupied Territories RG-11.001M.20 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024-2126 Tel. (202) 479-9717 e-mail: [email protected] Descriptive summary Title: Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager in Deutschland und in den besetzen Gebieten (Fond 1367) Concentration and prisoner of war camps in Germany and the Occupied Territories Dates: 1937-1944 Accession number: 1993.A.0085.1.20 Extent: 10 microfilm reels (partial) digital images Repository: United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, Washington, DC 20024-2126 Languages: German Scope and content of collection The collection contains various documents of concentration camps and Prisoner of War (POW) camps: regulations, instructions, daily reports, lists, summaries, journals, personnel files, card files, questionnaires, registers, and correspondence. Includes fragmentary compilations of records of Sachsenhausen (ca. 6,000 prisoner file cards for KL Sachsenhausen/Oranienburg), Buchenwald, Wewelsburg, Gross Rosen, Dachau, Lublin (Majdanek), Natzweiler, Neuengamme (Hamburg), Treblinka, and Esterwegen concentration camps; of POW camps III-A in Luckenwalde, I-A in Stalag, IX-C in Bad Sulza, No.352 in Minsk, No.122 in Compiègne, France, POW camp in Murnau of the Polish officers, the Hammelburg officers camp, Stalag XII (for interned civilians) in Wulzburg (Bavaria), the Berlin-Falkensee camp for Italian and other foreign workers. Among the documents are lists of Jews transferred from the Auschwitz concentration camp to the Sachsenhausen concentration camp, and other records of the Sachsenhausen concentration camp: lists of prisoners including Jewish names, reports on changes in the prisoner population, and list of personal items left in the camp’s storage facility. -

Landkreis Havelland Lage • Landschaft • Übersicht
Berichte der Raumbeobachtung Kreisprofil Havelland 2012 Landkreis Havelland Lage • Landschaft • Übersicht Der mit rund 1.700 km² zu den Kleineren im Land Brandenburg Flächennutzung 2008 gehörende Landkreis Havelland (HVL) erstreckt sich von der Stadtgrenze Berlins bis an die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Wasser Sonstige Der Landkreis bildet zusammen mit PM, TF und den kreisfreien 3% 1% Städten P und BRB a.d.H die bevölkerungsreichste und von der Fläche her zweitgrößte Planungsregion Brandenburgs Havelland- Verkehr Fläming. Der Kreisverwaltungssitz ist das im weiteren Metropolen- 4% raum gelegene Rathenow, bereits vor der Wende Kreisstadt und mit rund 25.300 Einwohner nach Falkensee (40.500) zweitgrößte Stadt Siedlung des Landkreises. 6% Topografie Wald Landwirtschaft 26% 60% Neuruppin Mit fünf Landschaftsschutzgebieten (LSG), die über zwei Drittel der Fehrbellin Kreisfläche ausmachen, weist HVL den höchsten Flächenanteil an Gülper See LSG unter allen Brandenburger Landkreisen auf (Land: rund 40 %); Friesack dies auch bei den Naturschutzgebieten, die in der Summe eine Fläche von rund 242 km² und damit etwa ein Sechstel der Kreisflä- H av Sachsen- ell l änd Velten Have isc Anhalt her che einnehmen. Gr oße r H a Rathenow up Hennigs- tk Schönwalde-Glien Mit einem Anteil von 60 % Landwirtschaftsfläche an der Kreis- an dorf al fläche zählt HVL zu den Landkreisen mit den höchsten Werten (Land Nauen Brieselang 50 %). Die Waldfläche liegt mit rund 26 % (Land 35 %) unter dem Premnitz Falkensee Landesmittel, wohingegen der Anteil an Oberflächengewässern diesem mit 3,2 % in etwa entspricht. H Dallgow- av Berlin el Döberitz Ketzin Die Siedlungs- und Verkehrsflächen sind seit 1996 (einschließlich Berlinstatistischer Bereinigungen) um 19 %, ihr Anteil an der Kreisfläche Brandenburg um 1,6 %-Punkte auf 10 % gestiegen, was im Vergleich aller an der Havel Potsdam Klein- Landkreise einen mittleren Rang ausmacht. -
Havelland-Radweg Von Berlin in Den Naturpark Westhavelland
Havelland-Radweg Von Berlin in den Naturpark Westhavelland Information & Buchung 033237 859030 www.havelland-tourismus.de Von Berlin in den Angebote entlang des Havelland-Radweges Pauschalen Naturpark Westhavelland Havelland-Radweg und Umgebung Diese Radwander-Tour führt Sie in vier leichten Tagesetappen zwischen 40 und 50 km von der westlichen Berliner Stadtgrenze bis in den LÄNGE insgesamt 115 km ÜBERREGIONALE ANBINDUNG Naturpark Westhavelland. bei Schönwalde-Glien über den Berliner Mauerweg VERLAUF · 5 Übernachtungen mit Frühstück in gemütlichen an den Radfernweg Berlin-Kopenhagen, in Rathenow Rathenow Berlin-Spandau – Schönwalde – Wansdorf – Pausin – 2- bis 4-Sterne Hotels/Pensionen/Ferienwohnungen an den Havel-Radweg und die Tour-Brandenburg, Perwenitz – Paaren im Glien – Nauen – Lietzow – Berge – in Wansdorf an die Radtour »Otto Lilienthal« Unterkünfte Gaststätten · Informationsmappe mit Karten material und leihweise ein GPS-Gerät Ribbeck – Paulinenaue – Pessin – Senzke – Kriele – Kotzen – · tägliche Besprechung der Fahrtrouten Tourismusverband Havelland e. V. Stechow – Rathenow – Steckelsdorf – Grütz – Schollene BAHNANBINDUNG 1 Gemeinschaftshaus Waldschule Krämer www.waldschule-pausin.de 18 Ferienhausvermietung Liane Zemlin F*** www.l-zemlin.de 34 Restaurant »Ahh und Ohh« www.ahhundohh.de Am Anger 18 a, 14621 Schönwalde-Glien OT Pausin, Tel. 033231 62903 Dorfstraße 6, 14715 Stechow-Ferchesar OT Ferchesar, Tel. 033874 60365 Graf-Arco-Straße 9, 14641 Nauen, Tel. 03321 450788 · Transferleistungen des Gepäcks zwischen den einzelnen Übernach- Theodor-Fontane-Straße 10 · 14641 Nauen OT Ribbeck BrandenBurger Nauen, Paulinenaue, Rathenow gastlichkeit 7 DZ 3 FW***, 5 FW, 1 FH 2010 2012 gastliches havelland 35 BRANDENBURG Altstadt-Café-Nickel www.altstadt-cafe-nickel.de Eine Aktion des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg e.V., BESCHAFFENHEIT des Tourismusverband Havelland e.V. -

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Ketzin/Havel
Stadt Ketzin/Havel Integriertes Stadtentwicklungskonzept Ketzin/Havel Stand: November 2020 Auftraggeberin Stadt Ketzin/Havel Rathausstraße 7 14669 Ketzin/Havel Fachbereich II Frau Susanne Storch Tel.: 033233-720232 Fachbereich Finanzen und Bauverwaltung Frau Sabine Pönisch Tel.: 033233-720210 Bereichsleiterin:Auftragnehmer Gabrielein Haubold B.B.S.M. Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH Behlertstraße 3a, Haus G 14467 Potsdam Ansprechpartner: Frau Dr. Liebmann Tel. 0331/28997-0 [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 7 1.1 Anlass und Hintergrund 7 1.2 Funktion des INSEK 7 1.3 Bearbeitungsmethodik 8 1.4 Einschub: INSEK und Corona 9 1.5 Beteiligungsverfahren 9 2 Rahmenbedingungen und Bestandsanalyse 10 2.1 Übergeordnete Entwicklungsbedingungen 10 2.1.1 Stadtstruktur: Ketzin/Havel und Ortsteile 10 2.1.2 Lage in der Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg 11 2.1.3 Kommunale Konzepte und Förderprogramme 17 2.1.4 Demographische Entwicklung 19 2.1.5 Zusammenfassung der übergeordneten Entwicklungsbedingungen 32 2.2 Themenfeldbezogene Analyse 33 2.2.1 Städtebau und Wohnen 33 2.2.2 Wirtschaft und Beschäftigung 39 2.2.3 Bildung und Soziales 42 2.2.4 Kultur und Tourismus, Sport und Freizeit 46 2.2.5 Verkehr und technische Infrastruktur 50 2.2.6 Natur und Umwelt, Energie und Klimaschutz 56 2.3 Gesamtbild der Ketziner Stadtentwicklung 62 3 Strategische Stadtentwicklungsziele 63 3.1 Entwicklungsgrundsätze 63 3.2 Räumlich-funktionales Leitbild 65 4 Handlungsfelder und Zentrale Vorhaben -

Zumba, Yoga, Rückenschule
Sonnabend/Sonntag, 18./19. März 2017 | Seite 15 Herr der Steine: Horst Brix und seine RATHENOW Schätze Seite 21 MIT PREMNITZ, MILOWER LAND, RHINOW UND NENNHAUSEN MGUTEN TAG!M Von Jürgen Lauterbach Linke Hände ch fühle mich dem nicht ganz so bekann- ten englischen Sänger Billy Bragg ver- bunden, der seinem Schatz gesteht, dass Ier sie zwar über alles liebe, aber nicht ihr „handy man“ sei, was so viel bedeutet, dass er zwei linke Hände hat und weder ein Regal aufbauen kann noch für höhere handwerkli- che Tätigkeiten der Richtige ist. Ähnlich vom Schicksal gebeutelt und vom Möbelsteck- und Schraubprogramm der Handwerkerer- ziehungsanstalt Ikea in die eigenen Grenzen verwiesen, versuche ich mich daran, die neue Spülmaschine anzuschließen. Wasser und Strom, diese Mischung soll ja nicht ganz oh- ne sein. Überraschend problemlos bekomme ich die Sicherung ausgeschaltet, den Rest schafft die Methode Augen zu und durch. Am Ende ist der „handy man“ glücklich. Doch Ernüchterung naht. Während die Spülma- schine seit Tagen gewissenhaft ihre Dienste verrichtet, versagt das Licht meines Fahrra- des – trotz des Nabendynamos. Die Doppel- linkshand-Fehlersuche vom Birnchen bis zum Kabelchen endet ohne Erfolg. Die Werk- Zumba liegt auch in unserer Region im Trend. Vor allem Frauen verausgaben sich gern zu Party- und Après-Ski-Hits. FOTO: REGINA BUDDEKE statt muss ran. Sie meldet nach einer Sekun- de Vollzug. Der schlaue Mann hat den Licht- schalter nach links geschoben. Darauf muss ein Mensch erst mal kommen. Zumba, Yoga, Rückenschule MZAHL DES TAGESM An der Kreisvolkshochschule im Westhavelland boomen die Gesundheitskurse – Vorträge zu Gesundheitsthemen und Kräuterwanderungen sind auch sehr beliebt Von Joachim Wilisch tanzen - die Volkshochschulen de- lein 23 verschiedene Kurse sind es ba eigne sich auch sehr gut für Leute cken diese Nachfragen ab. -

Offene Gärten 2021
Achtung: Wegen der Corona-Krise sind Änderungen, Terminabsagen oder Verschiebungen je nach Entwicklung der Situation möglich. Siehe auch Presseveröffentlichungen oder Agenda-Webseite. Die Corona-Regeln sind zu beachten! Offene Gärten 2021 Machen Sie mit, öffnen auch Sie Ihren Garten! Die Gärten öffnen von 10 bis 16 Uhr (geänderte Zeit!) Info: www.agenda21-falkensee.de, [email protected] Datum Name Vorname Straße PLZ Ort Bemerkungen 13. Jun. Funke Anne Rottweiler Str. 24 14612 Falkensee Rhododendren u. Azaleen am Marie Waldrand sowie Teich 13. Jun. Scholz Ruth Zeppelinstr. 12 14612 Falkensee Stauden und Teich unter alten Bäumen 13. Jun. Bodien Adelheid Zaunkönigstr. 8 14612 Falkensee Harmonie mit Teich und Kleinkunst, Wolfgang umgeben von Stauden und Rosenbeeten 13. Jun. Schneekloth Anna Ringstr. 11 14612 Falkensee Romantischer Garten mit alten Rosensorten und Naturteich Lokale Agenda 21 FalkenseeAG Umwelt | Offene Gärten 2021 Seite 1 von 3 13. Jun. Giesen Irmtraud Parkstr. 24 a 14612 Falkensee Garten in Hanglage mit Rhododendren u. Azaleen unter alten Bäumen, natürliches Biotop 13. Jun. Porzich Brigitte Dürer Str. 43 14612 Falkensee Großer naturnaher Garten mit interessanten Sträuchern, Rosen und Sträuchern. Pflanzenverkauf für einen guten Zweck 20. Jun. Helfrich Petra Im Wolfsgarten 17 14612 Falkensee Gepflegter Staudengarten, Fuchsien, Rosen und Kübelpflanzen 20. Jun. Fiedler Rolf Im Wolfsgarten 19 14612 Falkensee Vielfältiger naturnaher Garten in Bläsing Erhard Hanglage 20. Jun. Goullon Hildegard Rüsternallee 3 14621 Schönwalde Landschaftsgarten mit vielfältigen -Glien Bereichen, Sichtachsen und altem Baumbestand 27. Jun. Scholz Sibylle Zeppelinstr. 34 14612 Falkensee Familiengarten mit Stauden, Obstgarten,Weidentippi 27. Jun. Aland Romy u. Herderallee 12 14612 Falkensee Abwechslungsreicher Hausgarten Gunnar 27.