Das Schwefelbad Bad Tennstedt 71-77 Veröff
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
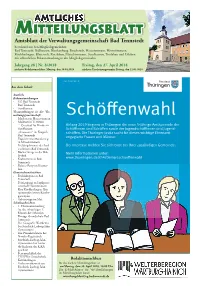
Mitteilungsblatt
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bestehend aus den Mitgliedsgemeinden: Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben und Urleben mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Jahrgang 28 | Nr. 8/2018 Freitag, den 27. April 2018 nächster Redaktionsschluss: Montag, den 30.04.2018 nächster Erscheinungstermin: Freitag, den 11.05.2018 Aus dem Inhalt Amtliche Bekanntmachungen - VG Bad Tennstedt - Bad Tennstedt - Sundhausen Veranstaltungen in der Ver- waltungsgemeinschaft - Maifeuer in Haussömmern - Maifeuer in Tottleben - 7. Crosslauf für Kinder in Sundhausen - „Anwassern“ im Kurpark Bad Tennstedt - Vogelstimmenwanderung in Mittelsömmern - Frühlingskonzert des Stad- torchesters Bad Tennstedt - Bücherzwerge in der Bib- liothek - Kurkonzerte in Bad Tennstedt - Release Party im Kosmo- laut Gemeindenachrichten - Frühjahrsputz in Bad Tennstedt - Danksagung an Jagdgenos- senschaft Haussömmern - Kita Kirchheilingen- Ein spannendes letztes Kinder- gartenjahr - Geburtstage im Mai Schulnachrichten - 1. Elternversammlung für die zukünftigen 1. Klassen der Sebastian- Kneipp-Grundschule Bad Tennstedt - Der Geografie-Wettbewer- bes Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasiums - Die Pressekonferenz der Novalis-Regelschule - Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium hat hinter die Kulissen des KiKA geschaut - Ferienrückblick der THEPRA Grundschule Kirchheilingen Redaktionsschluss - Vorlesewettbewerb am für das nächste -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Verbandswasserwerk Bad Langensalza / AZV „Mittlere Unstrut“
Amtsblatt des Zweckverbandes Verbandswasserwerk Bad Langensalza mit dem Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13 Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ für sein Verbandsgebiet mit den Mitgliedsgemeinden Bad Langensalza, Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Dachwig, Großvargula, Haussömmern, Herbsleben, Hornsömmern, Kirchheilingen, Mittelsömmern, Nottertal-Heilinger Höhen (Ortsteile Bothenheilingen, Kleinwelsbach, Neunheilingen), Schönstedt, Schwerstedt, Sundhausen, Tonna, Tottleben, Unstrut-Hainich (Ortsteil Altengottern), Urleben (entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung -ThürBekVO- vom 22. August 1994 in der jeweils geltenden Fassung) 18. Jahrgang Laufende Nummer: 13 Ausgabetag: 11. Dezember 2020 Inhaltsverzeichnis: Amtlicher Teil: Seite • Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ 2021 1 • Bekanntgabe der Allgemeinen Preisregelungen für die Wasserversorgung des Trinkwasser- zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ vom 10.12.2020 3 • Bekanntmachung des Verbandswasserwerkes Bad Langensalza gemäß § 13 Trinkwasserverordnung für die Gemeinde Herbsleben, Ortsteil Kleinvargula 6 • Bekanntgabe von Beschlüssen des Verbands- und Werksausschusses des Trinkwasser- zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ vom 26. August 2020 7 • Bekanntgabe von Beschlüssen des Verbands- und Werksausschusses des Trinkwasser- zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ vom 24. September 2020 7 -

Das Erosionsgebiet Bruchstedt - Eine in Deutschland Einzigartige, Landeskulturelle Anlage Der Moderne
Das Erosionsgebiet Bruchstedt - eine in Deutschland einzigartige, landeskulturelle Anlage der Moderne Das Erosionsgebiet Bruchstedt in Hanglage in der Bildmitte Copyright Patrizia Kramer, Jena, 2016 Olaf Bellstedt (Bundesfreiwilligendienstleistender der VG Bad Tennstedt, Einsatzort Bruchstedt) Rainer-Maria-Rilke-Str. 4 99425 Weimar 27.3.2016 Teil 1 Kurze Geschichte des Erosionsgebietes von Bruchstedt Es geschah in der Nacht des 23.Mai 1950. Ein heftiges Unwetter Bruchstedt ließ in dieser Nacht den sonst still vor sich hinfließenden Fernebach zu einem gewaltigen Strom anschwellen, der dann den kleinen Ort Bruchstedt mit einer über 3 Meter hohen Welle aus Wasser, Schlamm und Hagelkörner traf, was zahlreiche Menschen und Tieren das Leben kostete und umfangreiche Gebäudeschäden zur Folge hatte. Bruchstedt im Mai 1950 - von der Wucht des Wassers zerstört Foto: Fiedler, 1951 (aus: TLUG-Schriftenreihe Nr. 92, S. 48) Damit so ein Unwetter nicht noch einmal solchen Folgen nach sich ziehen kann, wurden die Gründe und Ursachen räumlich analysiert und entsprechende Maßnahmen geplant und zügig umgesetzt. Man fand heraus, dass der Boden an den Hängen beiderseits des Fernebachs nicht in der Lage war, das auf die Hänge plötzlich niedergehende Regenwasser aufzunehmen. Stattdessen floss es oberflächlich ab. Es und schwemmte dadurch den Boden ab, der dann in den Fernebach gelangte, wodurch dieser zu einem reißenden Strom aus schlammigem Wasser wurde. Es wurden mechanische (erdbauliche) und pflanzliche Maßnahmen (landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und obstbauliche) kombiniert. Das so entstandene großflächige Erdbauwerk sollte beispielhaft zeigen, wie erosionsgefährdete Böden zukünftig bewirtschaftet werden können, ohne dass bei Starkniederschlägen der Boden erneut erodiert. Diese Art von Anlage sollte in allen vergleichbaren Situationen des Landes Thüringen entstehen. -

Steckbrief Subknoten Bad Langensalza Bestandsanalyse Der Örtlichen Verknüpfung
Steckbrief Subknoten Bad Langensalza Bestandsanalyse der örtlichen Verknüpfung Der Subknoten Bad Langensalza liegt etwa 700 Meter südlich des Stadtzentrums und bietet eine stündliche Anbindung nach und von Erfurt. Die jeweilige Zugkreuzung ermöglicht die gleichen Fahrlagen der Buslinien in Hin- und Rückrichtung. Durch die räumliche Nähe von Bahnhof und ZOB sind kurze Übergangswege gegeben. Durch die fehlenden Anschlüsse vieler Regionalbuslinien ist die räumliche Erschließungswirkung des Subknotens in dessen mittelzentralem Funktionsraum allerdings sehr eingeschränkt. Neben der vollständigen Barrierefreiheit ist der gute Gesamteindruck positiv hervorzuheben. Die teilweise unübersichtliche Zugangssituation wird durch eine eindeutige Wegweisung aufgewogen. Lediglich das Empfangsgebäude fällt aufgrund von Vandalismusschäden negativ auf. DFI sind beim SPNV und ZOB vorhanden. Ein Tarifverbund zwischen SPNV und Bus besteht nicht. Die Reisezeit im SPNV nach Erfurt ist zum Pkw-Verkehr konkurrenzfähig. Dieser Vorteil kann aufgrund der überwiegend fehlenden Verbindungen nicht in den Funktionsraum übertragen werden. Dies wirkt Zusammenfassung sich beispielsweise in Richtung des Grundzentrums Bad Tennstedt negativ aus. Vor hier aus wird die doppelte Reisezeit in Richtung Erfurt im Vergleich zum Pkw-Verkehr benötigt. Der mittelzentrale Funktionsraum weist geringe Nachfragepotenziale auf, sodass SPNV- Verknüpfungen vor allem in der Hauptverkehrszeit empfehlenswert sind. Die Verbindung über Bad Tennstedt nach Sömmerda ist als landesbedeutsame StPNV-Relation -

Stadtnachrichten Aus Bad Tennstedt
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bestehend aus den Mitgliedsgemeinden: Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben und Urleben mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Jahrgang 29 | Nr. 07/2019 Freitag, den 12. April 2019 nächster Redaktionsschluss: Donnerstag, den 11.04.2019 nächster Erscheinungstermin: Freitag, den 26.04.2019 Aus dem Inhalt Amtliche Bekanntmachungen Die Verwaltungs- Bad Tennstedt Ballhausen Blankenburg Bruchstedt gemeinschaft Haussömmern Hornsömmern Kirchheilingen Bad Tennstedt Kutzleben Mittelsömmern Sundhausen Tottleben wünscht Urleben VG Bad Tennstedt Veranstaltungen in der VG Bad Tennstedt allen Bürgerinnen Osterfeuer in Bad Tennstedt, Mittelsömmern, Tottleben 22. Verbandsfeuerwehrtag Theateraufführung und Bürgern … Romeo & Julia „Anwassern“ im Kurpark Frühlingskonzert in Bad Tennstedt Gemeindenachrichten Frühjahrsputz im Freibad Kirchheilingen Bruchstedt - Zeitzeugen der Flut- katstrophe von 1950 gesucht! Frühjahrsputz in Bad Tennstedt Schulnachrichten Theateraufführung Romeo & Julia der Staatlichen Regelschule -Novalis- Bad Tennstedt Winterlaufserie in Creuzburg des Jahngymnasium Das Vamperl wird lebendig - THEPRA Grundschule Kirch- heilingen REDAKTIONS- SCHLUSS für das nächste Mitteilungsblatt ist am Donnerstag, dem 11. April 2019, 16:00 Uhr Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet: mitteilungsblatt@ vg.badtennstedt.de Amtliches -

Gesamtbericht 2018
Gesamtbericht über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Öffentlichen Personen- nahverkehr gemäß Artikel 7 Abs. 1 der VO (EG) 1370/2007 Zuständige örtliche Behörde (Aufgabenträger des straßengebundenen Personennahverkehrs): Landkreise: Kyffhäuserkreis Landratsamt, Markt 8, 99706 Sondershausen Unstrut-Hainich-Kreis Landratsamt, Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen als Gruppe von Behörden. Die Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr haben einmal jährlich einen Gesamtbericht über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und gewährten Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 (1) VO (EG) 1370/2007 zu erstellen. Der Kyffhäuserkreis und der Unstrut-Hainich-Kreis kommen hiermit ihrer Berichtspflicht für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 nach. Die Landkreise haben auf dem Wege der Direktvergabe gemäß Artikel 5 Abs. 2 der VO (EG) 1370/2007 die Linienbündel „MHL-Stadt“ und „SDH-Stadt“ an die Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH und die Linienbündel „UH-Mitte Regional“ sowie „KYF-West Regional“ an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH vergeben. Die Linienbündel umfassen die folgenden Linien: „MHL-Stadt“: KL 2: Bahnhof – Untermarkt - Bastmarkt - Schwanenteich KL 3a: Bahnhof – ZOB – Bastmarkt – Goetheweg, Baumarkt – Felchta KL 5: Bollstedt – Görmar – Forstberg – Bahnhof – ZOB – Blobach – Schwanenteich - Weißes Haus KL 7 Bonatstraße – An der Trift – Bahnhof – ZOB - Sambach KL 8/1 Felchta – Unterstadt – Oberstadt – Forstberg – ZOB – Harwand – Ammern (OBI) KL 8/2 Felchta – Bahnhof -

Referenzblatt Bad Tennstedt
Unsere Referenzen KEMS Mehr Energietransparenz und -effizienz für Kommunen Die Stadt Bad Tennstedt im thüringischen Unstrut-Hainich-Kreis liegt im west- Stadtverwaltung lichen Teil des Thüringer Beckens, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Erfurt. Bad Tennstedt Markt 1 Rund 2.480 Einwohner leben hier. Dank des Kommunalen Energie Monitoring 99955 Bad Tennstedt Systems (KEMS) der TEAG konnte die Kommune Kosten- und Verbrauchstreiber Telefon 036041 38013 ermitteln und konkrete Einsparmaßnahmen planen. www.badtennstedt.de 5 untersuchte Liegenschaften Rathaus, Touristinformation und Bibliothek (Haus des Gastes), Rettungswache des DRK (Haus Eintracht), Bauhof, Feuerwehrgerätehaus Energieverbrauch und CO2-Emission im Jahr 2014 Heizenergie: ca. 400.000 kWh/Jahr CO2: 80 t/Jahr Strom: ca. 39.400 kWh/Jahr CO2: 21 t/Jahr Ausgangslage geringe Transparenz über Verbrauchsstruktur und Einsparpotenziale keine Bewertungsmöglichkeit von Effekten aus Sanierungsmaßnahmen kaum Priorisierung von geplanten Sanierungsarbeiten möglich Ziele Reduzierung der Verbräuche und Kosten einzelner Liegenschaften Zuordnung der Verbrauchsstruktur und Aufzeigen von Effizienzpotenzial Ableitung und Priorisierung geringinvestiver, nachhaltiger Maßnahmen bei der Sanierung Senkung von CO2-Emissionen Service, der überzeugt Die Thüringer Energie ist ein kompetenter Partner – auch für Ihre Kommune. Unsere erbrachten Leistungen (1. Monitoringjahr) Erfassung der Jahresverbrauchsdaten von 5 Liegenschaften rückwirkend für 1 Jahr (Strom, Heizenergie) Vor-Ort-Begehung in 4 Fokusliegenschaften -

Available As PDF
ID Locality Administrative unit Country Alternate spelling Latitude Longitude Geographic Stratigraphic age Age, lower Age, upper Epoch Reference precision boundary boundary 3247 Acquasparta (along road to Massa Martana) Acquasparta Italy 42.707778 12.552333 1 late Villafranchian 2 1.1 Pleistocene Esu, D., Girotti, O. 1975. La malacofauna continentale del Plio-Pleistocene dell’Italia centrale. I. Paleontologia. Geologica Romana, 13, 203-294. 3246 Acquasparta (NE of 'km 32', below Chiesa di Santa Lucia di Burchiano) Acquasparta Italy 42.707778 12.552333 1 late Villafranchian 2 1.1 Pleistocene Esu, D., Girotti, O. 1975. La malacofauna continentale del Plio-Pleistocene dell’Italia centrale. I. Paleontologia. Geologica Romana, 13, 203-294. 3234 Acquasparta (Via Tiberina, 'km 32,700') Acquasparta Italy 42.710556 12.549556 1 late Villafranchian 2 1.1 Pleistocene Esu, D., Girotti, O. 1975. La malacofauna continentale del Plio-Pleistocene dell’Italia centrale. I. Paleontologia. Geologica Romana, 13, 203-294. upper Alluvial Ewald, R. 1920. Die fauna des kalksinters von Adelsheim. Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen geologischen Vereines, Neue Folge, 3330 Adelsheim (Adelsheim, eastern part of the city) Adelsheim Germany 49.402305 9.401456 2 (Holocene) 0.00585 0 Holocene 9, 15-17. Sanko, A.F. 2007. Quaternary freshwater mollusks Belarus and neighboring regions of Russia, Lithuania, Poland (field guide). [in Russian]. Institute 5200 Adrov Adrov Belarus 54.465816 30.389993 2 Holocene 0.0117 0 Holocene of Geochemistry and Geophysics, National Academy of Sciences, Belarus. middle-late 4441 Adzhikui Adzhikui Turkmenistan 39.76667 54.98333 2 Pleistocene 0.781 0.0117 Pleistocene FreshGEN team decision Hagemann, J. 1976. Stratigraphy and sedimentary history of the Upper Cenozoic of the Pyrgos area (Western Peloponnesus), Greece. -

Räumliche Ausdehnung
Anlage zum Handbuch GeoMIS-Th -Räumliche Ausdehnung- Nachfolgend sind für: Landkreise Verwaltungsgemeinschaften Erfüllende Gemeinden Gemeinden Bounding Boxen der räumlichen Ausdehnung im amtliche System ETRS89/UTM Zone 32 (EPSG- Code 25832) mit geografischen Koordinatenangaben aufgeführt. Diese Angaben werden zur Erfassung von Metadaten benötigt und können von hier kopiert werden. Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Einhaltung aller Gebietsstrukturveränderungen und werden nicht fortgeführt. Liste der räumlichen Ausdehnung für Landkreise Landkreis Nördliche Breite Südliche Breite Östliche Länge Westliche Länge Altenburger Land 51,10206 50,80991 12,65654 12,20748 Eichsfeld 51,59409 51,18617 10,53737 9,93143 Eisenach 51,05330 50,92878 10,39016 10,17751 Erfurt 51,08087 50,88988 11,17375 10,85866 Gera 50,97659 50,79862 12,16968 11,99810 Gotha 51,11411 50,71183 10,96010 10,40704 Greiz 50,97569 50,54926 12,32411 11,85972 Hildburghausen 50,61907 50,20117 11,03691 10,45698 Ilm-Kreis 50,91418 50,54420 11,22224 10,73688 Jena 50,98960 50,85584 11,67289 11,49979 Kyffhäuserkreis 51,43224 51,19435 11,47420 10,48849 Nordhausen 51,65131 51,36399 10,97521 10,47222 Sömmerda 51,32531 51,00667 11,48386 10,86292 Saale-Holzland-Kreis 51,08803 50,74610 12,02126 11,42064 Saale-Orla-Kreis 50,79946 50,37369 11,96421 11,46385 Saalfeld-Rudolstadt 50,83688 50,41730 11,63224 10,96852 Schmalkalden-Meiningen 50,85430 50,38687 10,75075 10,04417 Sonneberg 50,54517 50,26442 11,28676 10,94270 Suhl 50,66769 50,55951 10,82690 10,55334 Unstrut-Hainich-Kreis -

Freitag, Den 27. Mai 2016 Nummer 10
Amtliches MitteilungsblattMitteilungsblatt Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bestehend aus den Mitgliedsgemeinden: Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben und Urleben mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Jahrgang 26 Freitag, den 27. Mai 2016 Nummer 10 www.badtennstedt.de Bad Tennstedt - 2 - Nr. 10/2016 Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben Redaktionsschluss Montag, Dienstag, Donnerstag ............................. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr für das nächste Mitteilungsblatt ist Gerade Kalenderwoche Ungerade Kalenderwoche am Dienstag, dem 31. Mai 2016, 16:00 Uhr Mo.: Dr. med. Kley Dipl. Med. Beylich Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet: Die.: Dr. med. Arand Dipl. Med. Kämpf [email protected] Do.: Dipl. Med. Funke Dr. med. Klemmer Zukünftig können Eingänge von Artikeln nach 16:00 Uhr nicht mehr berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Thomas Frey Unsere Hausarztpraxis Matschulat Gemeinschaftsvorsitzender in Kirchheilingen bleibt vom 11.07. - 29.07.2016 wegen Sommerurlaub geschlossen. Das Praxisteam Öffnungszeiten Apotheken: Rats-Apotheke in Bad Tennstedt Inh.: Apotheker Dr. A. König Notrufe und Bereitschaftsdienste Tel. 036041 57048 Montag bis Freitag 08:00 - 13:00 Uhr Notrufe: Montag und Donnerstag 14:00 - 19:00 Uhr Dienstag, Mittwoch, Freitag 14:00 - 18:00 Uhr Polizei 110 Samstag 09:00 - 12:00 Uhr Feuer/Rettungsdienst -

UND BAUVEREIN Der Gothaer Spar- Und Bauverein Eg Feiert 110-Jähriges Jubiläum – Wir Gratulieren Herzlich
BEWOHNERMAGAZIN 2/19 KONTAKT MEHR ALS NUR NOTIZEN AWG sponsert seit 11 Jahren ein ganz besonderes Hausaufgabenheft MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL Tag der Nachbarn – ein Rückblick 110 JAHRE GOTHAER SPAR- UND BAUVEREIN Der Gothaer Spar- und Bauverein eG feiert 110-jähriges Jubiläum – Wir gratulieren herzlich. Städtische Wohnungsgesellschaft Bad Tennstedt mbH Gesellschaft der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt KONTAKT Das Bewohnermagazin „Für dich soll’s Orchideen regnen …“ – so könnte man die Dankes- geste betiteln, mit der die sieben von ihren Mitmietern ausgewählte „Lieblingsnachbarn“ mit Blumen und Regenschirm bedacht wur- den. Es war nicht die einzige hübsche Idee, um gute Nachbarschaft zu würdigen. Die AWG richtete gemeinsam mit SWG, TAG, Stadt und Aktiv-Treff erstmals den„Tag der Nachbarn“ aus, wo die Aktion mit kleinen Bühnenprogrammen der Waldorfschule, der Kita Dreiklang oder der Ziola GmbH richtig Fahrt aufnahm. Egal ob am Nordplatz, im Goetheviertel, Karthausgarten, in der Erich-Honstein-Straße oder im thInka Bürgerbüro – sich treffen, kennenlernen und mit- einander feiern, das kam bei den Veranstaltungen in der ganzen Stadt überall an. „Ein Fest gegen die Einsamkeit und für die Ge- meinschaft“ – mit diesen Worten brachte Eisenachs Oberbürger- meisterin Katja Wolf das Anliegen wohl auf den Punkt. Feiern wollen demnächst aber auch die Mitglieder des Gothaer Spar- und Bau- vereins und zwar ihr 110-jähriges Bestehen, einige unserer Jubilare sowie das 10 000. Genossenschaftsmitglied der AWG „Eisenach“ eG. Und dass die geplante Exkursion nach Neudietendorf sich von Unterhaltung und guter Laune ebenfalls nicht weit entfernt, dürfte niemanden überraschen. Doch Sie dürfen sich jetzt überraschen las- sen: von unserer neuen Ausgabe des Bewohnermagazins „Kontakt“.