Fritz Schaefler * 1888 + 1954
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vogelsang (Hermann Ludolf) Karl Emil
Wacek 380 Wach das Rgt.jubiläum 1896 (200 Jahre „Hoch- ed. F. Anzenberger, 2016, passim (m. B.); KA, WStLA, und Deutschmeister“) schrieb W. die beide Wien; Pfarre Soběslav, CZ. „Deutschmeister-Lieder“, eine musikal. Rgt.- (F. Anzenberger) geschichte; zur Einweihung des Deutsch- meister-Denkmals 1906 in Wien auf dem Wach Aloys, eigentl. Wachlmayr Alois Deutschmeister-Platz entstand sein „Deutsch- Ludwig, Maler, Graphiker und Schriftstel- meister-Denkmal-Marsch“. 1910 unternahm ler. Geb. Lambach (OÖ), 30. 4. 1892; gest. die Kapelle auf Einladung des Großindus- Braunau am Inn (OÖ), 18. 4. 1940; röm.- triellen →Arthur Krupp eine ausgedehnte kath. – Sohn des Gastwirts Anton Wachl- Südamerika-Tournee, woraufhin W. dem mayr und dessen Frau Anna Wachlmayr, Mäzen dieser Reise den „Krupp-Marsch“ geb. Grundner; ab 1917 verheiratet mit widmete. Neben den militär. Verpflichtun- Käthe Käser. – Nach der Bürgerschule ab- gen absolv. die Militärmusik jährl. mehrere solv. W. auf Drängen seiner Familie zu- hundert Auftritte (Unterhaltungskonzerte, nächst eine Lehre als Kaufmann und Tanzveranstaltungen) bei privaten Auftrag- arbeitete ab 1909 kurzfristig in diesem gebern in Wien, teils bis zu vier Termine Beruf. Daneben bemühte er sich jedoch gleichzeitig in geteilten Besetzungen, was konsequent um eine Kunstausbildung. Nach Kapellmeister W., der an den Auftrittsga- mehreren erfolglosen Versuchen in Wien gen beteiligt war, ein beträchtl. Zusatzein- und München ging er 1912 nach Berlin, wo kommen ermöglichte. Während des 1. Welt- er als Schüler von Richard Janthur in das kriegs diente die reguläre Musikkapelle im Umfeld der beginnenden expressionist. Be- Feld. W. blieb jedoch mit den Musikern des wegung kam. 1913 reiste er nach Paris, um „Ersatzbataillons“ die meiste Zeit in Wien künstler. -

Matthias Boeckl Rekonstruktion Einer Verlorenen Kultur
www.doew.at Matthias Boeckl Rekonstruktion einer verlorenen Kultur Aus: Fritz Schwarz-Waldegg. Maler-Reisen durchs Ich und die Welt, hrsg. v. Matthias Boeckl für das Jüdische Museum der Stadt Wien, Wien 2009, S. 15–31 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors Obwohl die so genannte Zwischenkriegszeit unserer Gegenwart näher steht als etwa die Zeit um 1900, ist die detaillierte Rekonstruktion des Wiener Kunst- betriebs von 1918 bis 1938 ein wesentlich schwierigeres Unterfangen als die Historiografie des Wiener Jugendstils. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die 1920er und 1930er Jahre waren jene Ära, in der nach den historischen Entwick- lungsschritten der Toleranz, der Emanzipation und schließlich der Assimilation der Juden Österreichs in vielen gutbürgerlich-jüdischen Familien eine Genera- tion aufgewachsen war, die ausgeprägte künstlerische und intellektuelle Ambi- tionen hegte. Das großteils urbane Umfeld und die betont musische und kultu- relle Bildung, die in vielen jüdischen Familien einen wichtigen Teil der Tradi- tion und Identität bildete, sowie oftmals saturierte wirtschaftliche Verhältnisse, die derlei Betätigungen nun vermehrt ermöglichten, bereicherten das Wiener Kulturleben um eine große Anzahl jüdischer Schriftsteller, Maler, Architekten und Gelehrter. Trotz latenter und später offen antisemitischer Stimmungen etwa an der Universität oder in Künstlerorganisationen wie der Secession und dem 1934 gegründeten Neuen Werkbund, die keine jüdischen Mitglieder aufnah- men, beteiligten sich 1918 bis 1938 mehr jüdische -

Download File
Eastern European Modernism: Works on Paper at the Columbia University Libraries and The Cornell University Library Compiled by Robert H. Davis Columbia University Libraries and Cornell University Library With a Foreword by Steven Mansbach University of Maryland, College Park With an Introduction by Irina Denischenko Georgetown University New York 2021 Cover Illustration: No. 266. Dvacáté století co dalo lidstvu. Výsledky práce lidstva XX. Věku. (Praha, 1931-1934). Part 5: Prokroky průmyslu. Photomontage wrappers by Vojtěch Tittelbach. To John and Katya, for their love and ever-patient indulgence of their quirky old Dad. Foreword ©Steven A. Mansbach Compiler’s Introduction ©Robert H. Davis Introduction ©Irina Denischenko Checklist ©Robert H. Davis Published in Academic Commons, January 2021 Photography credits: Avery Classics Library: p. vi (no. 900), p. xxxvi (no. 1031). Columbia University Libraries, Preservation Reformatting: Cover (No. 266), p.xiii (no. 430), p. xiv (no. 299, 711), p. xvi (no. 1020), p. xxvi (no. 1047), p. xxvii (no. 1060), p. xxix (no. 679), p. xxxiv (no. 605), p. xxxvi (no. 118), p. xxxix (nos. 600, 616). Cornell Division of Rare Books & Manuscripts: p. xv (no. 1069), p. xxvii (no. 718), p. xxxii (no. 619), p. xxxvii (nos. 803, 721), p. xl (nos. 210, 221), p. xli (no. 203). Compiler: p. vi (nos. 1009, 975), p. x, p. xiii (nos. 573, 773, 829, 985), p. xiv (nos. 103, 392, 470, 911), p. xv (nos. 1021, 1087), p. xvi (nos. 960, 964), p. xix (no. 615), p. xx (no. 733), p. xxviii (no. 108, 1060). F.A. Bernett Rare Books: p. xii (nos. 5, 28, 82), p. -

ROTES ANTIQUARIAT Katalog Frühjahr 2011 Kunst Und Literatur Titel-Nr
ROTES ANTIQUARIAT Katalog Frühjahr 2011 Kunst und Literatur Titel-Nr. 7 Inhaltsverzeichnis KUNST – Dokumentationen, illustrierte Bücher und graphische Folgen 3 Dadaismus, Futurismus und Surrealismus 6 Expressionismus 24 Fotografie 42 Konstruktivismus/ Funktionalismus 45 Sowjetische Propaganda 68 Der Sturm 70 Verismus 71 Einzelblätter 74 LITERATUR 90 EXIL 114 Wir sind jederzeit am Ankauf ganzer Sammlungen und einzelner Publikationen und Graphiken interessiert. Katalogbearbeitung: Friedrich Haufe Kataloggestaltung: Markéta Cramer von Laue Fotografie: Lara Siggel Übersetzungen: Constanze Hager u.a. Orders from the USA: [email protected] Bestellungen bitte an: Rotes Antiquariat und Galerie C. Bartsch Knesebeckstr. 13/14, 10623 Berlin-Charlottenburg Tel. 030-37 59 12 51, Fax 030-31 99 85 51 [email protected] Mitglied im Bankverbindung: Member of Christian Bartsch Postbank Berlin, Konto-Nr. 777 844 102 Deutsche Bank, Konto-Nr. 135 687 200 Für unsere Schweizer Kunden Christian Bartsch, Konto 91-392193-5, PostFinance Schweiz Steuer-Nummer 34/217/58303 USt-ID 196559745 Katalog Frühjahr 2011 Kunst und Literatur Seite 5 Kunst I KUNST DOKUMENTATIONEN,ILLUSTRIERTE BÜCHER UND GRAPHISCHE FOLGEN 1. Abstraction, Création, Art non figurativ. 1932. Heft 1 (von 5). (Paris). 1932. 48 S. Mit zahlr. Abb. 4°, Orig.-Umschlag. (Bestell-Nr. KNE10061) 800,- € Original-Ausgabe. - "Abstraction-Création" vereinte die beiden Gruppen "Cercle et Carré" und die aus ihr hervorgegangene, vor allem durch van Doesburg initiierte Abspaltung "Art concret"; die Zusammenfügung -

Der Landschaftsmaler Edmund Steppes (1873-1968)
1 DER LANDSCHAFTSMALER EDMUND STEPPES (1873-1968) UND SEINE VISION EINER „DEUTSCHEN MALEREI“ VON DER HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE BRAUNSCHWEIG ZUR ERLANGUNG DES GRADES EINES DOKTORS DER PHILOSOPHIE - DR. PHIL. - genehmigte Dissertation von Andreas Zoller geboren am 26. Juli 1957 in Stuttgart Braunschweig 1999 2 Erst-Referent: Professor Dr. Johannes Zahlten Korreferenten: Professor Dr. Heinrich Dilly Professor Dr. Heino R. Möller Tag der mündlichen Prüfung: 24.08.1999 3 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 EINLEITUNG 1.1 Annäherung...............................................6 1.2 Forschungslage.......................................... 8 1.3 Quellenlage.............................................15 1.4 Vorgehensweise..........................................17 2 ZUM LEBEN VON EDMUND STEPPES 2.1 Kindheit und Jugend (1873-1891) 2.1.1 Lebensstationen..................................21 2.1.2 Jugendjahre in Selbstzeugnissen..................23 2.1.3 Familie Steppes..................................27 2.1.4 Familie von Schleich.............................30 2.1.5 Christine von Stransky und die Spätromantik.....................................32 2.1.6 Resümee..........................................35 2.2 Lehr- und Wanderjahre (1891-1901) 2.2.1 Lebensstationen..................................36 2.2.2 Bezugspersonen...................................39 2.2.3 Der Lugo-Kreis und Edmund Steppes................41 2.2.4 Erste künstlerische Erfolge......................49 2.2.5 Im Rückblick.....................................53 2.2.6 Zeitzeugnisse....................................55 -

Wilhelm Arntz Papers, 1898-1986
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt8d5nf2w0 No online items INVENTORY OF THE WILHELM ARNTZ PAPERS, 1898-1986 Finding aid prepared by Isabella Zuralski. INVENTORY OF THE WILHELM 840001 1 ARNTZ PAPERS, 1898-1986 Descriptive Summary Title: Wilhelm Arntz papers Date (inclusive): 1898-1986 Number: 840001 Creator/Collector: Arntz, Wilhelm F. Physical Description: 159.0 linear feet(294 boxes) Repository: The Getty Research Institute Special Collections 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles, California, 90049-1688 (310) 440-7390 Abstract: Comprehensive research collection on twentieth century art, especially German Expressionism, compiled by the art expert Wilhelm Friedrich Arntz. A vast portion of the collection consists of research files on individual artists. Of particular interest are files concerning the so-called degenerate art campaign by the Nazis and the recovery of confiscated artwork after the World war II. Extensive material documents Arntz's professional activities. Request Materials: Request access to the physical materials described in this inventory through the catalog record for this collection. Click here for the access policy . Language: Collection material is in German Biographical/Historical Note Wilhelm Friedrich Arntz (1903-1985) was a German lawyer, art expert and independent researcher of twentieth century art. He was also one of the early collectors of German Expressionism. Parallel to collecting artworks, he aquired publications on 20th century art and compiled a wealth of archival material, including newspaper clippings, correspondence of artists, art historians and dealers, and ephemeral items such as invitations to exhibition openings. Trained as a lawyer, Arntz began his professional career as political editor for the newspaper Frankurter Generalanzeiger, but he lost his job in 1933 after the Nazis came to power. -

Wilhelm Arntz Papers Date (Inclusive): 1898-1986 Number: 840001 Creator/Collector: Arntz, Wilhelm F
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt8d5nf2w0 No online items Finding aid for the Wilhem Arntz papers, 1898-1986 Isabella Zuralski. Finding aid for the Wilhem Arntz 840001 1 papers, 1898-1986 Descriptive Summary Title: Wilhelm Arntz papers Date (inclusive): 1898-1986 Number: 840001 Creator/Collector: Arntz, Wilhelm F. Physical Description: 159 Linear Feet(295 boxes) Repository: The Getty Research Institute Special Collections 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles 90049-1688 [email protected] URL: http://hdl.handle.net/10020/askref (310) 440-7390 Abstract: Comprehensive research collection on twentieth century art, especially German Expressionism, compiled by the art expert Wilhelm Friedrich Arntz. A vast portion of the collection consists of research files on individual artists. Of particular interest are files concerning the so-called degenerate art campaign by the Nazis and the recovery of confiscated artwork after World War II. Extensive material documents Arntz's professional activities. Request Materials: Request access to the physical materials described in this inventory through the catalog record for this collection. Click here for the access policy . Language: Collection material is in German Biographical/Historical Note Wilhelm Friedrich Arntz (1903-1985) was a German lawyer, art expert and independent researcher of twentieth century art. He was also one of the early collectors of German Expressionism. Parallel to collecting artworks, he aquired publications on 20th century art and compiled a wealth of archival material, including newspaper clippings, correspondence of artists, art historians and dealers, and ephemeral items such as invitations to exhibition openings. Trained as a lawyer, Arntz began his professional career as political editor for the newspaper Frankurter Generalanzeiger, but he lost his job in 1933 after the Nazis came to power. -

Klh2016web.Pdf
UmKatH2016_Layout 3 31.10.2016 07:59 Seite 4 Katalogbearbeitung: Ricarda Lindner Kataloggestaltung und Fotografie: Markéta Cramer von Laue Bestellungen bitte an Rotes Antiquariat und Galerie C. Bartsch Knesebeckstr. 13/14, 10623 Berlin-Charlottenburg Tel. 030-37 59 12 51, Fax 030-31 99 85 51 [email protected] Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.rotes-antiquariat.de. Mitglied im Bankverbindung Member of Christian Bartsch Postbank Berlin: IBAN DE88100100100777844102 Deutsche Bank: IBAN DE12100700240135687200 Für unsere Schweizer Kunden Christian Bartsch, Konto 91-392193-5, PostFinance Schweiz Steuer-Nummer 34/217/58303 USt-ID 196559745 Katalog Herbst 2016 Kunst – Literatur – Autographen Seite 2 1. ABC. Beiträge zum Bauen Serie 2, No. 2. Redaktion: Hannes Meyer, Basel. Basel. [1926.] 8 S. Mit zahlr. fotogr. Abb. u .a. von Arbeiten Baumeisters, Dexels, Kassaks, Lissitzkys, Mondrians, Nerlingers, Vantongerloos. Folio, Orig.-Karton. - Widmungs exem - plar von Hannes Meyer an Walter Dexel. (Bestell-Nr. KNE27766) 1.000 € Belegexemplar mit dem handschriftlichen Vermerk auf der Umschlaginnenseite: „Walter Dexel zugeeignet, HM. 26“; Anlass war vermutlich die Abbildung des Hinterglasbildes Komposition IV von 1925, welche Moholy-Nagys Beitrag „Ismus oder Kunst“ beigestellt wurde (vgl. Wöbkemeier 288). - Es erschienen lediglich acht Ausgaben der Zeitschrift. - Die Reihe wurde in den Jahren von 1924 bis 1928 publiziert. - Als der Architekturverband Asnova gegründet wurde, befand sich Lissitzky auf seiner von der USSR offiziell geförderten Grand Tour durch Europa, auf welcher er für den russischen Konstruktivismus warb. Es war ihm in dieser Zeit möglich, ein großes Netzwerk zu knüpfen und verschiedene Künstler für seine Sache einzunehmen. Die Förderung und Gründung von Zeitschriften, welche sich untereinander mit Beiträgen und Hinweisen quer über den Konti - nent unterstützten, war dafür von zentraler Bedeutung. -

KUNSTHANDEL WIDDER Perspektiven
KUNSTHANDEL WIDDER Perspektiven Kunsthandel Widder GmbH Mag. Roland Widder Johannesgasse 9 –13 A -1010 Wien Tel. und Fax: 01 - 512 45 69 Mobil: 0676 - 629 81 21 [email protected] www.kunsthandelwidder.com Öffnungszeiten: Di–Fr: 11:00 –18:00, Sa: 10:00 –15:00 Texte: Mag. Roland Widder, Dr. Monika Mlekusch, Karoline Eberhardt, MA Fotograf: Georg Aufreiter Grafik: Alexandra Evic, BA, Mag. Isabella Kohlhuber Druck: Druckerei Janetschek GmbH, Heidenreichstein Wien, 2016 Alle abgebildeten Arbeiten sind verkäuflich. Der Kunsthandel Widder garantiert für die Echtheit der Bilder. ISBN 978-3-99028-611-1 VORWORT Liebe Kunden, Sammler und Kunstfreunde! Mit dem vorliegenden Verkaufskatalog halten Sie unsere 39. Publikation Bedürfnisse über die Dekoration der eigenen vier Wände bis hin zur in Händen. Der Schwerpunkt liegt wie gewohnt in der Präsentation von Geldanlage, gibt es sicherlich viele Beweggründe. österreichischer Kunst der Zwischenkriegszeit. Wie immer haben wir uns Die Kunst und Ihr Kauf waren immer schon mit Kapital verbunden bemüht, sammlungswürdige Kunstwerke anzubieten, Bilder die sich aus aber in den letzten Jahren wurde die Kunst wahrscheinlich noch mehr der Masse des Angebotes am österreichischen Kunstmarkt abheben. Ei- als Vermögensanlage betrachtet als je zuvor. Ob dies lohnender ist als nige davon sind keine „leichte Kost“. Nicht jeder will vermutlich das blu- andere Investments, kann Ihnen nur Ihr Bankberater oder die kumäi- tige Geschäft der Katzentöter von Otto Rudolf Schatz täglich vor Augen sche Sibylle von Alfred Kubin verraten. Neben den gewinn- und pres- haben, die ausgemergelten Gestalten des Schlächterwagens von Albert tigeträchtigen Aspekten steckt in jedem Kunstwerk aber noch etwas Birkle vorbeiziehen sehen, mit Wilhelm Thönys Aquarell an die Gefahr ei- Anderes. -
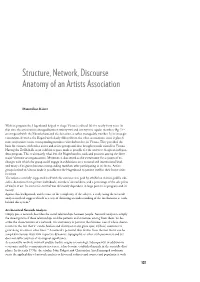
Structure, Network, Discourse Anatomy of an Artists Association
Structure, Network, Discourse Anatomy of an Artists Association Maximilian Kaiser With its program the Hagenbund helped to shape Vienna’s cultural life for nearly forty years. In that time the artists union averaged between twenty-two and seventy-one regular members (fig. 1) – as compared with the Künstlerhaus and the Secession, a rather manageable number. In its strategic orientation, however, the Hagenbund clearly differed from the other associations, since it placed more importance on its corresponding members who did not live in Vienna. They provided the basis for contacts with other artists and artists groups and thus brought outside stimuli to Vienna. Having the Zedlitzhalle as an exhibition space made it possible for the union to design an indepen- dent program. This is ultimately what lent the Hagenbund its rank and position among the three major Viennese art organizations. Moreover, it also served as the cornerstone for a system of ex- changes with which the group could engage in exhibitions on a national and international level, and many of its guests became corresponding members after participating in its shows. Artists groups invited to Vienna made it possible for the Hagenbund to present itself in their home cities in return. The union essentially supported itself with the entrance fees paid by exhibition visitors, public sub- sidies, donations from private individuals, members’ annual dues, and a percentage of the sale prices of works of art. Its economic survival was ultimately dependent in large part on its program and its variety. Against this background, and because of the complexity of the subject, a study using the network analysis method suggested itself as a way of obtaining an understanding of the mechanisms at work behind this system.1 Art-historical Network Analysis Simply put, a network describes the social relationships between people. -

Aanwinsten Van Anet — Periode 2013/12 University of Chicago Press, 1964
Algemeen (incl. Kunst en varia). The world of witches / Julio Carao Baroja. — Chicago, Ill. : Aanwinsten van Anet — Periode 2013/12 University of Chicago Press, 1964. — 313 p. : ill. — (The nature of human society series ; 1964: 1) [1]Algemeen (incl. Kunst en varia). Aanwinsten van Anet bmp EHC: 780364 Algemeen en varia The significance of borders : why representative government and the rule of law require nation states / Thierry Baudet. — 100 jaar Antwerpse stadstrommelaars, 1898–1998 / [edit.] Jack Leiden : Brill, 2012. — 271 p. — ISBN 978–90–04–22808–5 ; Verstappen. — Antwerpen : Grafisch Centrum, 1998. — 96 p. : ISBN 978–90–04–22813–9 ; ISBN 978–90–04–22812–2 ill. EHC: 780441 MAS: HB 78 AP–KC: UM–MG–VLAA-verstap-1 The library of James Sutherland : as purchased by the Faculty EHC: 604455 [C0–141 a] of Advocates, Edinburgh in 1705 and 1707 / Robert L. C0 Betteridge. — Edinburgh : Merchiston, 2013. — 91 p. : ill. — SA: 105#3542 ISBN 978–0–9566136–0–8 MPM: BM 41414 UA–CST: MAG–OW–BB 488 MPM: BM 35596 Kunst als publiek goed : een pleidooi voor de culturele dimensie EHC: 780373 van een vrije samenleving / Thije Adams. — Amsterdam : Van Gennep, 2013. — 47 p. — ISBN 978–94–6164–247–9 Books and manuscripts on old medicine, alchemy, witchcraft, KdG–ABK: 700.7 ADAM pharmacy, cookery, tobacco (arranges chronologically), also KMSKA: MONO–BA 3618 portraits ans autographs of eminent physicians, etc. — London : Maggs, 1922. — 156 p. : ill. — (Catalogue ; 426) Goed bestuur en toezicht in de cultuursector : de 9 principes / EHC: 781522 Erik Akkermans. — Amsterdam : Cultuur-Ondernemen, 2013. — 79 p. -

Diplomarbeit Katleen Luger
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Studien zur esoterischen Dimension in Leben und Werk von Alfred Kubin“ Verfasserin Katleen Jasmin Luger, Bakk. phil. angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im August 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Teja Bach ...für meine Sonne, meine Sterne... Meinem Vater, der mir gezeigt hat, wie eine Einheit von Religion und Wissenschaft praktisch gelebt werden kann und für meine Mutter, die stets alles verbindende Einheit in meinem Leben. Und für meinen Khal, mögen deine Lieder stets im Wind erklingen… In innigem Dank für den fortwährenden Impuls der von euch ausgeht… INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG ........................................................................................................................................................................ 9 GEISTESGESCHICHTLICHER KONTEXT ............................................................................................................. 13 VOM MYTHOS ZUM LOGOS UND ZURÜCK ............................................................................................................................ 14 VON DER REMYTHOLOGISIERUNG ZUR ESOTERIK ......................................................................................................... 17 SYNTHETISCHES ERWACHEN IN DER KUNST DER MODERNE .................................................................................. 21 DIE EINHEIT DES LEBENDIGEN ............................................................................................................................