Der Landschaftsmaler Edmund Steppes (1873-1968)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exposition 8 Novembre 2016 12 Février 2017 62, Rue Des
EXPOSITION 8 NOVEMBRE 2016 12 FÉVRIER 2017 62, RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS CHASSENATURE.ORG 3 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 4 ÉDITO 10 ENTRETIEN AVEC GEORG BASELITZ 14 PARCOURS DE L’EXPOSITION 16 BIOGRAPHIES CHOISIES 18 CATALOGUE CI-DESSUS COUVERTURE DE L’EXPOSITION Richard Friese En haut Combat de cerfs, 1906, Ferdinand von Rayski 19 PARTENAIRES huile sur toile, 100 x 170 cm Halte de chasse dans la forêt de DE L’EXPOSITION SOMMAIRE Letzlingen, Jagdschloss Wermsdorf, 1859, huile sur toile, Letzlingen, Stitftung Dome 114 x 163 cm, Paris, musée de la 20 AUTOUR und Schlösser Chasse et de la Nature DE L’EXPOSITION in Sachsen-Anhalt Georg Baselitz 22 VISUELS DISPONIBLES En bas POUR LA PRESSE De Wermsdorf à Ekely (Remix), 2006, huile sur toile, 24 LE MUSÉE DE LA CHASSE 300 x 250 cm, collection ET DE LA NATURE particulière 25 INFORMATIONS PRATIQUES 2 MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE SCÈNES DE CHASSE EN ALLEMAGNE. RAYSKI / BASELITZ 3 La nature n’est-elle pas la même de part et d’autre du Rhin ? Du moins, SCÈNES DE CHASSE à en juger d’après les représentations artistiques, l’image que Français EN ALLEMAGNE, et Allemands s’en font diffère nettement. Les forêts sont-elles plus mysté- RAYSKI / BASELITZ rieuses en Allemagne, les cerfs plus imposants et leur territoire plus EXPOSITION sauvage ? En tout cas, les pratiques de chasse et la place du chasseur dans 8 NOVEMBRE 2016 - ces sociétés ne sont pas les mêmes. 12 FÉVRIER 2017 À travers un panorama constitué d’œuvres emblématiques (de Kröner, Leibl, Fohr, Liebermann…) provenant de divers musées allemands et suisse, et cou- vrant la période 1830-1914, l’exposition met en évidence les spécificités ger- maniques dans la manière de représenter la chasse. -
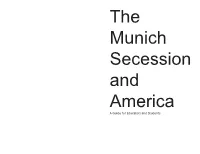
A Guide for Educators and Students TABLE of CONTENTS
The Munich Secession and America A Guide for Educators and Students TABLE OF CONTENTS FOR EDUCATORS GETTING STARTED 3 ABOUT THE FRYE 3 THE MUNICH SECESSION AND AMERICA 4 FOR STUDENTS WELCOME! 5 EXPERIENCING ART AT THE FRYE 5 A LITTLE CONTEXT 6 MAJOR THEMES 8 SELECTED WORKS AND IN-GALLERY DISCUSSION QUESTIONS The Prisoner 9 Picture Book 1 10 Dutch Courtyard 11 Calm before the Storm 12 The Dancer (Tänzerin) Baladine Klossowska 13 The Botanists 14 The Munich Secession and America January 24–April 12, 2009 SKETCH IT! 15 A Guide for Educators and Students BACK AT SCHOOL 15 The Munich Secession and America is organized by the Frye in GLOSSARY 16 collaboration with the Museum Villa Stuck, Munich, and is curated by Frye Foundation Scholar and Director Emerita of the Museum Villa Stuck, Jo-Anne Birnie Danzker. This self-guide was created by Deborah Sepulvida, the Frye’s manager of student and teacher programs, and teaching artist Chelsea Green. FOR EDUCATORS GETTING STARTED This guide includes a variety of materials designed to help educators and students prepare for their visit to the exhibition The Munich Secession and America, which is on view at the Frye Art Museum, January 24–April 12, 2009. Materials include resources and activities for use before, during, and after visits. The goal of this guide is to challenge students to think critically about what they see and to engage in the process of experiencing and discussing art. It is intended to facilitate students’ personal discoveries about art and is aimed at strengthening the skills that allow students to view art independently. -

Hitler's Germania: Propaganda Writ in Stone
Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2017 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2017 Hitler's Germania: Propaganda Writ in Stone Aaron Mumford Boehlert Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017 Part of the Architectural History and Criticism Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Boehlert, Aaron Mumford, "Hitler's Germania: Propaganda Writ in Stone" (2017). Senior Projects Spring 2017. 136. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017/136 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. Hitler’s Germania: Propaganda Writ in Stone Senior Project submitted to the Division of Arts of Bard College By Aaron Boehlert Annandale-on-Hudson, NY 2017 A. Boehlert 2 Acknowledgments This project would not have been possible without the infinite patience, support, and guidance of my advisor, Olga Touloumi, truly a force to be reckoned with in the best possible way. We’ve had laughs, fights, and some of the most incredible moments of collaboration, and I can’t imagine having spent this year working with anyone else. -

Ut Pictora Poesis Hermann Hesse As a Poet and Painter
© HHP & C.I.Schneider, 1998 Posted 5/22/98 GG Ut Pictora Poesis Hermann Hesse as a Poet and Painter by Christian Immo Schneider Central Washington University Ellensburg, WA, U.S.A. Hermann Hesse stands in the international tradition of writers who are capable of expressing themselves in several arts. To be sure, he became famous first of all for his lyrical poetry and prose. How- ever, his thought and language is thoroughly permeated from his ear- liest to his last works with a profound sense of music. Great art- ists possess the specific gift of shifting their creative power from one to another medium. Therefore, it seems to be quite natural that Hesse, when he had reached a stage in his self-development which ne- cessitated both revitalization and enrichment of the art in which he had thus excelled, turned to painting as a means of the self expres- sion he had not yet experienced. "… one day I discovered an entirely new joy. Suddenly, at the age of forty, I began to paint. Not that I considered myself a painter or intended to become one. But painting is marvelous; it makes you happier and more patient. Af- terwards you do not have black fingers as with writing, but red and blue ones." (I,56) When Hesse began painting around 1917, he stood on the threshold of his most prolific period of creativity. This commenced with Demian and continued for more than a decade with such literary masterpieces as Klein und Wagner, Siddhartha, Kurgast up to Der Steppenwolf and beyond. -

1. Walter B. Douglas Rooster and Chickens, Ca. 1920 1952.038 2
3 22 2 4 21 28 32 1 17 14 10 33 40 8 18 45 19 23 49 29 6 38 24 34 5 43 41 46 51 11 15 36 30 35 25 47 53 7 9 12 13 16 20 26 27 31 37 39 42 44 48 50 52 54 1. Walter B. Douglas 7. Hermann-David Saloman 12. Franz von Defregger 18. Adolf Heinrich Lier 24. Johann Friedrich Voltz 28. Eugéne-Louis Boudin 33. Marie Weber 38. Léon Barillot 44. Charles Soulacroix 50. Emile Van Marcke Rooster and Chickens, ca. 1920 Corrodi The Blonde Bavarian, ca. 1905 Lanscape Near Polling, 1860-70 Cattle on the Shore, ca. 1883 View of the Harbor, Le Havre, Head of a Girl in Fold Costume, Three Cows and a Calf, ca. 1890 Expectation, ca. 1890 In the Marshes, ca. 1880 1952.038 Venice, ca. 1900 1952.034 1952.107 1952.182 1885-90 1870s-1880s 1952.005 1952.158 1952.178 1952.025 1952.010 1952.187 2. Edmund Steppes 13. Ludwig Knaus 19. Friedrich Kaulbach 25. Louis Gabriel Eugéne Isabey 39. William Adolphe Bouguereau 45. Arnold Gorter 51. Nikolai Nikanorovich Dubovskoi The Time of the Cuckoo, 1907 8. Franx-Xaver Hoch Drove of Swine: Evening Effect Portrait of Hanna Ralph, n.d. The Storm, 1850 29. Wilhelm Trüber 34. Henry Raschen The Shepherdess, 1881 Autumn Sun, n.d. Seascape with Figures, 1899 1952.160 Landscape with Church Towers, 1952.085 1952.080 1952.073 Three Fir Trees at Castle Old Man, n.d. 1952.012 1952.056 1952.039 1912 Hemsbach, 1904 1952.139 3. -

Hans Kammler, Hitler's Last Hope, in American Hands
WORKING PAPER 91 Hans Kammler, Hitler’s Last Hope, in American Hands By Frank Döbert and Rainer Karlsch, August 2019 THE COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT WORKING PAPER SERIES Christian F. Ostermann and Charles Kraus, Series Editors This paper is one of a series of Working Papers published by the Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. Established in 1991 by a grant from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Cold War International History Project (CWIHP) disseminates new information and perspectives on the history of the Cold War as it emerges from previously inaccessible sources from all sides of the post-World War II superpower rivalry. Among the activities undertaken by the Project to promote this aim are the Wilson Center's Digital Archive; a periodic Bulletin and other publications to disseminate new findings, views, and activities pertaining to Cold War history; a fellowship program for historians to conduct archival research and study Cold War history in the United States; and international scholarly meetings, conferences, and seminars. The CWIHP Working Paper series provides a speedy publication outlet for researchers who have gained access to newly-available archives and sources related to Cold War history and would like to share their results and analysis with a broad audience of academics, journalists, policymakers, and students. CWIHP especially welcomes submissions which use archival sources from outside of the United States; offer novel interpretations of well-known episodes in Cold War history; explore understudied events, issues, and personalities important to the Cold War; or improve understanding of the Cold War’s legacies and political relevance in the present day. -

Aus Der Ehemaligen Sammlung Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt Sonderauktion 29.10.2015
Cover SCHAEFER RZ 16.02.16 12:06 Seite 1 .. GEMALDE 18. – 20. JAHRHUNDERT AUS DER EHEMALIGEN SAMMLUNG DR. GEORG SCHÄFER, SCHWEINFURT SONDERAUKTION 29.10.2015 NEUMEISTER ALTE KUNST e ´ www.neumeister.com SONDERAUKTION 29.10.2015 .. GEMALDE DES 18.– 20. JAHR- HUNDERTS AUS DER EHEMALIGEN SAMMLUNG .. DR. GEORG SCHAFER, SCHWEINFURT Hinweise für unsere Kunden: Bitte beachten Sie den Künstlerindex ab Seite 187. Sämtliche Werke dieser Auktion wurden von einer externen Provenienzforscherin unter Beratung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (München) sowie dem Artloss Register (London) geprüft. Auf allen Gemälden finden sich rückseitig Inventarklebeetiketten der Sammlung Dr. Georg Schäfer, die in den Katalogtexten nicht gesondert erwähnt werden. Auktion 29.10.2015 Vorbesichtigung 23.– 28. Oktober 2015 Täglich von 14.00 bis 17.00 Uhr Montag Abendöffnung bis 20.00 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung Auktionsbeginn 18.00 Uhr Katalogbearbeitung Dr. Rainer Schuster Verfolgen Sie unsere Auktionen LIVE www.lot-tissimo.com VORWORT „Georg Schäfer war nicht ein Sammler, der sich fern seiner Umwelt entschied, vielmehr sind der Geschmack, die Vorlieben und die Auswahlprinzipien ... aus dieser seiner fränkischen Wirklichkeit heraus zu verstehen.“ Wulf Schadendorf über Dr. Georg Schäfer Liebe Freunde des Kunstauktionshauses NEUMEISTER, die Kunstsammlung, die Dr. Georg Schäfer (1896–1975) 1925 von seinem Vater Geheimrat Georg Schäfer (1861–1925) erbte, war damals bereits bedeutend: Gemälde u.a. von Joseph Wopfner, Hermann Kaulbach, Franz von Defregger, Johann Sperl und Franz von Lenbach, kurz, das Beste, was die Münchner Schule zwischen 1860 und 1900 zu bieten hatte, waren vom Gründer der „Ersten Automatischen Gußstahlkugelfabrik, vormals Friedrich Fischer“ in Schweinfurt zwischen 1900 und 1925 zusammengetragen worden. -

Vogelsang (Hermann Ludolf) Karl Emil
Wacek 380 Wach das Rgt.jubiläum 1896 (200 Jahre „Hoch- ed. F. Anzenberger, 2016, passim (m. B.); KA, WStLA, und Deutschmeister“) schrieb W. die beide Wien; Pfarre Soběslav, CZ. „Deutschmeister-Lieder“, eine musikal. Rgt.- (F. Anzenberger) geschichte; zur Einweihung des Deutsch- meister-Denkmals 1906 in Wien auf dem Wach Aloys, eigentl. Wachlmayr Alois Deutschmeister-Platz entstand sein „Deutsch- Ludwig, Maler, Graphiker und Schriftstel- meister-Denkmal-Marsch“. 1910 unternahm ler. Geb. Lambach (OÖ), 30. 4. 1892; gest. die Kapelle auf Einladung des Großindus- Braunau am Inn (OÖ), 18. 4. 1940; röm.- triellen →Arthur Krupp eine ausgedehnte kath. – Sohn des Gastwirts Anton Wachl- Südamerika-Tournee, woraufhin W. dem mayr und dessen Frau Anna Wachlmayr, Mäzen dieser Reise den „Krupp-Marsch“ geb. Grundner; ab 1917 verheiratet mit widmete. Neben den militär. Verpflichtun- Käthe Käser. – Nach der Bürgerschule ab- gen absolv. die Militärmusik jährl. mehrere solv. W. auf Drängen seiner Familie zu- hundert Auftritte (Unterhaltungskonzerte, nächst eine Lehre als Kaufmann und Tanzveranstaltungen) bei privaten Auftrag- arbeitete ab 1909 kurzfristig in diesem gebern in Wien, teils bis zu vier Termine Beruf. Daneben bemühte er sich jedoch gleichzeitig in geteilten Besetzungen, was konsequent um eine Kunstausbildung. Nach Kapellmeister W., der an den Auftrittsga- mehreren erfolglosen Versuchen in Wien gen beteiligt war, ein beträchtl. Zusatzein- und München ging er 1912 nach Berlin, wo kommen ermöglichte. Während des 1. Welt- er als Schüler von Richard Janthur in das kriegs diente die reguläre Musikkapelle im Umfeld der beginnenden expressionist. Be- Feld. W. blieb jedoch mit den Musikern des wegung kam. 1913 reiste er nach Paris, um „Ersatzbataillons“ die meiste Zeit in Wien künstler. -

Matthias Boeckl Rekonstruktion Einer Verlorenen Kultur
www.doew.at Matthias Boeckl Rekonstruktion einer verlorenen Kultur Aus: Fritz Schwarz-Waldegg. Maler-Reisen durchs Ich und die Welt, hrsg. v. Matthias Boeckl für das Jüdische Museum der Stadt Wien, Wien 2009, S. 15–31 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors Obwohl die so genannte Zwischenkriegszeit unserer Gegenwart näher steht als etwa die Zeit um 1900, ist die detaillierte Rekonstruktion des Wiener Kunst- betriebs von 1918 bis 1938 ein wesentlich schwierigeres Unterfangen als die Historiografie des Wiener Jugendstils. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die 1920er und 1930er Jahre waren jene Ära, in der nach den historischen Entwick- lungsschritten der Toleranz, der Emanzipation und schließlich der Assimilation der Juden Österreichs in vielen gutbürgerlich-jüdischen Familien eine Genera- tion aufgewachsen war, die ausgeprägte künstlerische und intellektuelle Ambi- tionen hegte. Das großteils urbane Umfeld und die betont musische und kultu- relle Bildung, die in vielen jüdischen Familien einen wichtigen Teil der Tradi- tion und Identität bildete, sowie oftmals saturierte wirtschaftliche Verhältnisse, die derlei Betätigungen nun vermehrt ermöglichten, bereicherten das Wiener Kulturleben um eine große Anzahl jüdischer Schriftsteller, Maler, Architekten und Gelehrter. Trotz latenter und später offen antisemitischer Stimmungen etwa an der Universität oder in Künstlerorganisationen wie der Secession und dem 1934 gegründeten Neuen Werkbund, die keine jüdischen Mitglieder aufnah- men, beteiligten sich 1918 bis 1938 mehr jüdische -

Dramatizing Trauma in Resistance to Post-Colonial Hegemonic Culture : a Magic(Al) Realist Reading of Toni Morrison's Beloved
University of Louisville ThinkIR: The University of Louisville's Institutional Repository Electronic Theses and Dissertations 8-2015 Dramatizing trauma in resistance to post-colonial hegemonic culture : a magic(al) realist reading of Toni Morrison's Beloved, Love and Frida Kahlo's selected paintings. FENG Yi, University of Louisville Follow this and additional works at: https://ir.library.louisville.edu/etd Part of the English Language and Literature Commons, and the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Yi,, FENG, "Dramatizing trauma in resistance to post-colonial hegemonic culture : a magic(al) realist reading of Toni Morrison's Beloved, Love and Frida Kahlo's selected paintings." (2015). Electronic Theses and Dissertations. Paper 2241. https://doi.org/10.18297/etd/2241 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by ThinkIR: The nivU ersity of Louisville's Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of ThinkIR: The nivU ersity of Louisville's Institutional Repository. This title appears here courtesy of the author, who has retained all other copyrights. For more information, please contact [email protected]. DRAMATIZING TRAUMA IN RESISTANCE TO POST-COLONIAL HEGEMONIC CULTURE: A MAGIC(AL) REALIST READING OF TONI MORRISON’S BELOVED, LOVE AND FRIDA KAHLO’S SELECTED PAINTINGS By FENG Yi B.A., Heilongjiang University, 2003 M.A., Beijing Foreign Studies University, 2006 A Dissertation Submitted -

Lauren Grace Hamer, BA
Copyright by Lauren Grace Hamer 2009 Im Geist der Gegenwart: The Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger by Lauren Grace Hamer, B.A. Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin August 2009 Im Geist der Gegenwart: The Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger Approved by Supervising Committee: Richard Shiff Linda Henderson Dedicated to Erandi de Silva Acknowledgements The writing of this thesis would not have been possible without the sage advice and unfailing support of my thesis advisor Dr. Richard Shiff and my second reader Dr. Linda Henderson, both of whom encouraged my pursuit of a difficult methodological subject. I would also like to thank Dr. Kimberly Smith of Southwest Texas State University for calling my attention to Fritz Burger's writings and for giving me my first opportunity to work as a translator of art historical material. To Kenneth McKerrow at the University of Toronto, I owe an immeasurable debt for his friendship and for his translation expertise in the editing of the appendix. At the University of Texas I would like to thank Caitlin Haskell, to whom I am profoundly grateful for her conversation and encouragement. Of course I would also like to thank my terrifically smart parents and my three lovely sisters for supporting my academic work for so many years and for tempering their enthusiasm with just enough doubt to keep me motivated. August 2009 v Im Geist der Gegenwart: the Speculative Method of the Art Historian Fritz Burger Lauren Grace Hamer, M.A. -

Retallick (Page 1)
1 Architecture about Architecture/ The wisdom to know the difference? Peter Retallick Key Words: Ethics, Psychology, Philosophy, Third Reich Abstract of the paper In this paper I examine whether “design wisdom” is a prerequisite for self-fulfillment or self-actualization. I refer to various philosophers and I look at the life of Albert Speer. He was an architect in the Third Reich and had a close relationship with Hitler. A combination of flawed personalities made these two a team. Speer brought his design skills to work for National Socialism and in so doing gave them a sort of imprimatur or cachet. There is a brief description of Speer’s journey into the centre of power and the result for him was a twenty-year jail sentence. My thesis is that Speer’s involvement in this is archetypal and lessons can be learned from his experience. He was not a thug, mediocre or incompetent. Submission Part 1 Wisdom is sometimes defined as a wise outlook, plan or course of action, common sense and good judgement. It follows that design wisdom has some functional component connected with the act of designing. In all of these things responsibility is an implicit component. For design practice it could include such a wide range of issues and permutations that a personal design manifesto is endless. The designer is constantly coming into contact with new situations and people, and he or she needs to find a path that satisfies creative desires as well as providing a degree of accountability. Peter Singer offers a definition that I believe is helpful because it brings a plethora of ideas down to something concrete.