Stuttgarter Beiträge Zur Naturkunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pohoria Burda Na Dostupných Historických Mapách Je Aj Cieľom Tohto Príspevku
OCHRANA PRÍRODY NATURE CONSERVATION 27 / 2016 OCHRANA PRÍRODY NATURE CONSERVATION 27 / 2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica Redakčná rada: prof. Dr. Ing. Viliam Pichler doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. Mgr. Michal Adamec RNDr. Ján Kadlečík Ing. Marta Mútňanová RNDr. Katarína Králiková Recenzenti čísla: RNDr. Michal Ambros, PhD. Mgr. Peter Puchala, PhD. Ing. Jerguš Tesák doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. Zostavil: RNDr. Katarína Králiková Jayzková korektúra: Mgr. Olga Majerová Grafická úprava: Ing. Viktória Ihringová Vydala: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica v roku 2016 Vydávané v elektronickej verzii Adresa redakcie: ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/413 66 61, e-mail: [email protected] ISSN: 2453-8183 Uzávierka predkladania príspevkov do nasledujúceho čísla (28): 30.9.2016. 2 \ Ochrana prírody, 27/2016 OCHRANA PRÍRODY INŠTRUKCIE PRE AUTOROV Vedecký časopis je zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. Príspevky sú publikované v slovenskom, príp. českom jazyku s anglickým súhrnom, príp. v anglickom jazyku so slovenským (českým) súhrnom. Členenie príspevku 1) názov príspevku 2) neskrátené meno autora, adresa autora (vrátane adresy elektronickej pošty) 3) názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku 4) úvod, metodika, výsledky, diskusia, záver, literatúra Ilustrácie (obrázky, tabuľky, náčrty, mapky, mapy, grafy, fotografie) • minimálne rozlíšenie 1200 x 800 pixelov, rozlíšenie 300 dpi (digitálna fotografia má väčšinou 72 dpi) • každá ilustrácia bude uložená v samostatnom súbore (jpg, tif, bmp…) • používajte kilometrovú mierku, nie číselnú • mapy vytvorené v ArcView je nutné vyexportovať do formátov tif, jpg,.. -
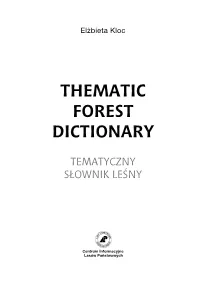
Thematic Forest Dictionary
Elżbieta Kloc THEMATIC FOREST DICTIONARY TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa 2015 © Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa tel. 22 18 55 353 e-mail: [email protected] www.lasy.gov.pl © Elżbieta Kloc Konsultacja merytoryczna: dr inż. Krzysztof Michalec Konsultacja i współautorstwo haseł z zakresu hodowli lasu: dr inż. Maciej Pach Recenzja: dr Ewa Bandura Ilustracje: Bartłomiej Gaczorek Zdjęcia na okładce Paweł Fabijański Korekta Anna Wikło ISBN 978-83-63895-48-8 Projek graficzny i przygotowanie do druku PLUPART Druk i oprawa Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu TABLE OF CONTENTS – SPIS TREÂCI ENGLISH-POLISH THEMATIC FOREST DICTIONARY ANGIELSKO-POLSKI TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY OD AUTORKI ................................................... 9 WYKAZ OBJAŚNIEŃ I SKRÓTÓW ................................... 10 PLANTS – ROŚLINY ............................................ 13 1. Taxa – jednostki taksonomiczne .................................. 14 2. Plant classification – klasyfikacja roślin ............................. 14 3. List of forest plant species – lista gatunków roślin leśnych .............. 17 4. List of tree and shrub species – lista gatunków drzew i krzewów ......... 19 5. Plant morphology – morfologia roślin .............................. 22 6. Plant cells, tissues and their compounds – komórki i tkanki roślinne oraz ich części składowe .................. 30 7. Plant habitat preferences – preferencje środowiskowe roślin -

Phylogenetic Relationships and Distribution of the Rhizotrogini (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae) in the West Mediterranean
Graellsia, 59(2-3): 443-455 (2003) PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS AND DISTRIBUTION OF THE RHIZOTROGINI (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, MELOLONTHINAE) IN THE WEST MEDITERRANEAN Mª. M. Coca-Abia* ABSTRACT In this paper, the West Mediterranean genera of Rhizotrogini are reviewed. Two kinds of character sets are discussed: those relative to the external morphology of the adult and those of the male and female genitalia. Genera Amadotrogus Reitter, 1902; Amphimallina Reitter, 1905; Amphimallon Berthold, 1827; Geotrogus Guérin-Méneville, 1842; Monotropus Erichson, 1847; Pseudoapeterogyna Escalera, 1914 and Rhizotrogus Berthold, 1827 are analysed: to demonstrate the monophyly of this group of genera; to asses the realtionships of these taxa; to test species transferred from Rhizotrogus to Geotrogus and Monotropus, and to describe external morphological and male and female genitalic cha- racters which distinguish each genus. Phylogenetic analysis leads to the conclusion that this group of genera is monophyletic. However, nothing can be said about internal relationships of the genera, which remain in a basal polytomy. Some of the species tranferred from Rhizotrogus are considered to be a new genus Firminus. The genera Amphimallina and Pseudoapterogyna are synonymized with Amphimallon and Geotrogus respectively. Key words: Taxonomy, nomenclature, review, Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae, Rhizotrogini, Amadotrogus, Amphimallon, Rhizotrogus, Geotrogus, Pseudoapterogyna, Firminus, Mediterranean basin. RESUMEN Relaciones filogenéticas y distribución de -

Metarhizium Anisopliae
Biological control of the invasive maize pest Diabrotica virgifera virgifera by the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. nat. techn. ausgeführt am Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, Departement für Wald- und Bodenwissenschaften eingereicht an der Universiät für Bodenkultur Wien von Dipl. Ing. Christina Pilz Erstgutachter: Ao. Univ. Prof. Dr. phil. Rudolf Wegensteiner Zweitgutachter: Dr. Ing. - AgrarETH Siegfried Keller Wien, September 2008 Preface “........Wir träumen von phantastischen außerirdischen Welten. Millionen Lichtjahre entfernt. Dabei haben wir noch nicht einmal begonnen, die Welt zu entdecken, die sich direkt vor unseren Füßen ausbreitet: Galaxien des Kleinen, ein Mikrokosmos in Zentimetermaßstab, in dem Grasbüschel zu undurchdringlichen Wäldern, Tautropfen zu riesigen Ballons werden, ein Tag zu einem halben Leben. Die Welt der Insekten.........” (aus: Claude Nuridsany & Marie Perennou (1997): “Mikrokosmos - Das Volk in den Gräsern”, Scherz Verlag. This thesis has been submitted to the University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Boku, Vienna; in partial fulfilment of the requirements for the degree of Dr. nat. techn. The thesis consists of an introductory chapter and additional five scientific papers. The introductory chapter gives background information on the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae, the maize pest insect Diabrotica virgifera virgifera as well as on control options and the step-by-step approach followed in this thesis. The scientific papers represent the work of the PhD during three years, of partial laboratory work at the research station ART Agroscope Reckenholz-Tänikon, Switzerland, and fieldwork in maize fields in Hodmezòvasarhely, Hungary, during summer seasons. Paper 1 was published in the journal “BioControl”, paper 2 in the journal “Journal of Applied Entomology”, and paper 3 and paper 4 have not yet been submitted for publications, while paper 5 has been submitted to the journal “BioControl”. -

Ecological Consequences Artificial Night Lighting
Rich Longcore ECOLOGY Advance praise for Ecological Consequences of Artificial Night Lighting E c Ecological Consequences “As a kid, I spent many a night under streetlamps looking for toads and bugs, or o l simply watching the bats. The two dozen experts who wrote this text still do. This o of isis aa definitive,definitive, readable,readable, comprehensivecomprehensive reviewreview ofof howhow artificialartificial nightnight lightinglighting affectsaffects g animals and plants. The reader learns about possible and definite effects of i animals and plants. The reader learns about possible and definite effects of c Artificial Night Lighting photopollution, illustrated with important examples of how to mitigate these effects a on species ranging from sea turtles to moths. Each section is introduced by a l delightful vignette that sends you rushing back to your own nighttime adventures, C be they chasing fireflies or grabbing frogs.” o n —JOHN M. MARZLUFF,, DenmanDenman ProfessorProfessor ofof SustainableSustainable ResourceResource Sciences,Sciences, s College of Forest Resources, University of Washington e q “This book is that rare phenomenon, one that provides us with a unique, relevant, and u seminal contribution to our knowledge, examining the physiological, behavioral, e n reproductive, community,community, and other ecological effectseffects of light pollution. It will c enhance our ability to mitigate this ominous envirenvironmentalonmental alteration thrthroughough mormoree e conscious and effective design of the built environment.” -

Case Study from the Zsolca Mounds (Ne Hungary)
18/2 • 2019, 189–200 DOI: 10.2478/hacq-2019-0009 Iron age burial mounds as refugia for steppe specialist plants and invertebrates – case study from the Zsolca mounds (ne hungary) Csaba Albert Tóth1, Balázs Deák2, István nyilas3, László Bertalan1, , Orsolya Valkó4 * , Tibor József novák5 Key words: kurgan, prehistoric Abstract mound, loess steppe, biodiversity, Prehistoric mounds of the Great Hungarian Plain often function as refuges for relic cropland matrix, microhabitat, loess steppe vegetation and their associated fauna. The Zsolca mounds are a typical slope, ground-dwelling invertebrates. example of kurgans acting as refuges, and even though they are surrounded by agri- cultural land, they harbour a species rich loess grassland with an area of 0.8 ha. With Ključne besede: kurgan, a detailed field survey of their geomorphology, soil, flora and fauna, we describe the predzgodovinske gomile, stepa na most relevant attributes of the mounds regarding their maintenance as valuable grass- lesu, biotska pestrost, kmetisjki land habitats. We recorded 104 vascular plant species, including seven species that matriks, mikrohabitat, pobočje, talni are protected in Hungary and two species (Echium russicum and Pulsatilla grandis) nevretenčarji. listed in the IUCN Red List and the Habitats Directive. The negative effect of the surrounding cropland was detectable in a three-metre wide zone next to the mound edge, where the naturalness of the vegetation was lower, and the frequency of weeds, ruderal species and crop plants was higher than in the central zone. The ancient man-made mounds harboured dry and warm habitats on the southern slope, while the northern slopes had higher biodiversity, due to the balanced water supplies. -

(Insects). Note 1
Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii úi comunicări. ùtiinĠele Naturii. Tom. 29, No. 2/2013 ISSN 1454-6914 CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF RESEARCH ON BEETLE PARASITE FAUNA (INSECTS). NOTE 1. LILA Gima Abstract. The paper presents a synthesis of the data on the parasite fauna of longhorn beetles taken from papers published between 1959 and 2009 ((CONSTANTINEANU, 1959; PANIN &SĂVULESCU, 1961; BALTHASAR, 1963; TUDOR, 1969; PISICĂ, 2001; PISICĂ &POPESCU, 2009) and abroad, between 1945-1966 (GYORFI, 1945-1947; BALACHOWSKY, 1962-1963; HURPIN 1962 - for parasites and parasitoids species found in species of beetles and GRASSE 1953 and KUDO 1966 - to protozoa (Protozoa, sporozoite Gregarinomorpha) parasitic on beetles). In conclusion, beetles are host species for bacteria, protozoa, fungi, nematodes, mites, Hymenoptera and Diptera. To complete data about parasite fauna beetles still will consult other papers from country and from abroad. Keywords: parasites, parasitoids, beetle-host. Rezumat. ContribuĠii la cunoaúterea cercetărilor privind parazitofauna la coleoptere (Insecta). Lucrarea prezintă o sinteză a datelor referitoare la parazitofauna unor specii de coleoptere preluate din lucrări publicate pentru România între 1959-2009 (CONSTANTINEANU, 1959; PANIN &SĂVULESCU, 1961; BALTHASAR, 1963; TUDOR, 1969; PISICĂ, 2001; PISICĂ &POPESCU, 2009) úi pentru străinătate între 1945-1966 (GYORFI, 1945-1947; BALACHOWSKY, 1962-1963; HURPIN 1962 pentru paraziĠi úi parazitoizi găsiĠi la specii de coleoptere precum úi GRASSE 1953 úi KUDO 1966, pentru protozoare parazite la diverse specii de coleoptere). În concluzie, gândaci sunt specii gazdă pentru bacterii, protozoare, ciuperci, nematode, acarieni, hymenoptere úi diptere. Pentru a avea date cât mai complete despre parazitofauna la coleoptere, în continuare vom consulta úi alte lucrări de specialitate din Ġarӽ cât úi din strӽinătate. -

(Other Than Moths) Attracted to Light
Insects (other than moths) attracted to light Prepared by Martin Harvey for BENHS workshop on 9 December 2017 Although light-traps go hand-in-hand with catching and recording moths, a surprisingly wide range of other insects can be attracted to light and appear in light-traps on a regular or occasional basis. The lists below show insects recorded from light-traps of various kinds, mostly from southern central England but with some additions from elsewhere in Britain, and based on my records from the early 1990s to date. Nearly all are my own records, plus a few of species that I have identified for other moth recorders. The dataset includes 2,446 records of 615 species. (See the final page of this document for a comparison with another list from Andy Musgrove.) This isn’t a rigorous survey: it represents those species that I have identified and recorded in a fairly ad hoc way over the years. I record insects in light-traps fairly regularly, but there are of course biases based on my taxonomic interests and abilities. Some groups that come to light regularly are not well-represented on this list, e.g. chironomid midges are missing despite their frequent abundance in light traps, Dung beetle Aphodius rufipes there are few parasitic wasps, and some other groups such as muscid © Udo Schmidt flies and water bugs are also under-represented. It’s possible there are errors in this list, e.g. where light-trapping has been erroneously recorded as a method for species found by day. I’ve removed the errors that I’ve found, but I might not yet have found all of them. -

Field Pests - in Temperate Zone of Europe - Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet
Module of Applied Entomology Field pests - in temperate zone of Europe - Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet AZ ELŐADÁS LETÖLTHETŐ: - Main topics •Polyphagous field pests •Wheat pests •Corn pests •Sunflower pests Main topics •Rapeseed pests •Alfalfa and pea pests •Potato pests •Rice pests I. Polyphagous field pests Polyphagous field pests • PHYTOPHAGY: • MONOPHAGOUS SPECIES: • Feed on only one plant taxon • OLIGOPHAGOUS SPECIES: Feed on a few plant taxa (for example: one plant-family) • POLYPHAGOUS SPECIES (generalist): Feed on many plant taxa TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 5 Polyphagous field pests • POLYPHAGOUS PESTS: • Cockchafers’ (Melolonthidae) larvae (grubs) • Click beetles’ (Elateridae) larvae (wireworms) • Noctuid moths’ (Noctuidae) larvae (caterpillars) • Rodents (common vole, gopher, hamster) • Games (rabbit, roe-deer, red-deer, wild boar) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 6 Polyphagous field pests • COCKCHAFERS: • 12 species living in Hungary • The most importants are the followings: 1. Common cockchafer (Melolontha melolontha) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 7 Polyphagous field pests 2. Forest cockchafer (Melolontha hippocastani) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 8 Polyphagous field pests 3. April beetle (Rhizotrogus aequinoctialis) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 9 Polyphagous field pests 4. Summer chafer (Amphimallon solstitiale) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 10 Polyphagous field pests 5. June beetle (Polyphylla fullo) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 11 Polyphagous field pests 6. Vine chafer (Anomala vitis) TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 12 Polyphagous field pests 7. -

Coleoptera) Deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic*
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 30.vi.2010 Volume 50(1), pp. 279–320 ISSN 0374-1036 Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic* Scarabaeidae: Dynamopodinae, Dynastinae, Melolonthinae and Rutelinae Aleš BEZDĚK1) and Jiří HÁJEK2) 1) Biology Centre ASCR, Institute of Entomology, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, Czech Republic; e-mail: [email protected] 2) Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: [email protected] Abstract. Type specimens from the collection of beetles (Coleoptera) deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, are currently being catalogued. This second part of the catalogue dealing with the Scarabaeoidea presents precise information on species-group types of the following scarabaeid subfamilies: two taxa of Dynamopodinae, 10 taxa of Dynastinae, 109 taxa of Melolonthinae and 28 taxa of Rutelinae. Key words. Catalogue, type specimens, National Museum, Scarabaeidae, Dyna- mopodinae, Dynastinae, Melolonthinae, Rutelinae Introduction This work represents a continuation of the cataloguing of type specimens of beetles (Cole- optera) deposited in the collection of the National Museum, Prague, Czech Republic (NMP; NMPC when referring to the collection) began by BEZDĚK & HÁJEK (2009). The second part deals with four pleurostict subfamilies of the family Scarabaeidae. Along with this paper, a database of types including photos of most types and a copy of their original description is available on request. As in the previous part, we feel that it is important to present a brief information about the most important collections mentioned in this catalogue; see also BEZDĚK & HÁJEK (2009). -

Biosystems Diversity · May 2020 DOI: 10.15421/012024
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/343342452 Applying plant disturbance indicators to reveal the hemeroby of soil macrofauna species Article in Biosystems Diversity · May 2020 DOI: 10.15421/012024 CITATIONS READS 2 111 5 authors, including: Olexander Zhukov Melitopol State Pedagogical University 263 PUBLICATIONS 594 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Review of applied software for monitoring data processing View project АДАПТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЯХ View project All content following this page was uploaded by Olexander Zhukov on 03 August 2020. The user has requested enhancement of the downloaded file. ISSN 2519-8513 (Print) Biosystems ISSN 2520-2529 (Online) Biosyst. Divers., 2020, 28(2), 181–194 Diversity doi: 10.15421/012024 Applying plant disturbance indicators to reveal the hemeroby of soil macrofauna species N. V. Yorkina*, S. M. Podorozhniy*, L. G. Velcheva*, Y. V. Honcharenko**, O. V. Zhukov* *Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine **H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine Article info Yorkina, N. V., Podorozhniy, S. M., Velcheva, L. G., Honcharenko, Y. V., & Zhukov, O. V. (2020). Applying plant disturbance Received 03.05.2020 indicators to reveal the hemeroby of soil macrofauna species. Biosystems Diversity, 28(2), 181–194. doi:10.15421/012024 Received in revised form 27.05.2020 Hemeroby is an integrated indicator for measuring human impacts on environmental systems. Hemeroby has a complex nature and Accepted 28.05.2020 a variety of mechanisms to affect ecosystems. -

Functional and Spatial Structure of the Urbotechnozem Mesopedobiont Community
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Biosystems Diversity (E-Journal - Dnipro National University) Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, ekologìâ Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24(2), 473–483. doi:10.15421/011664 ISSN 2310-0842 print ISSN 2312-301X online www.ecology.dp.ua UDC 574.21+574.476 Functional and spatial structure of the urbotechnozem mesopedobiont community O.N. Kunah34 Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine The results of studying the spatial structure of soil mesofauna of an urbanotechnozem by OMI- and RLQ-analysis are presented. The research was conducted on 5 June 2012 in the Botanic Garden of Oles Gonchar University (previously – territory of the Park Y. Gagarin, Dnipropetrovsk). The studied plot is situated on the slope of the Krasnopostachekaya balka (48°25'57.43" N, 35°2'16.52" E). The plot consists of 15 transects directed in a perpendicular manner in relation to the talweg. Each transect is made of seven sample points. The distance between points is 2 m. The coordinates of the lower left point were taken as (0; 0). The plot consisted of artificial grassland with a single tree. The vegetation was composed of grassland and steppe, of a mega-mesotrophic, xeromesophilic character. At each point the mesopedobionts were studied (data presented as L-table); temperature, electrical conductivity and soil penetration resistance, and grass height were measured (data presented as R-table). The soil-zoological test area was 25 × 25 cm.