Aktualisierung Des Biotopinventars Vorarlberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GIS-Based Roughness Derivation for Flood Simulations: a Comparison of Orthophotos, Lidar and Crowdsourced Geodata
Remote Sens. 2014, 6, 1739-1759; doi:10.3390/rs6021739 OPEN ACCESS remote sensing ISSN 2072-4292 www.mdpi.com/journal/remotesensing Article GIS-Based Roughness Derivation for Flood Simulations: A Comparison of Orthophotos, LiDAR and Crowdsourced Geodata Helen Dorn 1, Michael Vetter 2,3 and Bernhard Höfle 1,* 1 Institute of Geography & Heidelberg Center for the Environment (HCE), Heidelberg University, Berliner Str. 48, D-69120 Heidelberg, Germany; E-Mail: [email protected] 2 Institute of Geography, University of Innsbruck, Innrain 52f, A-6020 Innsbruck, Austria; E-Mail: [email protected] 3 Centre for Water Resource Systems; Research Groups Photogrammetry & Remote Sensing, Vienna University of Technology, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, Austria * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +49-6221-54-5594; Fax: +49-6221-54-4529. Received: 4 October 2013; in revised form: 28 January 2014 / Accepted: 12 February 2014 / Published: 24 February 2014 Abstract: Natural disasters like floods are a worldwide phenomenon and a serious threat to mankind. Flood simulations are applications of disaster control, which are used for the development of appropriate flood protection. Adequate simulations require not only the geometry but also the roughness of the Earth’s surface, as well as the roughness of the objects hereon. Usually, the floodplain roughness is based on land use/land cover maps derived from orthophotos. This study analyses the applicability of roughness map derivation approaches for flood simulations based on different datasets: orthophotos, LiDAR data, official land use data, OpenStreetMap data and CORINE Land Cover data. -

Landratsamt Bregenz 1940-1945
Vorarlberger Landesarchiv 1/60 Rep. 14-300 Landratsamt Bregenz 1940-1945 Landratsamt Bregenz 1940-1945 1. Bestandsgeschichte Die Akten des Landratsamtes (LRA) Bregenz wurden durch die Bezirkshauptmannschaft (BH) Bregenz zu einem bei der Abfassung dieser Bestandsübersicht, d. i. das Jahr 2002, nicht mehr eruierbaren Zeitpunkt an das Vorarlberger Landesarchiv übergeben. Die Akten waren in Faszikeldeckel verpackt, provisorisch beschriftet und wurden im Keller des Hauptgebäudes des Vorarlberger Landesarchivs (VLA) in der Kirchstraße 28 in Bregenz gelagert. Die klima- tischen Bedingungen in diesem Keller zeichneten sich durch eine hohe Luftfeuchtigkeit (im Jahresschnitt 65 %) und jahreszeitlich bedingte schwankende Temperaturen aus. Der gesamte Bestand wurde von Mai bis November 2002 durch Mitarbeiter des Verwaltungsarchivs im VLA, Herrn Robert Demarki und Dr. Wolfgang Weber, neu bewertet und erschlossen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde das Schriftgut der Jahrgänge 1940-1945 des LRA Bregenz von Metallklammern gesäubert, lose Aktenkonvolute in säurefreie Umschläge eingelegt, in säure- freie Schachteln umgebettet und diese neu beschriftet. Das Aktenmaterial ist gleichzeitig einer genauen Prüfung auf Pilz- und Schimmelbefall unterzogen und ggf. skartiert worden. Als Grundlage für die Ablage und Neuverzeichnung der Akten des LRA Bregenz diente der überlieferte Einheitsaktenplan des LRA Bregenz aus dem Jahr 1942, der im Repertorienzim- mer des VLA zugänglich ist. Für die Bau- und Gewerbeakten sind eigene Findbücher überlie- fert, auf die in dieser Auflistung bei den einschlägigen Akten hingewiesen wird. Sie sind ebenfalls im Repertorienzimmer zugänglich. Nicht alle im Aktenplan 1942 verzeichneten Akten waren tatsächlich überliefert, die fehlen- den bzw. nicht überlieferten Akten wurden im Einheitsaktenplan mit einem roten Stempel „SKARTIERT“ ausgewiesen. Als Datum der Vernichtung gilt der 18.11.2002, auch wenn zahlreiche Akten offenbar schon durch die Behörde vernichtet (sic!) und nie an das VLA ab- gegeben wurden. -

Wasser in Vorarlberg
Wasser in Vorarlberg Wissenswertes über den wertvollsten Bodenschatz des Landes Die wichtigsten Zahlen und Fakten Vorwort Vorarlberg verfügt mit seinem Wasserreichtum über einen sehr wichtigen Bodenschatz. Wir erleben Wasser als Regen oder Schnee, in den Gebirgsbächen, Flüssen oder im Bodensee. Wasser ist aber auch Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere. Wir nutzen das „Lebens-Mittel“ Wasser darüber hinaus zum Trinken und Waschen – und als Energielieferant: Strom aus Wasserkraft ist eine wichtige erneuerbare Energiequelle. Gleichzeitig tragen wir eine besondere Verantwortung, dieses kostbare Gut vor Verunreinigungen zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften – beispielsweise mit dem Vorarlberger Trinkwasservorsorgekonzept. Wir müssen uns aber auch vor den Gefahren des Wassers schützen. Wasser als Lebensraum zu erhalten oder auch wieder herzustellen, ist eine weitere wichtige Herausforderung. Haben Sie gewusst, dass es in Bregenz mehr als doppelt so viel regnet wie in London? Dass auf einem Quadratmeter Gewässersohle bis zu 200.000 Organismen leben? Oder dass wir in Vorarlberg ein Netz von ca. 3.600 Kilometer Wasser- leitungen haben und der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch 130 Liter beträgt? Mit dieser aktualisierten Broschüre wollen wir unserer Bevölkerung die wichtigsten Informationen zum Thema Wasser in Vorarlberg näherbringen. Sie soll zudem zum bewussten und sorgsamen Umgang mit unserem Wasser beitragen. Landeshauptmann Landesrat Mag. Markus Wallner Christian Gantner H20 und mehr Was ist Wasser? Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H). Es ist der einzige bekannte Stoff, der in der Natur in nennenswerten Mengen in allen drei klassischen Aggregatzuständen2 existiert. Die Bezeichnung Wasser wird besonders für den flüssigen Zustand verwendet. Im festen, also gefrorenen Zustand, wird es Eis genannt, im gasförmigen Zustand Wasserdampf, oder einfach nur Dampf. -

BULLETIN 3 EN Published in March 2018
BULLETIN 3 EN published in march 2018 Content 1 | World Gymnaestrada 2019 in Dornbirn 5 | Organisation 1.1. Welcome ............................... 3 5.1 Arrival ................................. 61 1.2. News ................................... 4 5.2 Visa requirements ...................... 63 1.3. World Gymnaestrada .................... 6 5.3 Insurance .............................. 64 1.4. Our Guideline 2019 ...................... 8 5.4 Notification of Interest / Notification of Participants .............. 65 2 | Host country 5.5 Merchandising ......................... 66 5.6 Stands ................................. 67 2.1 Location ............................... 13 2.2 Austria – Vorarlberg – Dornbirn .......... 14 6 | Contact 2.3 National Villages ....................... 16 2.4 Accommodation ....................... 17 6.1 FIG .................................... 70 2.5 Catering ............................... 21 6.2 LOC .................................... 71 2.6 Public Transport ........................ 22 2.7 Excursion destinations .................. 25 3 | Venues 3.1 Trade Exhibition Centre Dornbirn ........ 37 3.1.1 Hall plans ............................ 38 3.1.2 Gymnastic Apparatus .................. 41 3.2 Birkenwiese Dornbirn ................... 46 3.3 Casino Stadium Bregenz ................. 48 3.4 Open-air stages ......................... 50 4 | Programme 4.1 Provisional Timetable ................... 53 4.2 Opening Ceremony ..................... 54 4.3 Group Performances .................... 54 4.4 Large Group Performances -

Dezember 2008 Nr. 116 P H A
dorf es e s t u n r ö o Dezember 2008 Nr. 116 p h a c s s Entente Florale 2 0 0 4 Der Winter hat Einzug gehalten Unser Dorf präsentiert sich wieder im weißen Kleid Nach einem ungewöhnlich warmen und niederschlagsarmen Herbst hat der Winter seit November in Lech und Zürs Einzug gehalten. Somit präsentiert sich unser der Gemeinde Lech Dorf wieder im “Weißen Kleid” des Winters. Auch heuer konnte der Saisonsbeginn pünktlich wahrgenommen werden und fast das gesamte Liftangebot stand bereits am ersten Wochenende zur Verfügung. Wintereintreiben Inhaltsverzeichnis: Die heurige Saison wurde mit einer ganz besonderen Veranstaltung begonnen. Im Zuge des “Winter ein trei - Vorwort Bgm. Ludwig Muxel 2 bens” versammelten sich am Schlegelkopf über 2.000 Zu - Informationen 3 schauer, um die mysthische Show rund um die nordi- Aus der Gemeindestube 4 schen Götter des Schnees und der Kälte mitzuverfolgen. Gemeindearchiv 18 Kulturnews 19 Malwoche 20 Jugendbergrettung 20 Lecher Bergsommer 21 Liftsessel mit Meerblick 21 Philosophicum Lech 22 Kirchenchor 24 Trachtenkapelle 24 Lecher Musikantentag 25 Lech- Zürs Tourismus 26 Kästle Mountain Museum 29 Geburtstage 34 Nachrichten 2 –Dezember 2008 Vorwort des Bürgermeisters Das abgelaufene Jahr war aus touristischer Sicht das bisher erfolgreichste in der Geschichte von Lech und Zürs. Die Millionengrenze bei den Jahresnächtigungen konnte überschritten werden und auch die Umsätze waren sehr zufriedenstellend. Die Wintersaison war von sehr guter Schneelage und passendem Wetter geprägt. Auch die Sommersaison konnte mit einem Nächtigungsplus abgeschlossen werden. Es hat sich gezeigt, dass die Marke Lech-Zürs im Qualitätstourismus einen sehr hohen Stellenwert hat und dass unsere Bemühungen bei den Gästen guten Anklang finden. -

Gesamtspielplan Frühjahr 2016 - 1
Gesamtspielplan Frühjahr 2016 - 1. April 13.03.2016 SO 14.30 FC Wolfurt I SW Bregenz 0:1 26./27. 3. 26.03.2016 SA 15.00 FC Höchst FC Wolfurt I 1:1 26.03.2016 SA 15.00 SCR Altach 1b FC Wolfurt Ib 5:0 26.03.2016 SA 15.30 Kennelbach I SV Lochau 0:3 2./3.4. 03.04.2016 SO 16.00 FC Wolfurt I FC Bizau 0:3 03.04.2016 SO 13.30 FC Wolfurt Ib FC Au 3:0 02.04.2016 SA 16.00 FC Schwarzach Kennelbach I 4:0 03.04.2016 SO 10.30 FC Kennelbach Ib FC Hittisau 0:2 03.04.2016 SO 10.30 Jugend U18 Austria Lustenau 0:5 02.04.2016 SA 14.45 SG Satteins Jugend U16-A 2:4 03.04.2016 SO 14.00 FC Lustenau Jugend U14-A 3:7 9./10.4. 09.04.2016 SA 16.00 Admira Dornbirn FC Wolfurt I 09.04.2016 SA 16.00 Hochmontafon FC Wolfurt Ib 09.04.2016 SA 17.00 Kennelbach I FC Lustenau 09.04.2016 SA 15.00 FC Langenegg 1b FC Kennelbach Ib 09.04.2016 SA 14.30 SCR Altach Jugend U18 10.04.2016 SO 10.00 RW Rankweil Jugend U16-A Kunstrasen 09.04.2016 SA 14.30 FNZ Vorderwald B Jugend U16-B 10.04.2016 SO 16.00 Jugend U14-A SW Bregenz 09.04.2016 SA 14.15 SG Rheindelta Jugend U14-B Fußach 10.04.2016 SO 12.45 Jugend U12-A FC Hard A 10.04.2016 SO 14.15 Jugend U12-B VfB Hohenems 10.04.2016 SO 14.15 Jugend U12-C SK Bürs 09.04.2016 SA 10.00 FC Lustenau A Jugend U10-A Holzstraße 10.04.2016 SO 11.00 Jugend U10-B SCR Altach B 10.04.2016 SO 11.00 Jugend U10-C FC Schlins B Gesamtspielplan Frühjahr 2016 - 1. -

Bibliotheken in Vorarlberg Bibliotheken KLL-2019-04 2-5 Abholfolder Wickelfalz A4 191113 DRUCK.Indd 2
Bücherei Egg Bücherei Spielothek Lochau Bücherei Dornbirn Rohrbach Stadtbibliothek Feldkirch www.vorarlberg.at/kinderliebenlesen [email protected] 22175 T +43 5574 511 Bregenz 15, 6901 Landhaus, Römerstraße Jugend und Familie Fachbereich Abteilung Elementarpädagogik, Schule und Gesellschaft Landesregierung Amt der Vorarlberger www.vorarlberg.at/kinderliebenlesen Kindes finden Sie unter: Ihres und Leseförderung Informationen zur Initiative und Sprach- Weitere Bibliotheken in Vorarlberg Pfister 780, T +43 5512 20756 Landstraße 28, T +43 5574 53902 Rohrbach 37, T +43 664 4761693 Schlossergasse 8, T +43 5522 304 1275 www.egg.bvoe.at www.lochau.bvoe.at www.buecherei.dornbirn.at www.feldkirch.at VORARLBERGER LANDESKRANKENH Eine Bibliothek ist für alle ein Ort der Begegnung. Nutzen Sie das breite Bücherei Spielothek Fußach Bücherei und Spielothek Mellau Bücherei und Spielothek Bibliothek Frastanz Medien- und Veranstaltungsangebot. Alle Informationen dazu finden Sie Herrenfeld 2, T +43 5578 77154 Platz 285, T +43 5518 2228 3 Dornbirn Schoren Kirchplatz 4, T +43 5522 51769 30 unter: www.bvv.bvoe.at www.fussach.bvoe.at www.mellau.bvoe.at Schorenquelle 5, T +43 5572 23344 22 www.bibfrastanz.bvoe.at www.buecherei.dornbirn.at Bibliothek Gaißau Mediathek und Weltladen Mittelberg bugo Bücherei Göfis Walserbibliothek St. Gerold Rheinstraße 18, T +43 650 2711624 Kirchplatz 4 Bücherei und Spielothek Büttels 3, T +43 5522 72715 400 Bezirk Bludenz Hnr. 84, T +43 5550 213460 www.gaissau.bvoe.at www.kleinwalsertal.com Dornbirn Wallenmahd www.goefis.at/bugo -

Sternen Hotel ENG
The Sternen Hotel in an overview Our hotel is ideal to reach by car. Perfect traffic connections to public transportation make it possible to get from the * 69 rooms in different categories airport or the rail station to the hotel easily. You can reach (all are non-smoking rooms) Bregenz and Dornbirn in only a few minutes. * Free WLAN throughout building Organic Sauna and infrared heating booth * By car * Fitness room with modern equipment Coming from Innsbruck/Arlberg (A14): * Healthy breakfast buffet with regional Exit ramp “Dornbirn Nord” > in the roundabout in the B200 products > before the “Achraintunnel” you have to turn left in the direction of Schwarzach > turn left into the “Hofsteigstraße” * Spacious lobby with a modern lounge area in the direction of Bregenz > follow the course of the road Hotel bar with a separate smoking lounge * until the town hall of Wolfurt (Wolfurter Rathaus) > turn Laundry service * right to the Sternen Hotel * Barrierfree hotel and accessible rooms or * Next door to the Restaurant Stern with Exit ramp Lauterach/Wolfurt > turn right into the L3 in the a public garden direction of Wolfurt/Kennelbach and follow the course of the street until the town hall of Wolfurt > turn left to the * On-site garage Sternen Hotel * Seminar opportunities Coming from Germany (A14): Exit ramp “Bregenz Knoten Weidach” > roundabout into the L13 in the direction of Kennelbach (Bregenzerstraße) > follow the course of the street until the L13 crosses the Sternenplatz 4 L3 > turn left > follow the course of the street until the A 6922 Wolfurt town hall of Wolfurt > turn left to the Sternen Hotel T +43(0)5574 64 999 F +43(0)5574 64 999–64 By Bus & Train [email protected] The nearest and largest rail stations are in Bregenz www.sternenhotel.at and Dornbirn. -
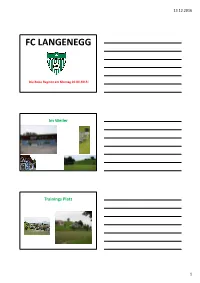
Fc Langenegg
13.12.2016 FC LANGENEGG Die Reise Beginnt am Montag 20.04.2015! Im Weiler Trainings Platz 1 13.12.2016 1 Cetinkaya Muhi TW 28.07.1988 2 Wohlgenannt Michael TW 26.06.1995 3 Bader Michael RV 14.12.1990 4 Spiegel Dietmar IV 09.08.1987 5 Plut Stefan IV 19.04.1981 6 Bechter Günther LV 15.03.1989 7 Schwärzler Klaus RM 18.02.1986 8 Gil Gilnei DM 18.11.1985 9 Dürr Harry DM 02.10.1978 10 Maldoner Patrick ZM 29.12.1993 11 Muniz Grisley OM 25.06.1984 12 Röser Andreas LM 03.05.1995 13 Kohler Johannes ST 05.01.1987 14 Schmidler Mario RV 03.12.1989 15 Eberle Manuel RV 24.05.1991 16 Schmidler Daniel LV 28.11.1986 17 Hagspiel Michael RM 14.03.1986 18 Hammerer Andre ST 30.05.1991 19 Steurer Simon ST 20.11.1994 20 Nußbaumer Pascal LV 31.08.1993 21 Steurer Marcel U 18 ST 06.07.1998 22 Zemanek Kevin IV 31.07.1978 Saison 2014 / 2015 FC Langenegg – SV Lochau 3-2 SA 25.04.2015 Kohler Röser Maldoner P Schwärzler Gil Dürr Bechter G Bader Plut Spiegel Cetinkaya Bank: Wohlgenannt , Muniz, Hagspiel , Hammerer, Schmidler D Saison 2014 / 2015 FC Langenegg – FC Thüringen 3-1 SA 13.06.2016 Kohler Röser Schwärzler Muniz Gil Dürr Schmidler D Bader Bechter G Plut Cetinkaya Bank: Wohlgenannt , Hagspiel , Hammerer, Zemanek 2 13.12.2016 Landesliga Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt. 1 HELLA Dornbirner 26 20 3 3 80:30 50 63 Sportverein 2 FCLangenegg 26 15 6 5 71:3o 40 51 3 (+1) Schwarzach 26 14 7 5 55:44 11 49 4 (-1) Lochau 26 14 6 6 57:37 20 48 5 Schruns 26 13 4 9 63:43 20 43 6 (+2) Gaissau 26 12 4 10 69:44 25 40 7 (-1) BayWaLamag FC 26 11 6 9 52:45 7 39 Thüringen 8 (+1) -

Dokumentvorlage Für Risdokumente
Landesrecht Bundesland Vorarlberg Kurztitel Volksschulsprengelverordnung Kundmachungsorgan LGBl.Nr. 41/1979 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 7/2017 Typ V §/Artikel/Anlage § 1 Inkrafttretensdatum 01.09.2017 Außerkrafttretensdatum 10.09.2017 Index 30 Schulwesen Text § 1 Die Schulsprengel der öffentlichen Volksschulen werden wie folgt festgesetzt: A. Verwaltungsbezirk Bludenz: Gemeinde Bartholomäberg: V o l k s s c h u l e B a r t h o l o m ä b e r g : Gemeindegebiet Bartholomäberg mit Ausnahme der Ortsteile Jetzmunt und Gantschier und der Häuser Innerberg Nr. 65 und 81 sowie der Ortsteil Keller aus dem Gemeindegebiet Silbertal. V o l k s s c h u l e G a n t s c h i e r : Ortsteile Gantschier und Jetzmunt und aus dem Gebiet der Marktgemeinde Schruns der Ortsteil Kaltenbrunnen. Gemeinde Blons: V o l k s s c h u l e B l o n s : Gemeindegebiet Blons. Stadt Bludenz: V o l k s s c h u l e B l u d e n z - O b d o r f : *) www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 13 Landesrecht Vorarlberg Gebiet der Stadt Bludenz nördlich nachstehender Grenze: von der westlichen Gemeindegrenze entlang der Werdenbergerstraße (beidseitig) bis zur Kreuzung Werdenbergerstraße/Fohrenburgstraße – Fohrenburgstraße in nördlicher Richtung (beidseitig) – St. Annastraße (beidseitig) – bis zur Mutterstraße (ausschließlich) – Spitalgasse und Schloßplatz (beide einschließlich). *) Fassung LGBl. Nr. 27/2010 V o l k s s c h u l e B l u d e n z - M i t t e : Das zwischen den Schulsprengeln Bludenz-Obdorf und Bludenz-St. -

Kraftwerksbauten Im Bregenzerwald Und Ihre Anpassung an Die Geologischen Verhältnisse
©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Die Geologie von Vorarlberg- Redaktion: Maria Heinrich Beispiel einer internationalen Zusammenarbeit im Bereich der westlichen Ostalpen Jb. Geo!. B.-A. I ISSN 0016-7800 I Band 135 I Heft 4 I S.857-866 Wien, Dezember 1992 Kraftwerksbauten im Bregenzerwald und ihre Anpassung an die geologischen Verhältnisse Van HERMANN LOACKER*) Mit 7 Abbildungen und 2 Tabellen Dr. RUDOLF OBERHAUSER zum 65. Geburtstag gewidmet Vorarlberg Schweiz Oslerreichische Karle 1: 50.000 Baugeologie Blätter 81-83, 110-113 Kraltwerksbau Inhalt Zusammenfassung , 857 Abstract .........................................................................................•....................... 857 1. Kraftwerksbauten an der Bregenzerach vor 1939 , : : ..•..................... 857 2. Kraftwerksplanungen zwischen 1939 und 1972 : .. ~ 858 3. Das Kraftwerk Langenegg 860 3.1. Staudamm Bolgenach 860 3.2. Beileitung der Subersach 862 3.3. Rotenbergstollen 864 3.4. Krafthaus Langenegg : 865 4. Weitere Kraftwerksbauten 865 Literatur 866 Zusammenfassung Die Planung des Wasserkraftausbaues an der Bregenzerach und ihre Anpassung an die geologischen Gegebenheiten wird beschrieben. Weiters wird über die geologischen Neuaufschlüsse in der Subalpinen Molassezone, der Nördlichen Flyschzone und der Feuerstätterzone beim Baudes Kraftwerkes Langenegg berichtet. Power Plants in the Bregenzerwald Area and their Adaption to the Geological Situation Abstract The design of the water power plants at the Bregenzerach River and the adaption to the geological situation is reported. Further the new geological exposures in the Subalpine Molassezone, the Northern Flysch Zone and the Feuerstätter Zone created by the power plant of Langenegg are de- scribed. 1. Kraftwerksbauten an der Bregenzerach Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft - das Kraft- vor 1939 werk Andelsbuch in Betrieb. Durch einen 1568 m langen Stollen wird die Bregenzerachschleife zwischen Bezau Wasserkraftbauten haben an der Bregenzerach eine alte und Andelsbuch abgeschnitten. -

Travel Guide #Bregenzerwald
travel guide bregenzerwald summer 2018 bregenzerwald Bregenzerwald Tourismus summer 2018 Impulszentrum 1135 . 6863 Egg . Vorarlberg . Austria Ideas and Addresses. T +43 (0)5512 2365 . F +43 (0)5512 3010 Your guide through the [email protected] . www.bregenzerwald.at Bregenzerwald. www.facebook.com/BregenzerwaldTourismus www.youtube.com/bregenzerwaldtourism #bregenzerwald He comes from Lustenau, his wife from Denmark. Simon Hofer and artist Ronja Svanenborg moved to Sibratsgfäll to live and work. The place is not exactly known Long distance hiking routes lead for its shipbuilding tradition but Simon through Bregenzerwald. Author Irmgard wants to change this. With wood of Editor: Photographs: Kramer knows every hiking trail that is course. Bregenzerwald Tourismus GmbH, Monika Albrecht (p. 19) characterized by (mountain) cheese. This Impulszentrum 1135, 6863 Egg Almhotel Hochhäderich (p. 53) route goes far but she is unfettered by Angelika Kauff mann Museum (p. 83) Archiv Bregenzerwald Tourismus (p. 84) heavy luggage so can enjoy everything Design by: Au-Schoppernau Tourismus (p. 52) that occurs on the way. Bezau Beatz (p. 78) broger grafi k, Andelsbuch Rudolf Berchtel (p. 11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/ 24/25/29) Ludwig Berchtold (p. 9/10/23/27/31/36/90/94/96) Printed by: Adolf Bereuter (Titelbild, p. 8/26/33/37/42/43/47/64/65/ Druckhaus Gössler, Dornbirn 66/68/69/79/88/92/102/106/108/109) Christa Branz (p. 56) Markus Curin (p. 97) Text by: Ian Ehm friendship.is (p. 77) Does French savoir vivre fi t in Kinz Kommunikation Bregenzer Festspiele (p. 75) Bregenzer wald? Juliane and Guy Gasthof Adler Lingenau (p.